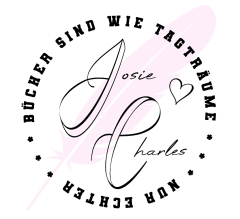Prolog
‚Here without you‘
Hudson Mills, Michigan
Elf Monate zuvor
Jess
Ich beiße in den glänzend roten Apfel. Das Fruchtfleisch zerplatzt zwischen meinen Zähnen und ich sauge gierig den Saft ein.
Wer hätte gedacht, dass ein Apfel so gut schmecken kann?
Nervös sehe ich hinter mich, dann beiße ich nochmal zu. Es wäre klüger, das Obst mitzunehmen und es in Ruhe heimlich im Bett zu essen, aber ich kann mich nicht beherrschen.
Ich muss einfach nur schnell machen. Ein drittes Mal beiße ich ab, kaue hastig und der klebrige Saft läuft mir übers Kinn. Ich überlege, ob man das Kerngehäuse mitessen kann. Ein Apfelbaum im Bauch wird mir davon wohl kaum wachsen, wie Mom immer behauptet hat. Aber wenn ich morgen früh mit Magenschmerzen antrete, werden die Aufseher –
»Aldridge! Bist du hier?«
Ich reagiere sofort, lasse mich zu Boden fallen und krieche unter die Arbeitsfläche der großen Küche, in die Aussparung, wo sich die Mülleimer befinden.
Von dort aus lausche ich und höre schwere Schritte auf dem Fliesenboden. »Jessica Aldridge! Ich schwöre bei Gott, wenn ich dich erwische, Mädchen …«
Verflucht. Das ist Aufseher Morton, ein ehemaliger Navy Seal mit drahtigen Muskeln und kurzgeschorenem rotem Haar. Er macht meistens die Nachtwache, immer allein, da das Camp nicht sehr groß und zudem mit Stacheldraht umzäunt ist. Sein Kontrollgang hätte allerdings erst um zwei stattfinden dürfen. Dann wäre ich längst zurück in der Baracke gewesen, wo meine Mitinsassinnen, erschöpft von dem harten Arbeitstag, tief und fest schlafen.
Warum musste er ausgerechnet heute früher dran sein?
»Aldridge!« Seine Schritte nähern sich, wenn auch langsam. Er scheint sich sicher zu sein, dass ich hier irgendwo bin, denn seine Stimme ist zu einem vorfreudigen Singsang geworden.
Scheiße. Das ist das Schlimmste an der Besserungsanstalt, in der ich mich befinde, dem sogenannten Bootcamp: Wir Insassinnen werden rund um die Uhr überwacht, aber niemand überwacht die Wärter.
Ich ziehe die Beine so weit an, wie es geht, rutsche zwischen den Mülleimern an die Wand und versuche, flach und lautlos zu atmen.
Den halb aufgegessenen Apfel halte ich mit beiden Händen fest und muss mich trotz allem beherrschen, um nicht nochmal hineinzubeißen. Weil ich vor dem Mittagessen versucht habe, das Handy eines Wärters zu stehlen, musste ich bis zum Abendappell die Baracken putzen und danach direkt ins Bett. Dadurch habe ich zwei Mahlzeiten verpasst und bin so hungrig, dass es mir beim Duft des Apfels fast egal ist, ob ich erwischt werde.
»Aldridge …« Wieder dieser Singsang. Und dazu erkenne ich jetzt den Kegel einer Taschenlampe, der über die Edelstahlschränke tanzt. »Komm freiwillig raus und wir vergessen die Sache!«
Lügner.
Mit klopfendem Herzen beobachte ich, wie Mortons Stiefel dem Lichtkegel in mein Sichtfeld folgen. Ohne das geringste bisschen Eile schreitet er an den Küchenschränken entlang, kommt näher, noch näher, und bleibt dann genau vor dem Arbeitstisch stehen, unter dem ich hocke. So ein Mist.
Ich halte die Luft an und beobachte, wie das Licht über den Boden wandert, zuerst weiter weg, dann leuchtet Morton den Bereich direkt unter sich ab. Dort glänzen ein paar frische Tropfen Apfelsaft auf dem Boden.
Ich fluche lautlos.
Und dann taucht auch schon Mortons feistes Gesicht vor mir auf. Er macht ein triumphierendes Geräusch, umklammert meinen Fußknöchel und zerrt mich mit einem Ruck unter dem Tisch hervor. »Hab ich dich!«
Sofort erwacht mein Kampfgeist. Ich lasse den Apfel los und versuche, auf alle Viere zu kommen. Doch Morton hält immer noch meinen Fuß fest. Ich höre ihn etwas sagen, irgendwas mit »Ratten in meiner Küche«, dann ziept etwas an meinem Bein und im nächsten Moment krampfen sich all meine Muskeln schmerzhaft zusammen.
Meine Arme geben nach, ich schlage mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Mein Körper zuckt und ich kann nicht atmen.
Dann ist es vorbei, Morton lässt mich los und ich schnappe nach Luft.
Der Aufseher geht um mich herum, hockt sich vor mich und sieht feixend auf mich herab. »Hast du gedacht, mir wäre nicht klar, dass du dich heute Nacht rausschleichst? Glaub mir, ich kenne Ratten wie dich. Ihr denkt, ihr könnt durch die Welt marschieren und euch einfach nehmen, was euch zusteht.« Mit spitzen Fingern klaubt er den Apfel vom Boden auf und hält ihn mir hin. »Aber du musst lernen, dass das nicht stimmt. Man muss für alles im Leben bezahlen, Aldridge!«
Damit wirft er mir das Obst ins Gesicht. Feucht klatscht es gegen meine Wange, ich kneife die Augen zu und beiße wütend die Zähne aufeinander.
Wie gerne würde ich diesem Sadisten meine Faust in die Weichteile rammen und ihm zeigen, wer hier am Ende bezahlen muss. Aber das wäre nicht klug. Denn er hat den Elektroschocker und zögert nicht, ihn zu benutzen, wie er gerade bewiesen hat.
»Weißt du was, Aldridge?« Morton steht auf und geht um mich herum. »Ich finde es wirklich schade …« Etwas rumpelt. »… dass du bei deinem kleinen Ausflug so ein Chaos angerichtet hast. Jetzt wirst du hier leider saubermachen müssen.«
Einen kurzen Augenblick frage ich mich, wovon er redet, denn die Küche ist blitzsauber. Dann poltert es erneut und im nächsten Moment ergießt sich der Inhalt einer der Mülltonnen über meinen Rücken. Irgendetwas fällt in meinen Nacken, Schälabfälle und Essensreste regnen auf die Fliesen.
»Das nächste Mal«, fährt Morton fort und kickt den zweiten Mülleimer um, »bleibst du wohl besser in deinem Bett liegen und wartest bis zum Frühstück. Jetzt beeil dich und dann zurück in die Baracke. In einer Stunde kontrolliere ich, ob du schläfst.«
Damit lässt er mich allein. Ich richte mich auf und sehe mir das Chaos um mich herum an.
Keine Ahnung, ob ich vor Wut oder von dem Elektroschock zittere, aber als ich aufstehe, muss ich mich erstmal am Schrank abstützen.
Ich wische mir die klebrigen Apfelreste aus dem Gesicht, dann mache ich mich widerwillig an die Arbeit.
Keine Ahnung, wie ich hier weitere elf Monate überstehen soll.
East
Die schwarze Landschaft jenseits der Interstate fliegt an mir vorbei, die Musik ist voll aufgedreht und aus den Lautsprechern dröhnt Slipknot.
Ich grinse in mich hinein, während ich den Mustang über die Autobahn jage, weil ich es kaum erwarten kann, Jessica wiederzusehen.
Viel zu oft kam es mir während der letzten drei Monate vor, als wäre sie tot. Erinnerungen an die Nacht ihrer Verhaftung fluten mein Hirn. Der altbekannte Zorn flammt in mir auf, lässt mir das Grinsen im Gesicht gefrieren und mich das Lenkrad fester umklammern.
Am Abend war sie noch bei mir gewesen, ich fuhr sie nach Hause und wir küssten uns hier in meinem Wagen. Und am nächsten Morgen war sie fort, einfach verschwunden aus meinem Leben. Es fühlte sich an wie kalter Entzug. Wenn ich ehrlich bin, tut es das immer noch. Aber damit ist heute Nacht Schluss. Sie wird wieder bei mir sein und das ist das Einzige, was für mich zählt.
Ich muss mich zwingen, das Gaspedal nicht voll durchzutreten, während ich nach Hudson Mills fahre. Ärger mit den Cops kann ich jetzt nicht gebrauchen, denn ich habe keine Ahnung, was ich tue, wenn ein Bulle versucht, mich noch länger von Jess fernzuhalten.
Drei Monate. 91 Tage.
Es wird Zeit, diesen Dreck zu beenden.
Als das Ortseingangsschild von Hudson Mills am Fahrbahnrand auftaucht, regle ich die Musik herunter und werde langsamer. Das Camp befindet sich in den Wäldern hinter der Ortschaft, ich war in den vergangenen Wochen mehrfach dort, um alles auszukundschaften. Ich kenne jeden der Wärter, jede einzelne Personalakte. Ihre Gewohnheiten, ihre Rituale, sogar die Ängste, über die sie sich in irgendwelchen Internetforen ausheulen, in die ich normalerweise keinen Fuß setzen würde.
Heute Nacht ist Wärter Morton am Drücker, ein Veteran, der mal drei Tage bei vollkommener Dunkelheit in einer Höhle in Afghanistan eingeschlossen war.
Mach dich auf was gefasst, Arschloch.
Ich durchquere den Ort und schalte nach gut zwei Meilen die Scheinwerfer ab.
Ein paar Meter noch, bis die Straße endet und das Tor zur Hudson Mills Special Alternative Incarceration Facility vor mir auftauchen wird. Ich trete auf die Bremse, fahre rechts ran und parke den Wagen, um das letzte Stück zu Fuß zu gehen.
Kein unnötiges Risiko, denn ich habe nur diese eine Chance. Sobald die da drinnen kapieren, dass jemand kommt, um Jess zu befreien, stecken sie sie wahrscheinlich in Isolationshaft oder verlegen sie in einen richtigen Knast.
So leise es geht, mache ich die Wagentür hinter mir zu und lausche. Absolute Stille. Noch nicht einmal Grillen oder das Rauschen vom Wind in den Bäumen. Das Einzige, was ich höre, ist mein sich langsam beschleunigender Puls.
Cool bleiben.
Ein paar Minuten noch, dann hat dieser Scheiß ein Ende.
Ich taste meine Taschen nach meinem Handy ab, ziehe mir die Kapuze über den Kopf und setze mich in Bewegung.
Zeit für den Blackout.
Jess
Ich verlasse den Küchentrakt und trete auf den Hof, der durch zwei große Flutscheinwerfer taghell erleuchtet ist. Am liebsten würde ich duschen. Der widerliche Müllgestank hängt mir in der Nase und mit Sicherheit auch in meinen Klamotten. Aber ich habe klare Anweisungen und will nicht, dass mich Morton mit seinem Elektroschocker unter der Dusche besucht, deshalb gehe ich lieber direkt ins Bett.
Ich verscheuche ein paar Mücken, die versuchen sich auf mir niederzulassen, während ich den leeren Platz überquere.
Und dann wird es plötzlich dunkel.
Abrupt bleibe ich stehen, während die Finsternis mich einhüllt. Nicht nur die Flutlichter sind erloschen. Langsam drehe ich mich um mich selbst und stelle fest, dass auch die Neonröhren über den Eingängen der Baracken aus sind, genau wie die schummrige Schreibtischlampe im Büro der Nachtwache.
Für einen Moment fühlt es sich an, als wäre ich blind. Dann beginnen sich meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen und ich kann die schwarzen Umrisse der Gebäude ausmachen.
Was hat das zu bedeuten? Ist das ein Stromausfall?
Meine Gedanken beginnen sich selbstständig zu machen. Sagen wir, der Strom ist tatsächlich ausgefallen … Dann funktioniert auch der Elektrozaun nicht mehr und ich könnte ihn mühelos überwinden. Ich könnte loslaufen, runter in den Ort, dort ein Auto knacken und noch heute Nacht wieder bei East sein.
Ich stelle mir vor, wie ich mich in seine Wohnung schleiche, wie ich diese bescheuerten Bootcamp-Mokassins abstreife, mich aus dem stinkenden Overall schäle und mich zu ihm unter die Decke kuschle. Mich ganz dicht an seine warme Haut schmiege.
Langsam wende ich mich dem Tor zu, das sich etwa 50 Meter von mir entfernt befindet.
Es könnte so einfach sein …
Doch noch ehe ich eine Entscheidung treffen kann, geschieht erneut etwas Unerwartetes: Das Tor beginnt sich zu öffnen.
Fasziniert beobachte ich, wie die dicken Gitterstäbe zur Seite gleiten. In meinen Beinen kribbelt es und mein Herz zieht sich zusammen.
Das ist meine Chance.
Ohne mir darüber klar zu werden, was ich hier eigentlich tue, laufe ich los und bin mit einem Satz draußen, noch ehe das Tor komplett offen ist.
Dann höre ich jemanden lachen. Ich fahre herum, sehe mich hastig um – und entdecke eine Gestalt, die an einem Zaunpfeiler lehnt. Hochgewachsen, in einer Lederjacke, die sich über seine breiten Schultern spannt. Die lässig hochgeschobenen Ärmel enthüllen seine tätowierten Arme, eine Kapuze verbirgt sein Gesicht. Aber das macht nichts. Ich muss es nicht sehen, um ihn zu erkennen.
»East«, keuche ich.
»Was hast du vor?«, fragt er belustigt. »Willst du den ganzen Weg bis nach Detroit rennen?« Damit stößt er sich von dem Pfeiler ab und kommt auf mich zu.
Ich blicke ihm entgegen, völlig fassungslos, doch insgeheim habe ich gewusst, dass er kommen würde. Ich bin die Frau, die er liebt.
»Denn falls nicht«, sagt er und bleibt dicht vor mir stehen, »hätte ich eine Mitfahrgelegenheit für dich.«
Eine Sekunde lang starre ich seine vertrauten Züge an. Den stets leicht zornigen Schwung seiner Brauen, seine scharf geschnittenen Wangen, das siegessichere Lächeln auf seinen Lippen.
Dann schlinge ich die Arme um ihn, so heftig, dass meine Muskeln schmerzen, und flüstere: »Du bist hier.«
East hält mich fest, drückt mir seine warmen Lippen auf die Stirn. »Was hast du gedacht? Dass ich dich mir wegnehmen lasse?«
Ich sehe zu ihm auf und schüttle den Kopf. Ich weiß nicht, was ich dachte und es spielt auch keine Rolle. »Du bist vollkommen verrückt«, sage ich.
East gibt mir keine Antwort, zumindest nicht in Worten. Stattdessen zwinkert er mir zu, dann hebt er mein Kinn an und küsst mich.
Ich öffne den Mund und genieße, wie seine Zunge mich erobert. Zum zweiten Mal in dieser Nacht drohen meine Knie nachzugeben. Zum zweiten Mal jagen elektrische Stöße durch meinen Körper. Ich kralle die Finger in das Leder seiner Jacke und würde am liebsten dafür sorgen, dass dieser Kuss nie mehr endet.
East ist mein Freund seit zweieinhalb Jahren. Wir haben mehr zusammen durchgemacht als die meisten anderen in einem ganzen Leben. Er ist alles für mich. Aber uns läuft die Zeit davon. Fast gewaltsam löse ich meine Lippen von seinen, schließe die Augen und lehne meine Stirn an seine.
»Was hast du mit Morton gemacht?«, flüstere ich.
»Ihn in seine persönliche Hölle geschickt«, brummt East und mir jagt ein Schauer über den Rücken.
Ich liebe seine Kompromisslosigkeit.
»Wie hast du das Tor aufbekommen?«
»Hab letzte Woche ein Aggregat zwischengeschaltet.«
Ich lache ungläubig. »Du warst schon mal hier?«
»Dutzende Male. Ich war die ganze Zeit bei dir, Baby.«
Ich blicke auf, lege meine Hände auf seine kratzigen Wangen und küsse ihn ein weiteres Mal.
»Wir müssen los«, sagt er dann.
Ich sehe ihm in die Augen, er erwidert meinen Blick eindringlich.
»Ich hab meinen Wagen frisch hochgetunt auf 800 PS. Wir fahren abseits der Interstate und sind in einer halben Stunde zurück in Detroit. Dort holen wir Casper ab und dann verschwinden wir. Ich hab genug Geld auf ein Offshore-Konto eingezahlt, um …«
Der Rest seiner Worte verschwimmt.
Ich glaube, es ist die Tatsache, dass er meinen Bruder erwähnt, die die erste Euphorie verklingen und mich wieder klar denken lässt.
»Warte«, höre ich mich murmeln.
»Ich weiß, was du sagen willst, aber deswegen musst du dir keine Gedanken machen. Milo hat uns falsche Papiere erstellt, mit denen wir es problemlos über die kanadische Grenze schaffen, und von da …«
»East. Hör auf.« Ich packe seine Oberarme und bin drauf und dran ihn zu schütteln, damit er mir nicht länger von einer Zukunft erzählt, die es so nicht geben kann.
Fragend blickt East mich an.
Ich schüttle den Kopf und realisiere endlich, wie verrückt das hier ist. Wie verrückt ich mich gerade verhalte. Das plötzliche Öffnen des Tors hat mich einen Augenblick lang in Begeisterung versetzt. Aber ich darf ihr nicht nachgeben.
»Was ist?«, will East wissen und mustert mich mit zusammengezogenen Brauen.
»Ich kann nicht abhauen. Ich kann nicht …« Ich lasse ihn los und mache einen Schritt zurück. Als ich weiterspreche, klingt meine Stimme klarer und fester. »Wie stellst du dir das denn vor?«
»Hab ich dir doch gerade erklärt«, erwidert er, noch gelassen.
»Und wie soll das laufen? Cas ist 12. Er muss in die Schule. Er braucht einen geregelten Tagesablauf. Ich kann mit ihm doch kein Leben auf der Flucht führen!«
East schüttelt den Kopf. »Das tun wir auch nicht. Wir fangen neu an. Dein Bruder kann auf eine andere Schule gehen, unter neuem Namen und –«
»Und niemand wird nach uns suchen?«, frage ich heiser. »Das glaubst du doch selbst nicht.«
Ich spüre, wie Tränen in meinen Augen brennen und blinzle sie hastig weg. Ich sollte nicht enttäuscht sein. Ihn zu sehen, wenn es auch nur für ein paar Minuten war, war besser als alles, was ich mir von dieser Nacht erhofft hatte.
So können wir uns wenigstens vernünftig verabschieden – etwas, das bei meiner Festnahme nicht möglich war.
»Tut mir leid, aber ich muss das hier durchziehen«, sage ich leise und will East noch einen letzten Kuss geben.
Aber er packt mich ganz unvermittelt an den Schultern und schiebt mich ein Stück von sich, sodass er mich ansehen kann. »Was ist mir dir?«, fährt er mich an. »Haben sie dich schon so weit?«
»Ich weiß nicht, was du meinst«, gebe ich stumpf zurück.
»Du weißt so gut wie ich, was der Sinn von solchen Camps ist! Die brechen euren Willen und bauen euch so wieder zusammen, wie sie es gerne hätten! Willst du das, Jess? Ein verdammter Zombie werden?«
Ich muss mich zwingen, seinem stechenden Blick standzuhalten. »Es geht um Cas, glaub mir. Wenn es nur wir beide wären, würde ich …«
»Seit wann«, unterbricht er mich zornig, »vertraust du mir nicht mehr?«
Wie kann er mir sowas unterstellen?
Ich schlucke hart. »Ich vertraue dir.«
»Nein, das tust du nicht, sonst würdest du dich jetzt nicht so verflucht dämlich anstellen!«
Schnell sehe ich mich um, als er die Stimme erhebt, doch im Camp ist immer noch alles ruhig. Ich wende mich East zu, lege ihm erneut die Hände ins Gesicht, diesmal sanfter. »Sei nicht so ein Idiot. Ich liebe dich und ich werde wieder bei dir sein. In elf Monaten.«
East starrt mich einen Moment lang nur an. Sein Blick ist so durchdringend, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme. Dann lässt er mich los und löst beinahe angewidert meine Finger von sich. »Du liebst mich, ja?«
»Das habe ich doch eben gesagt.«
»Du hast auch mal gesagt, dass uns nichts auf der Welt trennen kann, Jess. Erinnerst du dich daran? Wo du hingehst, gehe auch ich hin. So wie ich das sehe, bin ich der Einzige, der sich an deine großen Worte hält!«
Ich halte Easts Blick stand, auch wenn es nicht leicht ist. Er schafft mühelos, was zwei Monate U-Haft, vier Wochen Bootcamp, Sklavenarbeit, Geschrei und Hunger nicht geschafft haben. Zum ersten Mal spüre ich pure, brennende Verzweiflung in mir aufsteigen.
»Lass uns jetzt bitte nicht streiten«, sage ich eindringlich. »Ich brauche dich, East. Ich brauche die Gewissheit, dass du da sein wirst, wenn ich rauskomme. Warte auf mich. Elf Monate. Das packen wir doch.«
East schüttelt den Kopf. Seine ganze Haltung hat sich verändert, ist feindselig geworden. »Nein, Jess. Spar dir das. Wenn du das mit uns so ernst meinst, wie du immer getan hast, wirst du jetzt in meinen Wagen steigen und mit mir kommen. Wenn nicht, kannst du zur Hölle fahren. Du verdammte Heuchlerin.«
Seine Worte treffen mich so hart wie eine Ohrfeige. Er ist eher verletzt als wütend, das höre ich an seiner Stimme, aber das ändert nichts an der Erkenntnis, die mich gleich darauf trifft wie ein weiterer Schlag. Er meint das ernst.
Ich sehe ihn an und sein zorniger Blick verschwimmt vor meinen Augen. Jetzt kann ich die Tränen nicht länger zurückhalten.
»Sei kein Arschloch«, presse ich hervor.
East starrt mich weiter an, fassungslos, als wäre ihm gerade klargeworden, dass er nicht Jess, sondern eine Fremde vor sich hat. »Letzte Chance«, sagt er und seine Stimme klingt kaum weniger brüchig als meine.
Dann wischt er über das Display seines Smartphones und ein Geräusch hinter mir verrät mir, was seine Worte bedeuten.
Das Tor hat sich zu schließen begonnen.
Nein. Ich kann das nicht tun. Auch nicht, wenn er versucht, mich zu zwingen.
Meine Beine setzen sich in Bewegung und fühlen sich im ersten Moment so schwer an, als würden Betonklötze daran hängen. Dann jedoch sprinte ich los und schaffe es gerade noch, mich zwischen den Torhälften hindurchzuschieben, ehe sie sich in der Mitte treffen. Ich komme stolpernd zum Stehen, drehe mich nochmal um, will East noch irgendetwas sagen, das ihn dazu bringt, seine Meinung zu ändern.
Doch er ist schon verschwunden.
Im nächsten Augenblick gehen die Lichter wieder an. Ich bleibe auf dem Hof stehen und starre raus auf den Vorplatz. In mir tobt ein Chaos aus Entsetzen, Trauer und Zorn.
Irgendwer ruft meinen Namen, doch ich rühre mich nicht. Stattdessen lausche ich auf den Motor, der irgendwo in der Dunkelheit der Wälder aufbrüllt, dann leiser wird und langsam verstummt.
Eines steht fest: Ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt.
Kapitel 1
‚Hometown Glory‘
Detroit, Michigan
Heute
Jess
14630 Riverside Boulevard. Der fünfte Wohnwagen in der zweiten Reihe vom Fluss aus gesehen gehört uns. Gestrichen in einem blassen Rot, durch das überall der Rost bricht. Ich bin in dieser Wohnwagensiedlung aufgewachsen und habe sie immer gehasst. Die Enge, den Schmutz, den modrigen Geruch. Doch als Kind kann man sich nicht aussuchen, wo man lebt und man sucht sich auch nicht aus, ob sein Vater ein Versager ist.
Die Tür ist zu, mein Dad und mein Bruder sind nirgends zu sehen. Auch sonst ist keiner hier, um mich in Empfang zu nehmen. Alles wirkt wie ausgestorben, nur der leichte Nieselregen sorgt dafür, dass sich in dieser leblosen Kulisse etwas bewegt.
Home Sweet Home, denke ich ironisch und neben mir seufzt Mrs Malcolm, meine Anwältin.
»Ich hatte letzte Woche angerufen und Bescheid gesagt, dass du heute kommst.«
»War es nach Mittag? Dann war er zu besoffen, um es sich zu merken.«
Mrs Malcolm sieht mich an und runzelt die Stirn, vermutlich über die Verachtung in meiner Stimme.
»Jess, ich weiß, das ist nicht ideal. Aber das Gericht hat deinen Vater nun mal als deinen gesetzlichen Vormund für die nächsten zwölf Monate eingesetzt und daran können wir nichts ändern.«
Ich nicke stumm, um ihr zu signalisieren, dass ich ihre Worte zur Kenntnis genommen habe. Aber das ändert nichts daran, wie scheiße ich die ganze Situation finde. Ich bin 21. Das ist das Alter, in dem man spätestens bei seinen Eltern auszieht und in die Welt hinaus geht. Zuerst wollte man mich in eine betreute WG schicken, aber dann hätte ich meinen kleinen Bruder erst in einem Jahr wiedergesehen. Deshalb habe ich schweren Herzens darum gebeten, hier wieder einziehen zu dürfen. So bin ich wenigstens in Caspers Nähe.
»Ich klopfe an und sehe nach, ob er da ist«, sagt sie resigniert, setzt sich in Bewegung und steigt die hölzernen Stufen zur Tür des Wohnwagens so vorsichtig hinauf, als würde sie befürchten, dass sie jeden Moment unter ihrem Gewicht zusammenbrechen.
Ich kann es ihr nicht verübeln. Seit ich weg war, hat sich offenbar niemand mehr darum geschert, den Trailer instand zu halten. Die Fenster sind blind vor Schmutz, die Camping-Stühle neben dem Eingang verwittert. Der Sonnenschirm liegt mit abgeknickten Speichen auf dem Rasen.
»Sie müssen sich keine Mühe machen«, sage ich, als auf Mrs Malcolms Klopfen hin niemand reagiert. »Machen Sie das Ding einfach hier draußen scharf und ich warte, bis jemand nach Hause kommt. Das bisschen Regen stört mich nicht.«
Ehrlich gesagt wäre es mir sogar lieber, wenn meine Anwältin und mein Dad sich nicht nochmal begegnen, denn schon bei meiner Verhandlung hat er mich bis auf die Knochen blamiert, weil er zu spät und im Unterhemd aufgetaucht ist.
Doch das Schicksal scheint beschlossen zu haben, mir nochmal zusätzlich auf die Nerven zu gehen. Denn schließlich sind im Inneren des Wohnwagens doch noch Schritte zu hören, dann öffnet sich die Tür, und da steht er.
Mein Vater, der große Ted Aldridge.
Früher war er mal Boxer und genau wie jemand, der mal Boxer war, sieht er auch aus. Seine Nase ist ein plattes Dreieck in seinem aufgedunsenen Gesicht, seine Stirn ist wulstig von zu vielen Platzwunden, die nicht richtig versorgt wurden. Sein graues Haar hat er schmierig nach hinten gekämmt und sein untersetzter Körper steckt auch heute in einem gelblich verfärbten Unterhemd.
Einen Moment lang mustert er Mrs Malcolm, als wäre sie eine Zeugin Jehovas. Dann erblickt er mich und sein Gesicht hellt sich auf. »Meine Kleine!« Mit ein paar schnellen, watschelnden Schritten schiebt er sich an meiner Anwältin vorbei, kommt zu mir nach unten und drückt mich an seinen massigen Körper.
»Hey«, erwidere ich und klopfe ihm auf die Schulter.
Unser Verhältnis ist nicht so toll, wie er gerade tut.
Das weiß er, das weiß ich. Nur dass ich es nicht für nötig halte, irgendwem etwas vorzumachen.
»Lass dich ansehen!« Dad mustert mich von oben bis unten. »Ist das zu glauben? Hätte nicht gedacht, dass ich dich in einem Stück wiederbekomme!«
»Ich war im Bootcamp, nicht im Schlachthaus«, gebe ich zurück.
Dad lacht schallend und deutet auf mich, als hätte ich den Witz des Jahrtausends gerissen. Ich halte die Luft an, um seine Fahne nicht riechen zu müssen. Dann scheint auch er endlich den Regen zu bemerken.
»Komm rein, kommt beide rein! Ihr holt euch ja den Tod!« Er stampft zurück in den Trailer und Mrs Malcom sieht mich mitfühlend an, ehe sie ihm folgt.
Ich blicke mich nochmal um. Immer noch kein Mensch zu sehen, dabei hätte ich zumindest mit meiner besten Freundin Raquel gerechnet. Aber andererseits: Woher hätte sie wissen sollen, wann ich komme?
»Jess? Legen wir los, ich habe noch andere Termine.«
Ich seufze und löse mich vom Anblick des verwaisten Parks.
Dann betrete ich den Wohnwagen.
Jess
»Die Fußfessel ist wasserdicht und stoßfest. Sie lässt sich nicht ohne Gewalt öffnen. In dem Band befindet sich ein Draht, der sofort Alarm schlägt, wenn es beschädigt wird. Der Sender teilt uns 24 Stunden am Tag mit, wo du dich aufhältst. Entfernst du dich aus dem erlaubten Radius, der den Wohnwagen sowie einen Umkreis von zehn Metern umfasst, wird auf der Stelle ein Streifenwagen losgeschickt. Ein einziger Verstoß reicht, um dich ins Gefängnis zu bringen. Hast du verstanden, Jessica?«
»Ja, Mrs Malcolm.«
»Der Richter will sehen, dass du dich mittlerweile an Regeln halten kannst – mit der Verlockung der Freiheit direkt vor deiner Nase. Im Grunde genommen ist das hier also ein Test. Aber wenn ich du wäre, würde ich versuchen, es als Chance zu sehen. Beweis dem Gericht, dass du ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft sein kannst. Kriegst du das hin?«
Ich nicke, auch wenn ich mir die dämliche Fessel am liebsten gleich wieder vom Bein reißen würde. Dass ich jetzt für die nächsten 12 Monate hier sitzen und die Füße stillhalten soll, fühlt sich an wie ein schlechter Scherz. Doch die Alternative zu einem Jahr Fußfessel sind 2 Jahre Knast, also habe ich noch Glück gehabt. Für das, was ich getan habe – ein führendes Investment-Unternehmen um eine Millionensumme erleichtern – hätte ich auch eine deutlich härtere Strafe bekommen können.
Mrs Malcolm mustert mich noch einen Moment prüfend, dann steht sie auf. Ich ziehe das Bein an und betrachte die Fessel genauer. Der Sender ist dick und total auffällig. In meinen DocMartens könnte ich ihn vielleicht verstecken, wenn ich sie offenlasse, aber …
Moment, Jess. Wozu willst du den Sender verstecken? Du wirst nur hier sein, wo ohnehin jeder weiß, dass du die Fessel trägst.
Ach ja.
»Wenn du noch Fragen hast: Morgen früh kommt dein Bewährungshelfer vorbei. Mit ihm kannst du alles Weitere besprechen.« Mrs Malcolm wendet sich meinem Dad zu und steckt schnell die Hände in ihre Jackentaschen, damit sie ihm zum Abschied nicht die Hand geben muss. »Mr Aldridge, passen Sie gut auf Ihre Tochter auf.«
»Ich passe immer auf meine Kleine auf!«
»Das will ich hoffen.« Meine Anwältin nickt ihm zu, dann nimmt sie die Tür ins Visier und verschwindet so schnell, als hätten wir Hunde auf sie gehetzt. Nur dass es hier keine Hunde gibt. Kakerlaken vielleicht.
Ich sehe mich um und mein Blick bleibt an dem schmutzigen Geschirr hängen, das sich in der Spüle stapelt.
»Was guckst du so?«, fragt Dad. »Ich hatte viel um die Ohren und dein Bruder macht keinen Finger krumm.«
»Geh aus dem Weg«, sage ich und stehe auf.
Es ist Mittag. Casper wird bald nach Hause kommen. Mal sehen, ob er sich doppelt freut, wenn nicht nur seine Schwester, sondern auch ein halbwegs sauberes Zuhause auf ihn wartet.
Während Dad mich noch ein bisschen darüber volljammert, wie hart das letzte Jahr für ihn gewesen ist, mache ich mich daran, die Teller und Töpfe zu spülen.
Irgendwann verschwindet Dad in sein Schlafzimmer, um den ersten Rausch des Tages auszuschlafen. Sein Handy, ein verbeultes Smartphone der ersten Generation, lässt er dabei auf dem Sideboard liegen, das die Küche vom Essbereich trennt.
Ich blicke ihm kurz nach, schnappe mir das Telefon und trage es zur Sitzecke, so vorsichtig, als wäre es der kostbarste Schatz aller Zeiten. Ich hatte seit Monaten kein elektronisches Gerät mehr in den Fingern. Im Camp war ich von allen Kursen ausgeschlossen, die mit Computern zu tun hatten. Und als ich eben einen Blick in mein Zimmer geworfen habe, musste ich feststellen, dass die Polizei meine PCs nicht wieder hergebracht hat. Das heißt, sie wurden nicht freigegeben und verrotten nun in irgendeiner Asservatenkammer. Scheint, als hätte ich mächtig Eindruck gemacht.
Klar, die Behörden müssen davon ausgehen, dass ich Investments of the North ganz allein ausgenommen habe. Obwohl sie mich fast 24 Stunden am Stück verhört haben, habe ich dichtgehalten, meine Gang nicht verraten. East nicht verraten.
Gern geschehen, Mistkerl.
Ich wische über das verschmierte Display, säubere es mit meinem Ärmel so weit, dass ich was darauf erkennen kann und tippe Raquels Nummer ein. Ich muss ihr unbedingt sagen, dass ich zu Hause bin.
Mit klopfendem Herzen lausche ich auf das Freizeichen, das ertönt, sobald ich auf Anrufen gedrückt habe. Es klingelt ein zweites Mal. Dann ein drittes Mal.
»Komm schon«, flüstere ich.
Nervös lausche ich auf das vierte, fünfte und sechste Klingeln. Aber niemand geht ran.
Na toll. Ich beende den Anruf und überlege, ob ich es bei einem der anderen Black Bones probieren könnte. Doch schnell fällt mir auf, dass ich die Nummern der anderen Gangmitglieder nicht auswendig kenne. Das heißt, alle bis auf eine.
Doch bevor ich East anrufe, friert eher die Hölle zu.
Sauer knalle ich das Telefon auf die Tischplatte. Noch immer kann ich nicht fassen, was er getan hat. Dass er mich hängengelassen hat, als ich ihn am meisten gebraucht hätte. Ich kneife die Augen zu und massiere meine Schläfen mit den Fingern, um die Kopfschmerzen loszuwerden, die mich immer überfallen, wenn ich an ihn denke.
Als ich Schritte auf der Treppe höre, befinde ich mich plötzlich wieder im Hier und Jetzt. Ich stehe auf, die Tür öffnet sich und ich sehe mich einem Teenager gegenüber.
Er überragt mich um einen halben Kopf und an seinen Armen wölben sich erste Muskeln.
»Cas?«, frage ich ungläubig. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er noch so klein.
Der Jugendliche, zu dem mein Bruder geworden ist, starrt mich überrascht an. »Keiner hat mir gesagt, dass du heute kommst!«
Ich schüttle den Kopf. Das wundert mich gar nicht. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Ohne ein weiteres Wort strecke ich die Arme aus und umarme meinen Bruder fest. Nach einem kurzen Zögern drückt er mich ebenfalls. Mit erstaunlich viel Kraft. Eine Wolke aus Männerdeo hüllt mich ein.
»Schön, dich zu sehen«, sage ich gerührter, als ich es von mir selbst erwartet hätte.
Dann ist aus dem Schlafzimmer Dads betrunkenes Schnarchen zu hören.
»Willkommen zu Hause, Schwesterherz«, erwidert mein kleiner Bruder.
Während meiner Abwesenheit hat er gelernt, sarkastisch zu sein.
Dane
»Tut mir leid, Süßer, aber hier ist Rauchen verboten«, schnurrt die Rothaarige von der anderen Seite der Theke.
Ich ziehe an meiner Zigarette und gebe ein höchstens halb interessiertes »Hm« von mir. Dabei starre ich weiter in ihr Dekolleté, das um einiges interessanter ist, als mich mit ihr zu unterhalten. Schwarze Spitze bedeckt ihre Brüste kaum zur Hälfte. Wenn sie sich noch ein bisschen weiter vorbeugt, kann ich ihre Nippel sehen, da bin ich mir ganz sicher.
»Ich meine es ernst. Wenn der Boss auftaucht und hier alles nach Qualm riecht, hast du ein Problem. Er meint, das schreckt die Kunden ab. Wenn sie hierher kommen, sollen sie an Sex und nicht an Lungenkrebs denken.«
Ich spüre selbst, wie ich zu schmunzeln anfange. Der Boss weiß wirklich, wo die Prioritäten der Besucher eines Tittenclubs liegen.
Das Lunaland befindet sich auf der East 8 Mile Road, wo sich Kentucky Fried Chicken mit Tankstellen und Sexclubs abwechselt. Anders als andere Läden hier auf der Straße können wir nicht mit einer Säulenauffahrt, einer Lasershow oder mit einem versilberten Vordach und einem Park-Service dienen.
Wir befinden uns im Keller eines Einkaufszentrums. Und genau das ist unser Vorteil. Das Lunaland ist von außen kaum als Erotik-Bar erkennbar. Sollte Mommy Daddy mal hier rauskommen sehen, kann er erzählen, dass er nur schnell eine Tüte Milch und ein paar Socken kaufen war. Zu uns kommen Männer, die es sich nicht leisten können, dabei gesehen zu werden, wie sie fremden Frauen auf die Brüste glotzen.
Genau aus diesem Grund bin ich hier momentan Concierge.
Und da ich ebenso wenig wie der Boss will, dass die Kunden beim Reinkommen Qualm anstelle von Frauenparfum riechen und gleich rückwärts wieder rausgehen, drücke ich meine Kippe unter dem Tresen aus.
Ich lasse sie im Papierkorb verschwinden und fange mir dafür schon den zweiten vorwurfsvollen Blick von der Rothaarigen ein.
»Die musst du draußen wegwerfen, Süßer.«
»Ich wäre ein Idiot, jetzt rauszugehen«, erwidere ich und begutachte lieber nochmal ihre vollen Brüste.
Sie lacht ein perfekt einstudiertes Lachen. »Lad mich in die Private Lounge ein und du darfst sie mal anfassen.«
»Anfassen ist genauso verboten wie Rauchen.«
»Für dich würde ich eine Ausnahme machen.« Die Rothaarige drückt sich selbst einen Kuss auf den Zeigefinger und streicht mir damit über die Wange, dann steht sie auf. »Meine Pause ist vorbei. Überleg’s dir.«
Sie wirft mir ein verführerisches Lächeln zu, wendet sich ab und verschwindet mit schwingenden Hüften durch den roten Samtvorhang, der vom Eingangsbereich in den Club führt.
Ich versuche, einen Blick ins Innere zu erhaschen. Nachdem sie mich so heiß gemacht hat, hätte ich Lust auf ein bisschen nackte Haut.
Doch außer dem dicken Teppichboden, ein paar Schemen und jeder Menge Nebel kann ich nichts erkennen. Anscheinend zieht eines der Mädchen im Augenblick eine Tanzshow ab.
Gerade will ich meinen Platz hinter der Theke verlassen, um mir die Sache genauer anzusehen, als sich die Glastür erneut öffnet und sich ein Typ um die fünfzig zu uns ins Foyer schiebt, den ich auf Anhieb erkenne.
Glatze, randlose Brille und ein schmallippiges Gesicht, das aussieht, als würde er permanent in eine Zitrone beißen. Mister Larry Goldman – genau der Kerl, auf den ich gewartet habe.
Ich straffe die Schultern und setze mein freundlichstes Gesicht auf, während Goldman auf die Rezeption zukommt, seinen Spazierstock schwingend, als ob er ihn mir am liebsten direkt in die Fresse schlagen wollte.
»Mistwetter heute«, begrüßt er mich unfreundlich.
»Da gebe ich Ihnen Recht, Sir«, erwidere ich mit perfekt gespielter Unterwürfigkeit in der Stimme. Dabei strecke ich die Hand aus. »Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen?«
Goldman macht keine Anstalten, mir eine Antwort zu geben. Stattdessen mustert er mich von oben bis unten. »Neu hier?«
»Nein, Sir. Ich war nur die letzten vier Wochen krankgeschrieben«, erkläre ich, auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Genaugenommen arbeite ich erst seit vier Tagen hier.
»Was Ansteckendes?«, will er wissen und betrachtet mich immer noch, jetzt allerdings, als wäre ich ein Exponat in einer Freakshow.
»Nein, Sir.«
Er nickt und lässt sich endlich dazu herab, seinen dämlichen Mantel auszuziehen. Ich nehme ihm den Trenchcoat ab, bedanke mich höflich und füge hinzu: »Sie wissen ja, dass ich Sie auch um Ihre Kreditkarte bitten muss.«
Weil sich ein paar frühere Kunden durch die Hintertür abgesetzt haben, ohne zu bezahlen, hat der Besitzer des Lunaland diese Praxis als Sicherheit eingeführt.
»Aber sicher.« Goldman greift in sein Portemonnaie und hält mir seine goldene AmEx hin. Ziemlich protzig für einen Mann mit seinem Job. »Schön vorsichtig damit sein.«
»Natürlich«, gebe ich gelassen zurück und würde ihm für seine Arroganz mit seiner American Express am liebsten ein schönes Glasgow Smile in die Visage ritzen, von einem bis zum anderen Ohr.
Stattdessen greife ich nach einem weichen Tuch und poliere die Karte, während ich mit einem Lächeln hinzufüge: »Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Sir.«
»Natürlich tun Sie das. Schließlich hängt Ihr Gehalt davon ab.«
Mit einer süffisanten Grimasse steuert Goldman auf den Vorhang zu. Ich lasse ihm noch 5 Sekunden Vorfreude und zücke mein Handy.
4 Sekunden …
Ich mache ein Foto seiner Karte.
3 Sekunden …
Er greift nach dem Vorhang.
2 …
Ich schalte die Kamerafunktion meines Handys ein.
1.
Goldman zieht den Vorhang auf.
»Oh, Mister Goldman?«
Verärgert blickt er über die Schulter zu mir zurück. Dann wird sein Gesichtsausdruck irritiert, als er das Smartphone in meiner Hand sieht.
»Was soll das?«
»Ich fürchte, ich muss das hier an Ihre Frau schicken.« Wie immer ist Recherche alles. Also füge ich an: »Rosalie wird sicher furchtbar enttäuscht sein, dass Sie schon wieder rückfällig geworden sind.«
Während ich rede, lasse ich die Kamera über den Lunaland-Schriftzug und die Malereien daneben schweifen. Sie zeigen ein paar unserer Mädchen in eindeutigen Posen.
Dann fange ich wieder Goldmans Gesicht ein.
»Und was würde Ihr Chef erst dazu sagen? Ein Bewährungshelfer, der sich in Rotlicht-Clubs auf der 8 Mile rumtreibt? Wenn ich mich nicht irre, arbeitet eine Ihrer Schützlinge hier. Ist es in Ordnung, dass Sie der Kleinen regelmäßig zwischen die Schenkel schauen? Gehört das zum Job dazu?«
Langsam lässt Goldman den schweren Vorhang wieder zufallen. Schlagartig dringt die Musik aus dem Club nur noch gedämpft in den Empfangsbereich.
»Was wollen Sie?«
»Ich möchte Ihnen ein bisschen Arbeit abnehmen, das ist alles.«
Goldmans Brauen ziehen sich zusammen und er presst die Lippen aufeinander. Seine Gesichtsfarbe, die während meiner Worte immer weißer geworden ist, wechselt nun in ein sattes Rot. »Was soll das heißen?«, schnaubt er.
Ich grinse ihn an und erkläre ihm, wie es laufen wird.
Jess
Der nächste Morgen beginnt neblig. Nach dem Regen gestern scheint es heute ein warmer Tag zu werden. Die Sonne lässt feinen Dunst aus den Wiesen und von dem schmalen Kanal aufsteigen, an dem unser Trailer Park liegt.
Ich sitze auf einer der Treppen, die vom Ufer aus steil ins Wasser führen. Obwohl unser Wohnwagen nicht in der ersten Reihe liegt, reicht der Radius meiner Fußfessel bis hier. Die Grundstücke sind winzig und direkt am Kanal stehen fast alle Trailer leer. Die Feuchtigkeit hat sie schimmeln lassen. Ein paar Boote liegen unten im Wasser, die meisten sehen unbrauchbar aus. In einem davon tummeln sich Frösche. Ich beobachte sie eine Weile, doch ablenken können sie mich auch nicht. Ich bin unruhig.
Es war komisch, plötzlich wieder allein in einem Zimmer zu schlafen. Es ist auch seltsam, nicht mehr von der Sirene geweckt zu werden, und den Morgen nicht mehr mit einem Zwei-Meilen-Lauf zu beginnen.
»Hey.« Ein neonfarbenes Paar Turnschuhe erscheint auf der Treppe und ich nehme schnell meine Kaffeetasse weg, damit Cas sie nicht umtritt.
Er setzt sich neben mich und hat anstelle von Kaffee einen Energydrink dabei, um wach zu werden.
»Das Zeug ist ungesund«, sage ich. »Es macht dein Herz kaputt. Und deine Nieren.«
»Ja, ja« erwidert mein Bruder und greift in seinen Rucksack. »Für dich habe ich deshalb auch deine Hackerbrause besorgt.« Damit hält er mir eine Flasche Mountain Dew Code Red hin.
Überrascht sehe ich auf. Das war mein Lieblingsgetränk, wenn ich früher ganze Nächte vor dem PC verbracht habe. Cas wusste immer, was ich tue. Dad nicht. Wofür ich verhaftet wurde, hat er glaube ich bis heute nicht wirklich kapiert.
»Danke«, sage ich, nehme ihm die Flasche ab, drehe sie auf und lasse mir Zeit. Ich schließe die Augen und rieche erstmal an dem süßen Soda.
Cas gibt ein schnaubendes Lachen von sich. »Trinken, nicht schnupfen.«
»Im Camp gab es sowas nicht.« Ich gönne mir einen ersten kleinen Schluck. Der Kirschgeschmack ist unglaublich. Kein teurer Rotwein auf der ganzen Welt könnte besser sein.
»Das Essen war wohl auch scheiße, so wie du gestern reingehauen hast.«
Weil Dad nicht mehr aus dem Schlafzimmer gekommen ist, ist mein Bruder irgendwann mit dem Fahrrad losgefahren und hat riesige Burger für uns besorgt. Mit Chili con Carne und Extrakäse drauf, so wie ich es am liebsten mag. Vermutlich ist das seine Art, mir zu zeigen, dass er sich über meine Rückkehr freut. Geld aus der Haushaltskasse konnte er dafür nicht nehmen. Sie war leer.
»Arbeitet Dad im Moment?«, frage ich. Manchmal kommt er in einer Fabrik am Fließband unter, zumindest für ein paar Wochen. Immer so lange, bis seine Trinkerei auffällt und er rausfliegt.
»M-hm. Als Flachwichser.« Cas kramt in seinem Rucksack und ich sehe ihn fragend an.
»Habt ihr Probleme?«
»Nein, passt schon.« Er zieht eine zerknitterte Schachtel Zigaretten heraus und schiebt sich eine zwischen die Lippen.
Verärgert nehme ich sie ihm weg. »Seit wann rauchst du?«
Cas blickt verwundert zu mir herüber. »Was spielt das für ’ne Rolle?«
»Hast du vergessen, woran Mom gestorben ist? Willst du auch so enden wie sie?«
Im Blick meines Bruders erscheint Spott. Noch so ein Ausdruck, den ich früher nie an ihm gesehen habe. »Nicht jeder, der raucht, bekommt Krebs, Jess. Es stürzt ja auch nicht jeder ab, der in ein Flugzeug steigt.«
Damit will er mir die Zigarette abnehmen, aber ich werfe sie kurzerhand in den Kanal.
Ungläubig blickt Cas ihr hinterher.
»Ich will nicht, dass du rauchst.«
Wieder fixiert mein Bruder mich, urplötzlich wirkt er sauer. »Was soll das, spielst du jetzt neuerdings die Mutter?«
»Cas …«
»Ist ein bisschen komisch, wenn jemand, der frisch aus dem Bootcamp kommt und ’ne elektronische Fußfessel trägt, auf Moralapostel macht, findest du nicht?«
Ich versuche, ruhig zu bleiben. »Ich will doch nur nicht, dass du endest wie unsere Eltern. Wie keiner von ihnen. Und auch nicht …«
»Weißt du was, Jess?« Mein Bruder lässt mich nicht ausreden. »Fick dich selbst und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß!« Ganz unvermittelt schlägt er mir die Flasche aus der Hand, sodass sie ebenfalls im Wasser landet. »Gern geschehen.« Damit schnappt er sich seinen Rucksack, steht auf und verschwindet zwischen den Wohnwagen.
Ich blicke ihm nach und atme tief durch. Am liebsten würde ich ihm hinterherlaufen und ihn fragen, was der Mist soll. Aber ich weiß, dass das nichts nützen würde.
Er ist enttäuscht von mir. Und ich kann es ihm eigentlich noch nicht mal übelnehmen.
Ich habe ihn im Stich gelassen, wenn auch nicht extra. Seit Moms Tod war ich immer seine wichtigste Bezugsperson. Das ganze letzte Jahr über hatte er niemanden. Kein Wunder, dass er wütend ist.
»Ich werde nochmal ein Auge zudrücken«, reißt mich eine Stimme aus meinen Gedanken.
Ich schrecke zusammen und sehe mich hastig um. Zuerst glaube ich, dass es Dad ist, dann jedoch tritt ein Typ aus den Nebelfetzen, der deutlich jünger ist als mein Vater. Und den ich im Leben noch nie gesehen habe – das ist mir gleich klar, denn jemanden wie ihn hätte ich mir gemerkt.
»Jessica Aldridge?«, fragt er mit einer dunklen, samtigen Stimme.
Ich mustere ihn misstrauisch. Er trägt eine schwarze Bomberjacke, darunter ein weißes, körperbetontes Shirt. Seine Jeans wirken teuer, sein Haar ist schwarz, kurz und ein wenig gegelt und sein gepflegter Bart ist eher fünf als drei Tage alt.
»Wer will das wissen?«, frage ich und stehe auf.
Der Fremde kommt näher, bleibt an der obersten Stufe stehen und hält mir die Hand hin. »Larry Goldman. Ihr Bewährungshelfer.«
Oh, Shit.
Der Streit mit meinem Bruder macht ja einen tollen ersten Eindruck. Er hätte das nicht mitkriegen dürfen. Wenn ich in Goldmans Augen etwas falsch mache, lande ich ganz schnell hinter Gittern.
Ich eile die Stufen hinauf und schüttle seine Hand. Ich bemühe mich um einen festen Händedruck, doch mein Anblick muss alles andere als souverän wirken: Ich trage nichts außer einem riesigen schwarzen Hoodie. So früh am Morgen hatte ich nun nicht mit meinem Bewährungshelfer gerechnet.
Goldman drückt meine Hand, seine Finger fühlen sich warm und angenehm an. Aber seine nächsten Worte sorgen dafür, dass ich mich trotzdem unwohl fühle. »Das ist Umweltverschmutzung«, sagt er und deutet runter auf den Kanal. »Da Sie vorbestraft sind, kann Ihnen das zwei Jahre einbringen.«
»Blödsinn«, höre ich mich selbst sagen. »Doch nicht wegen …«
Mein neuer Bewährungshelfer sieht mich an und zieht eine Braue in die Höhe. »Ich glaube nicht, dass Sie in der Position sind, mir zu widersprechen, Miss Aldridge.«
Ich erwidere seinen Blick und schlucke den Rest meines Satzes herunter. Er hat Recht. Natürlich sollte ich mit ihm keine Diskussion anfangen.
»Tut mir leid«, sage ich.
»Das hoffe ich«, erwidert Goldman, wobei mir ein leicht amüsiertes Funkeln in seinen Augen nicht entgeht.
Anscheinend gefällt es ihm, mich zur Schnecke zu machen.
Erst jetzt lässt er meine Finger los und drückt mir eine Visitenkarte in die Hand, auf der ich seine Handynummer vorfinde.
»Hier, für Notfälle«, erklärt er und mustert mich dabei von oben bis unten. »Kaum ist man aus dem Camp zurück, war es das mit der Disziplin, was?«
Obwohl ich eigentlich gar nicht der Typ dafür bin, spüre ich, wie meine Wangen zu glühen beginnen, und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich mir dank seines Kommentars wie eine faule Schlampe vorkomme. Der zweite Grund ist, dass ich immer noch halbnackt bin. Und der dritte: Meine Beine sind unrasiert und sehen pelzig aus. Im Camp waren Ladyshaves verboten.
Ich räuspere mich. »Ich bin seit sieben auf.«
»Jetzt ist es …« Er sieht auf die massive schwarze Uhr an seinem Handgelenk. »Fast acht. Was haben Sie die ganze Stunde über getrieben?«
»Hier gesessen und Kaffee getrunken.« Oh Mann. Ist es so schlimm, an seinem ersten Tag in Freiheit einfach mal die Ruhe zu genießen?
Goldman mustert mich und zieht die dunklen Brauen zusammen. Mir fällt auf, dass er einen guten Kopf größer ist als ich. Doch es ist nicht seine Körpergröße, die mich einschüchtert – eher seine Art. Jeder Blick von ihm scheint zu sagen: Ein Fehler und ich loche dich ein.
»Haben Sie ein Handy?«, fragt er.
»Nein«, erwidere ich schnell. Er soll bloß nicht glauben, dass ich direkt wieder mit dem Hacken anfange. »Ich habe nur dagesessen.«
Goldman mustert mich noch einen Moment kritisch, dann scheint er einen Entschluss zu fassen und nickt. »Okay, also müssen wir Ihnen schnellstens eines besorgen.«
Misstrauisch blicke ich ihn an. Wenn überhaupt, hätte ich erwartet, dass ich das nächste Jahr über ein komplettes Medienverbot bekomme. Oder dass ich in eine Selbsthilfegruppe für Hacker geschickt werde, in der ich Schritt für Schritt lerne, mich im normalen Netz zu bewegen, ohne dabei ins Deep Web oder Darknet abzurutschen.
»Ich bekomme ein Handy?«, frage ich.
»Sicher. Ich muss Sie schließlich erreichen können.« Goldman lächelt dünn und ich stelle fest, dass er für einen Bewährungshelfer ziemlich attraktiv ist.
Irgendwie hätte ich mit einem langhaarigen Hippie im Strickpullover gerechnet. Stattdessen steht ein Armani-Model vor mir.
»Was ist?«, fragt Goldman und verschränkt die Arme, was seinen Bizeps unter der dünnen Jacke deutlich hervortreten lässt. »Wollen Sie mich nicht mit Fragen löchern, Miss Aldridge? Ich bin Ihr Bewährungshelfer. Ich bin für Sie da.«
»Nein, keine Fragen«, erwidere ich.
»Gut. Wollen Sie mir Ihren Vormund vorstellen?«
Ich verziehe das Gesicht. »Meinen Vater? Ich fürchte, er ist noch nicht wach.«
Missbilligend blickt Goldman hinüber zu unserem rostigen Trailer und mir fällt auf, wie wenig er hierher passt. Als hätte man einen Panther auf einer Müllkippe ausgesetzt. »Ich frage mich, wer sich diesen Unsinn ausgedacht hat«, sagt er schließlich. »Ihr Vater hat offenbar nicht mal sein eigenes Leben im Griff, wie soll er sich um Ihres kümmern? Wenn so ein Mann Ihr Vormund ist, sitzen Sie in einem Jahr mit Lockenwicklern und Tränensäcken im Trailer gegenüber und haben einen Kerl geheiratet, der Sie verprügelt, wenn ihm die Farbe seines Frühstückseis nicht gefällt.
»Keine Sorge«, gebe ich zurück. »Ich kann ganz gut auf mich aufpassen.«
»Ach, können Sie das?« Goldman wendet sich wieder mir zu und sieht mir tief in die Augen. »Ich sage Ihnen was, Jessica. Sie sind erwischt worden. Also sollten Sie eines verdammt nochmal nicht tun: sich überschätzen. Vertrauen Sie mir, nicht sich. Dann haben Sie kein Problem. Geht das in Ihren hübschen Kopf?«
So langsam geht mir seine herablassende Art echt auf die Nerven. »Mein hübscher Kopf«, sage ich und funkle ihn an, »hat das Sicherheitssystem eines Investment-Unternehmens lahmgelegt und unbeschadet zwölf Monate Bootcamp überstanden.«
»Pschscht«, macht Goldman, kommt näher und schüttelt langsam den Kopf. »Nicht aufregen, Jessica. Sie sollten wissen, dass Sie mir gegenüber niemals ausfällig werden dürfen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, raus aus diesem Elend zu kommen. Das wollen Sie doch, oder?« Er tritt noch einen Schritt dichter an mich heran.
So dicht, dass ich den männlich-herben Duft seines Aftershaves riechen kann und für einen Moment Probleme habe, mich zu konzentrieren. Ein Jahr Camp bedeutet eben auch ein Jahr, ohne einem Mann auch nur nahe zu kommen. Außer den Wachen natürlich, aber diese Sadisten fand ich nicht mal ansatzweise anziehend. Dass mich jetzt ausgerechnet mein Bewährungshelfer aus dem Konzept bringt, ist allerdings mehr als falsch.
»Natürlich will ich das«, sage ich schließlich und zwinge mich, ihn anzusehen.
Er nickt. »Das haben Sie damals auch bei der Polizei ausgesagt. Mit Ihrem Honorar für den Betrug wollten Sie Ihrem Bruder und sich ein besseres Leben ermöglichen.«
»Das war die Wahrheit«, gebe ich zu. »Ich wollte eine Wohnung und das Sorgerecht für ihn, sobald ich volljährig bin. Und ich wollte was fürs College sparen.«
»Für ihn, nicht für sich.«
Ich nicke. Was soll ich am College? Ich war schon auf der Schule hoffnungslos unterfordert.
»Sie haben immer noch die Chance dazu«, sagt Goldman. »Aber nicht, wenn Sie hier herumsitzen und Kaffee trinken. Gehen Sie rein. Schreiben Sie ein paar Bewerbungen.«
Ich lache humorlos. »Per Hand? Auf Klopapier? Oder wie stellen Sie sich das vor? Ich habe nichts hier, womit ich Bewerbungen schreiben könnte, und ich kann auch nichts kaufen.«
»Widersprechen Sie mir nicht schon wieder, Miss Aldridge. Gehen Sie rein und schreiben Sie Bewerbungen. Sie werden schon sehen.« Noch einen Moment lang betrachtet er mich, als wäre er sich nicht sicher, was er von mir halten soll. Dann sagt er: »Ich komme in ein paar Tagen wieder und kontrolliere Ihre Fortschritte.«
Damit macht er auf dem Absatz kehrt und lässt mich stehen.
Ich blicke ihm nach, bis er hinter dem nächsten Wohnwagen verschwunden ist. Dann löse ich mich von meinem Platz auf dem Rasen und gehe rein, ganz wie er es von mir wollte.
Sicher ist das ein Test. Vermutlich bleibt er in Sichtweite zum Trailer stehen, um zu kontrollieren, ob das Camp mich brav und gefällig gemacht hat.
Noch immer leicht verwirrt von diesem Treffen, gehe ich zu meinem Zimmer. Ich trete ein – und entdecke etwas, das auf der Stelle meinen ganzen Körper vor Freude kribbeln lässt.
Auf meinem leergeräumten Schreibtisch stehen ein noch verpackter Laptop und ein kleiner Karton mit einem Internetstick. Das sollte also dieses seltsame Verhalten, als Goldman mich zum Bewerbungen schreiben schickte!
Ich eile zum Schreibtisch und spüre selber, dass ich strahle wie ein Idiot, als ich die Verpackung des Notebooks aufreiße. Etwas in mir erwacht, das besser unter Verschluss bleiben sollte.
Trotzdem kann ich die leise Stimme nicht ignorieren, die ich in meinem Kopf flüstern höre, als ich auf den Startknopf drücke: A.J. ist wieder da.
Kapitel 2
‚I don’t care‘
East
»Komm schon. Wir sind gleich fertig.«
Ich höre die Stimme kaum, sie klingt wie aus weiter Ferne, wie aus einem anderen Zimmer. Das mag daran liegen, dass ich mich gerade komplett auf etwas anderes konzentriere: den Videostream auf meinem Tablet.
Die Bilder werden live und in Echtzeit an mich gesendet, aufgenommen von der Webcam in Jess’ neuem Laptop. Woher sie so schnell wieder einen Computer hat, ist mir ein Rätsel. Soll mir aber auch egal sein. Als ich heute Mittag zu ihr gefahren bin und einen Blick durch ihr Fenster geworfen habe, saß sie jedenfalls auf dem Bett und war völlig in irgendetwas auf dem Monitor vertieft.
Ich habe sie minutenlang beobachtet, habe versucht zu erkennen, was das Camp aus ihr gemacht hat. Die alte Jess kann sie nicht mehr sein, so viel steht fest. Wäre sie noch meine Jess, hätte sie sich auf der Stelle das Handy ihres Alten oder ihres Bruders geschnappt und mich angerufen.
Aber wer ist sie dann?
Ich zoome ihr Gesicht näher heran.
»East! Halt still!«
Entnervt sehe ich runter zu Leroy, meinem Tätowierer. »Was willst du eigentlich von mir?«
Leroy, der auf einem Drehhocker neben mir sitzt, deutet ziemlich sauer auf meine Leiste. »Was ich von dir will? Dass du aufhörst, herumzuzappeln! Ich mache gerade die Schattierungen, falls du’s noch nicht gemerkt hast. Wenn du nicht willst, dass das Motiv am Ende aussieht wie ’ne überfahrene Kröte, musst du schon mitarbeiten!«
»Wenn das Motiv am Ende aussieht wie ’ne überfahrene Kröte, zünd ich deinen Laden an und zahl dir keinen Cent, also gib dir gefälligst Mühe.«
Leroy macht ein Geräusch, als hätte ich mich soeben für die Sklaverei ausgesprochen. »Im Ernst, East, du warst auch schon mal besser drauf.« Er schüttelt den Kopf und sticht weiter.
Eigentlich soll er mir ein menschliches Herz stechen und keine Kröte, wobei das Motiv eigentlich zweitrangig ist. Viel wichtiger ist, was es überdeckt.
Außerdem kann ich den Schmerz gerade gut gebrauchen. Er macht mich wach. Katapultiert mich für ein paar Stunden in die echte Welt. Lässt mich klar denken. Solange ich meine Ausflüge in die Realität selbst steuern kann, geht es halbwegs. Aber der Rest der Zeit ist das reinste Chaos, bestehend aus Alkohol, Sex und viel zu vielen Stunden, in denen ich einfach nur dasitze und darüber nachdenke, wie zur Hölle mein Leben dermaßen außer Kontrolle geraten konnte.
Ich hatte immer alles im Griff. Das ist das Geheimnis, wenn du so lebst wie ich: Verliere nicht die Kontrolle. Doch genau das habe ich getan und niemand Geringeres als Jess ist daran schuld.
Jess. Warum lässt mich diese Frau nicht los? Sie und das, was aus ihr geworden ist. Oder was sie vielleicht insgeheim schon immer war.
Ich zoome sie noch näher heran, sehe in ihre Augen und versuche, irgendetwas darin zu erkennen. Aber ihr Blick ist vollkommen undurchdringlich.
Sie hat mich immer noch nicht bemerkt. Wie auch? Ein Trojaner sorgt dafür, dass die LED-Lampe der Webcam nicht leuchtet.
Ihr Anblick erinnert mich an früher. Diesen konzentrierten Blick hatte sie immer drauf, wenn sie dabei war, sich ganz tief in ein eigentlich unzugängliches System zu hacken. Ein Funke Hoffnung keimt in mir auf und ich wechsle in ein anderes Tab, eines, das mithilfe des Trojaners zeigt, was sie treibt.
Vorhin hat sie sich die News der vergangenen Monate angesehen. Mittlerweile ist sie dazu übergegangen, Raquel über Instagramzu stalken. Es ist fast schon lustig. Die berühmte A.J. surft im Netz herum wie ein gewöhnliches Mädchen.
Scheiße. Und dabei war sie so gut.
Der Name A.J. taucht zum ersten Mal in der Detroiter Hackerszene auf, als ich schon längst die Black Bones gegründet hatte. Während drüben in Kanada die Eishockey-Meisterschaften liefen, sorgte A.J. dafür, dass einen halben Tag lang im gesamten Süden des Landes nur Schnee über die Fernsehbildschirme flimmerte. Tatsächlicher Schnee. Aufnahmen von idyllischen kanadischen Landschaften. Die Leute dort drüben wurden irre. Mir gefiel die Aktion und ich heftete mich an A.J.s Fersen.
Nie im Leben hätte ich erwartet, dass eine Frau dahintersteckt. Dass ich mich in sie verlieben würde. Und dass aus dieser Liebe einmal Hass werden würde.
Ich sehe mich auf ihrer Festplatte um und stelle fest, dass sie leer ist.
Unbeschrieben. Bedeutungslos.
Als wäre Jessica einfach ausgelöscht worden.
Für immer.
Ich lege das Tablet zur Seite, lehne mich auf dem Tätowierstuhl zurück und schließe die Augen.
Eine beschissene Idee, denn wie jedes Mal überfallen mich auch jetzt die alten Bilder aus der Zeit, als Jess noch eine von uns war.
Ich holte sie in die Gang, kurz nachdem ich sie kennengelernt hatte. Alles, was sie übers Hacken noch nicht wusste, brachte ich ihr bei. Terra und Cyph, meine beiden anderen Hacker, waren schon Mitglieder der Bones, aber keiner von ihnen war so gut wie sie. Gemeinsam kamen wir überall rein und überall ungesehen wieder raus. Wir hackten uns in Schließfächer und Firmenkonten, niemand konnte uns aufhalten. Und egal, wen wir ausraubten, Jess hatte nie irgendwelche Skrupel.
Sie sah die ganze Sache wie ich: Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, versteck es unter deinem Kopfkissen. Tust du’s nicht, stehlen wir es.
Sie kam aus der Gosse, ich aus einer anderen Art von Ghetto. Von einem Ort, an dem zwar keine finanzielle Armut herrschte, an dem aber trotzdem das Wesentliche fehlte.
Wir nahmen uns, was uns zustand. Wir machten uns einen Namen, bezogen über das Darknet immer größere Aufträge und bekamen am Ende genug Geld raus, um tun und lassen zu können, was wir wollten. Wir waren absolut frei und doch hatte jeder von uns jemanden, zu dem er gehörte. Die Gang, klar. Aber vor allem hatte Jess mich und ich sie.
Das mit uns war mehr als Liebe. Ich wusste damals kein Wort, um es zu beschreiben und jetzt, wo es vorbei ist, fällt mir erst recht keines mehr ein.
»So. Nulllinie«, reißt mich Leroy aus meinen Erinnerungen.
Ich öffne die Augen und sehe zu ihm herunter. »Was?«
Er grinst schief. »Herzstillstand, mein Freund. Flatline. Ich bin fertig.«
Damit richtet er einen Spiegel auf das frische Tattoo, das sich mitten auf meinem V-Muskel befindet. Ich sehe es mir an, betrachte die feinen schwarzen Linien, die noch nicht mit Folie überklebt sind. Doch meine Aufmerksamkeit gilt in diesem Moment etwas anderem. Dem, was Leroy gerade gesagt hat.
Flatline.
Das ist ein Begriff aus der Hackerszene, den man benutzt, wenn eine Maschine kaputt ist. Zerstört. Nicht mehr funktionsfähig.
Vielleicht beschreibt dieses Wort perfekt, was mit Jess und mir passiert ist.
Ich nicke, setze mich auf und klopfe Leroy auf die Schulter. »Na, siehst du? Kein Grund für ein verspätetes Osterfeuer.«
Leroy zeigt mir den erhobenen Daumen, dann sieht er mir zu, wie ich das Tablet ausschalte.
»Die Kleine ist draußen?«, fragt er.
»Nein«, sage ich. »Das, was von ihr übrig ist.«
Damit stehe ich auf, bezahle Leroy für seine Arbeit und verlasse das Studio, ohne aufzuhören, an Jess zu denken.
Was immer sie jetzt ist, was immer sie mit ihrem Leben noch vorhat, eines steht fest: Sie sollte besser einen verdammt großen Bogen um mich machen.
Jess
Ich werfe der Falttür, die mein Zimmer vom Rest des Wohnwagens trennt, einen finsteren Blick zu. Das Ding schafft es einfach nicht, die Stimmen von Dad und seinen Kumpels draußen zu halten. Lautstark debattieren sie über irgendeinen Unsinn. Stammtischparolen. Oder noch eine Stufe darunter.
Seit ich aus dem Camp zurück bin, fällt mir immer mehr auf, wie ungeregelt der Alltag hier abläuft, wie jeder nur so vor sich hinlebt.
Casper ist seit heute Morgen weg. Sein Zimmer, das gegenüber von meinem liegt, ist leer, aber niemand scheint sich darüber zu wundern. Mittlerweile ist es sechs Uhr abends. Dad hat seit heute Mittag versprochen, sich um das Essen zu kümmern. Aber bisher ist es bei dem Versprechen geblieben. Mein Magen knurrt und wenn das so weiter geht, werde ich gegen meine Auflagen verstoßen müssen, um hier nicht zu verhungern. Mein Körper hat sich an die festen Essenszeiten gewöhnt, deshalb ist mir schwindelig.
Wohl oder übel löse ich mich von meinem Platz vor dem Laptop.
Meinem Geschenk des Himmels.
Zuerst hatte ich keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Mit den News? Den sozialen Netzwerken? Mit einem Mal hatte ich Zugang zu so vielen Informationen, die mir ein Jahr verwehrt geblieben waren, dass ich gar nicht wusste, wo mir der Kopf stand.
Dann habe ich Raquel gegoogelt.
Wie alle Bones ist sie im Netz nicht unter ihrem richtigen Namen unterwegs, doch im Gegensatz zu uns liebt sie es, sich online in Szene zu setzen. Unter dem Namen RacyRaq betreibt sie einen Instagram-Account, den sie regelmäßig mit Fotos füttert. Ich rufe ihn über den Laptop auf und sehe mir ein paar der Bilder an. Auf den meisten trägt sie knappe, grelle Outfits und hat ihre langen schwarzen Rastazöpfe zu kunstvollen Frisuren hochgesteckt. Ihr Geschmack war schon immer speziell. Als wir uns auf der Highschool kennengelernt haben, hielt ich sie für eine Raverin. Doch schnell stellte sich heraus, dass wir denselben Musikgeschmack und auch sonst einiges gemeinsam hatten. Wir waren die Trailer-Park-Prinzessinnen der Klasse. Die einzigen beiden, deren Eltern sich kein vernünftiges Haus leisten konnten. Das hat uns zusammengeschweißt.
Da mein Account damals lahmgelegt wurde, lege ich mir kurzerhand einen neuen zu und schicke Raquel eine kurze Nachricht:
Hey, ich bin’s. Lass dich mal bei mir blicken, ich bin frei :)
Eine Weile stöbere ich noch auf ihrem Profil, kann aber nichts Spannendes finden – bis ich in ihrer Bio auf ihren Beziehungsstatus stoße.
Seit dem 5. August im letzten Jahr ist sie vergeben. Da war ich seit zwei Monaten im Camp. Hier steht allerdings nicht, an wen. Ich durchstöbere erneut ihre Galerie, kann aber auf keinem Foto einen Mann entdecken. Ich bin gespannt, wer ihr geheimnisvoller Verehrer ist.
Ich habe einfach so viel verpasst.
Seufzend klappe ich den Laptop zu und ziehe die Falttür auf.
»… nicht mehr sicher auf den Straßen!«, dringt mir Dads Stimme entgegen. Weiter höre ich nicht zu, denn ich möchte gar nicht wissen, welche Minderheit seiner Meinung nach nun wieder den Frieden des Landes bedroht. Zuletzt hatte er es auf Transgender abgesehen. Davor, als ein Kirchenskandal die Medien überflutet hatte, war er dafür, alle Priester und Pfarrer des Landes zu verweisen.
Ich blende sein haltloses Gezeter aus und werfe einen Blick in den Kühlschrank. Wir haben Eier, Coke, Bier … noch eine Packung Eier, Joghurt und eine angebrochene Salami. Ich öffne die Schränke, kann aber keine Nudeln finden. Dafür ein Toastbrot.
Immerhin.
Ich schmeiße den Herd an und beginne die Eier aufzuschlagen. Cas liebt Rührei, also werde ich eine Portion für ihn mit machen. Während ich hin und wieder das Ei umrühre, schneide ich dicke Scheiben Salami ab und lege sie auf das Toastbrot.
Dafür, dass wir nicht viel im Haus haben, ist es ein ganz passables Mahl.
Ich schaufle mir die Hälfte des Eis auf den Teller und decke die andere für Casper ab.
»Wann kommt Cas nach Hause?«, frage ich auf dem Weg zurück in mein Zimmer.
Dad sieht mich so irritiert an, als hätte ich nach dem Messias gefragt.
»Cas. Casper, dein Sohn. Mein Bruder. Wo ist er?«
»Ich weiß, wer Casper ist«, gibt Dad lediglich zurück. Seine Augen sind glasig.
Und auch seine Kumpels sehen nicht viel frischer aus.
»Und? Wo steckt er?«
»Schule?« Dad zuckt mit den Schultern.
»Wohl kaum. Es ist schon Abend.« Ich versuche, ruhig zu bleiben. Ich will mich weder aufregen noch streiten. Das hat noch nie etwas gebracht, denn mein Dad ist so ziemlich der uneinsichtigste Mensch, den ich kenne. »Er sollte nach der Schule nach Hause kommen. Sollte hier was zu essen kriegen und Hausaufgaben machen«, höre ich mich dennoch sagen.
»Bist du jetzt neuerdings seine Mom?«
Oh Gott, er ist schon der zweite heute, der mir diese dämliche Frage stellt.
»Nein, aber du bist sein Vater. Und du solltest langsam anfangen, dich auch so zu verhalten!«
»Jetzt reicht es aber!« Mein Vater richtet sich auf und funkelt mich wütend an. »Du kannst froh sein, dass ich dich nach allem, was du getan hast, bei mir aufnehme! Dass ich dich hier durchfüttere! Jetzt komm mir nicht auch noch mit irgendwelchen Vorwürfen! Wenn du eine so tolle Mutter bist, dann kümmere du dich doch ab sofort um deinen Bruder. Genug Zeit hast du ja!«
»Liebend gern!« Ich gehe in mein Zimmer zurück und würde am liebsten die Tür knallen, auch wenn das kindisch ist. Stattdessen muss ich jedoch zwei Mal an der Falttür zerren, bis sie richtig zu ist.
Was für ein grandioser Abgang.
Ich setze mich auf mein Bett und schaufle das Rührei in mich hinein, als könnte es etwas für das Verhalten meines Dads.
Cas kann ihm doch nicht so egal sein. Ich muss an den Plan denken, den ich damals mit East geschmiedet habe. Gemeinsam hätten wir Casper hier rausgebracht. Damals war mein Bruder noch zwölf und leicht zu lenken. Doch das letzte Jahr hat ihn rebellisch werden lassen.
Bei dem Gedanken an East fühlt es sich an, als würden in meinem Kopf dunkle Gewitterwolken aufziehen. Auch wenn ich ihn auf keinen Fall wiedersehen will, vermisse ich dennoch den Rest der Black Bones. Sie sind meine Freunde.
Nein, eigentlich viel mehr als das – auch wenn sie sich gerade überhaupt nicht so verhalten. Wieso meldet sich keiner von ihnen bei mir?
Wahrscheinlich wissen sie nicht, dass ich draußen bin. Und ich kann es ihnen schlecht mitteilen, wenn sich Raquel tot stellt.
Ohne mir bewusst darüber zu werden, was ich tue, manifestiert sich in meinem Kopf ein Gedanke: Ich muss zu ihnen.
Aber was ist, wenn ich erwischt werde?
Das ist eigentlich unmöglich. Ich bin einer der besten Hacker Detroits. Wenn nicht sogar der gesamten Staaten.
Wäre da nicht dieser eine blöde Vorfall gewesen …
Ich weiß immer noch nicht, wo damals der Fehler lag. Ich war zu 100 Prozent anonym bei der IOTN eingeklinkt. Ich habe mich noch nicht einmal auf Proxys verlassen, sondern über VPN die gesamte Datenübertragung verschlüsselt.
Eigentlich war es unmöglich, mich zu enttarnen. Es war fast so, als wäre ich in der echten Welt mit fünf verschiedenen Latexmasken, einer Perücke und einem Fettanzug unterwegs gewesen. Und trotzdem haben die Bullen mich erkannt. Ich kapiere das nicht.
Ich zermartere mir jetzt seit einem Jahr das Hirn, was ich falsch gemacht haben könnte. Und komme immer wieder zu dem gleichen Schluss: gar nichts.
Dennoch hat die Sache ganz schön an meinem Ego gekratzt.
Doch was ich vorhabe, ist idiotensicher. Ich habe nicht vor, mich in irgendwelche Regierungscomputer einzuhacken oder Börsenunternehmen zu erpressen. Ich will lediglich meine Freunde wiedersehen.
Dafür muss ich die Fußfessel bearbeiten und sie kurzerhand umprogrammieren. Es klingt heikel, ist es aber nicht. Nicht für jemanden wie mich.
Ich klappe den Laptop auf und lasse meine Finger über den Tasten schweben.
Es reicht nicht, mich nur ins System zu hacken und meine Fessel vom Netz zu nehmen, denn dann würde sie sofort Alarm schlagen. Stattdessen muss ich ihr Signal manipulieren und es aussehen lassen, als würde ich mich die nächsten Stunden über nur im erlaubten Radius bewegen. Hierfür muss ich ein kleines Programm schreiben, das meine Bewegungen in einem zufälligen Muster simuliert. Dann zwinge ich die Software der Fessel, mit dem Programm anstelle des GPS-Senders zusammenzuarbeiten.
Bevor ich mir richtig klar darüber werde, fange ich auch schon an zu tippen. Genau wie heute Morgen, als ich den Laptop in Betrieb genommen habe, durchfluten auch jetzt Glückshormone meinen Körper.
Dieses Gefühl von Grenzenlosigkeit hat mir schrecklich gefehlt.
A.J. zu sein hat mir gefehlt.
Alles in allem brauche ich gute drei Stunden. Zufrieden betrachte ich danach das Ergebnis auf dem Monitor meines Laptops. In Wahrheit sitze ich auf dem Bett, doch vorgeblich laufe ich gerade durch den Wohnwagen. Mit anderen Worten: Ich bin abgekoppelt und kann tun und lassen, was ich will.
Erleichtert atme ich auf. Es fühlt sich gut an, zu wissen, dass ich es noch drauf habe. Und noch besser fühlt es sich an, endlich wieder frei zu sein.
In Gedanken schließe ich einen faulen Kompromiss. Ich werde nur einmal nach den Bones sehen und das Programm dann direkt zerstören.
Doch in Wahrheit weiß ich, dass es nicht bei diesem einen Mal bleiben wird.
Ich bin ein Mensch, der seine Freiheit braucht.
Und dieses kleine Tool ist dazu da, sie mir zu beschaffen.
Jess
In einem Trailer Park wie unserem ist es selbst nachts nie ganz still. Irgendwo wird immer gefeiert, gestritten oder gevögelt. Und da sich die Trailerbewohner als große Familie ansehen, gibt sich auch niemand Mühe, diese drei Dinge leise zu tun.
Doch hier unten am Kanal sind die Stimmen zumindest nur noch gedämpft zu hören.
Die morschen Holzstufen knarren unter meinen Schuhen, als ich zum Wasser hinuntersteige. Sanft bewegen sich die Boote, die hier ankern, in den Wellen. Eine Weile stehe ich nur da, lausche auf das Plätschern des Flusswassers, das gegen die Holzbohlen schwappt, auf das entfernte Rauschen der Highways und den Wind im Schilf um mich herum.
Der Mond steht hoch am Himmel und taucht den Detroit River in weißes Licht. Dahinter kann ich die Lichter von East Riverside sehen. Ein kleines Lichtermeer, das sich auf der Wasseroberfläche spiegelt.
Es ist ein Gefühl von unendlicher Freiheit, hier zu stehen und zu wissen, dass ich einfach überall hin kann.
Zu meinen Füßen befindet sich ein rotes Ruderboot, das einigermaßen intakt aussieht. Schon früher habe ich mir regelmäßig eines der Boote geliehen, also sollte es heute auch kein Problem sein, unbemerkt eins zu nehmen.
Ich sehe mich um, denn das Boot alleine reicht nicht. Doch es dauert nicht lange, bis ich im Schilfgras ein paar Paddel finde. Ich werfe sie ins Boot und klettere die rostige Leiter hinab. Mit dem Fuß ziehe ich den ganzen Kahn ein Stückchen näher zu mir. Ich habe wenig Lust ins Wasser zu fallen, also bin ich beim Einsteigen ganz besonders vorsichtig. Es ist eine wackelige Angelegenheit und ich balanciere eine Weile mit ausgestreckten Armen, aber schließlich sitze ich. Auch wenn es kühl ist, schiebe ich meine Ärmel hoch, dann löse ich die Leine und schnappe mir die Ruder. Ich liebe das Geräusch, mit dem sie ins Wasser eintauchen und die feinen Spritzer, die beim Auftauchen meine Arme überziehen.
Je weiter ich mich vom Trailer Park entferne, desto besser fühle ich mich. Ich kann es kaum erwarten, die anderen zu sehen. Wahrscheinlich werden sie ziemlich überrascht sein, dass ich plötzlich bei ihnen auftauche.
Was East wohl sagen wird? Was ich ihm wohl sagen werde? In dem einen Jahr hat sich verdammt viel Wut auf ihn angestaut.
Vermutlich wird er mich eiskalt ignorieren und mir so signalisieren, dass ich für ihn gestorben bin. Konsequent war er schon immer, in allem, was er tat. Und das ist vielleicht auch besser so.
Der aufkeimende Zorn lässt mich schneller rudern und schon bald taucht die kleine Insel vor mir aus den Schatten auf. Sie ist dicht bewachsen und bis auf eine alte Jagdhütte, unser Clubhaus, das mitten im Wald liegt, gänzlich unbebaut.
Jemand hat mal behauptet, die Insel würde East gehören, aber er hat es immer abgestritten.
Ich werde langsamer und spüre schon bald kiesigen Grund unter den Rudern. Ein kleines Stückchen noch …
Als ich nah genug am Ufer bin, stehe ich auf und springe mit einem Satz an Land. Das Boot binde ich an einem nahen Baum fest und die Paddel lasse ich einfach auf dem Trockenen liegen. Außer uns kommt niemand hierher, also muss ich auch keine Angst haben, dass sie jemand klauen könnte.
Vor mir liegen ein paar Meter Ufer, dahinter ist es komplett schwarz. Zahllose Bäume stehen dicht an dicht und bilden eine dunkle, undurchdringliche Front.
Zumindest sieht es so aus.
Doch ich kenne die Insel in- und auswendig und weiß von dem Pfad, der sich zwischen den Ahornbäumen hindurch schlängelt.
Worauf warte ich noch?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich ein bisschen Angst vor der Reaktion der anderen. Werden sie froh sein, mich zu sehen? Oder werden sie mir das Jahr Bootcamp genauso übelnehmen wie East?
Ich werde es nicht herausfinden, wenn ich weiter hier herumstehe.
Sand knirscht unter meinen Sohlen, als ich entschlossen losgehe. Der Vollmond erhellt die Uferböschung, doch kaum trete ich zwischen die Ahornstämme, umgibt mich Dunkelheit. Unter meinen Schuhen höre ich Zweige brechen und ich komme das eine oder andere Mal ins Stolpern.
Wieso ist der Weg so zugewuchert?
Ich gehe langsamer, um nicht zu fallen, taste mich von Stamm zu Stamm vorwärts.
Irgendetwas ist anders als noch vor einem Jahr. Immer wieder peitschen mir Äste ins Gesicht und meine Füße stoßen gegen Steine, die nicht hier herumliegen sollten.
Außerdem ist es immer noch stockfinster.
Vor mir sollte längst das grünlich blaue Leuchten aus der Hütte zu sehen sein.
Vielleicht gab es einen Stromausfall, überlege ich. Doch das wäre ein ziemlich blöder Zufall. Außerdem hat der Strom im Rest der Stadt einwandfrei funktioniert, schließlich habe ich vor einer halben Stunde noch die Lichter der East Side bewundert. Sollte es also in den letzten 30 Minuten zu einem Blackout gekommen sein, müssten mir die anderen begegnet sein. Auf dem Wasser, unten am Ufer oder spätestens hier im Wald. Denn ohne Elektrizität ist die Hütte nutzlos.
Doch es ist totenstill.
Mit einem Mal überzieht eine Gänsehaut meine Arme und ich erschauere.
Plötzlich habe ich es sehr eilig, aus dem Unterholz herauszukommen und mich zu vergewissern, dass bei den Black Bones alles okay ist. Ich laufe los.
Zweige und Ranken scheinen nach mir zu greifen, doch ich schaffe es, ohne zu stolpern auf die kleine Lichtung, auf der unsere Hütte steht.
Es brennt kein Licht.
Es ist keine Musik zu hören. Keine Stimmen.
Es ist einfach nur vollkommen still.
Das Clubhaus wirkt ausgestorben.
Langsam trete ich näher. Mein Herz pocht mir bis zum Hals, ich höre das Blut in meinen Ohren rauschen und meine Beine fühlen sich so wackelig an, als wären sie aus Pudding.
Ein mieses Gefühl macht sich in mir breit und ich muss mich zwingen, an eines der Fenster zu treten. Ich spähe hindurch und sehe … gar nichts.
Drinnen herrscht absolute Dunkelheit.
Das kann nicht sein. Es ist mitten in der Nacht. Irgendjemand sitzt immer an einem der Rechner.
Schnell laufe ich zur Eingangstür.
Ich will jetzt auf der Stelle wissen, was hier los ist! Ich drücke die Klinke und bin erleichtert, als die Tür aufschwingt. Also muss doch jemand hier sein.
»Hallo?«
Ich trete ein, taste nach dem Lichtschalter und hoffe, dass es keinen Strom gibt. Vielleicht wurden die Unterseekabel beschädigt und die Hütte ist dadurch für die Bones nutzlos geworden. Doch eine nackte Glühbirne glimmt auf und ich wünschte, ich hätte kein Licht gemacht.
Die Hütte ist verlassen. Nirgends stehen Schreibtische, Rechner oder Bildschirme herum. Die Sofas, die früher in der Ecke standen, sind verschwunden. Rostige Reißzwecken in den Holzwänden sind die einzige Erinnerung an die Poster und Pläne, die hier einst hingen.
Alles ist von Staub überzogen und von der Decke hängen Spinnweben.
Ansonsten ist hier drinnen nichts. Nicht einmal Müll. Keine herumfliegenden Chipstüten, keine leeren Flaschen, einfach nichts.
Ich kann es nicht fassen.
East hat nicht gelogen, als er sagte, er würde nicht auf mich warten.
Aber er hat dabei vergessen zu sagen, dass dies auch für den Rest der Bones gelten würde.
Jess
Ich liege im hohen Ufergras und blicke in den Himmel über der Insel, auf der unser Clubhaus liegt. Heute sind kaum Sterne zu sehen, von den vielen Feuerwerken liegt dünner Nebel in der Luft. Es ist so warm, als würde die Sonne noch scheinen und ich könnte nicht glücklicher sein.
Das war definitiv der beste 4. Juli meines Lebens.
Ich höre Schritte im Gras und fange an zu lächeln. East sagt kein Wort. Er geht neben mir in die Hocke, beugt sich über mich und ich spüre seine warmen Lippen auf meiner Haut. Er küsst meinen Bauch, arbeitet sich hinauf zu meinem Bikinitop, und mein ganzer Körper beginnt zu kribbeln. Ich strecke die Hände aus, streiche mit den Fingern über seinen Rücken.
»Lass es mich nochmal sehen«, flüstere ich.
East lacht, ich spüre seinen Atem auf meiner Haut. »Im Ernst?«
Ich grinse. »Ich kriege nicht genug davon.«
Er richtet sich auf, lächelt auf mich herab. Ich liebe sein Lächeln. Es liegt etwas darin, das ich noch bei keinem anderen Mann gesehen habe – zumindest, wenn es mir gilt. Wahrscheinlich liegt das an seiner Ehrlichkeit. Er mag noch so ein harter Kerl sein. Wenn er mich anlächelt, sehe ich nichts als Liebe in seinem Blick.
»Bereit?«, fragt er.
»Fast.« Ich verschränke die Arme unter dem Kopf, bringe mich in eine bequemere Position. »Jetzt. Bitte.«
East lacht, wobei sich winzige Fältchen um seine Augen bilden. Dann wird sein Lächeln zu einem Schmunzeln und er öffnet verführerisch langsam seine Hose für mich. »Ich seh gar keine Dollarnoten.«
»Ich überweis dir was.«
»Lass mal stecken. Geht auf’s Haus.« Damit zieht er seine Jeans ein Stück herunter und lässt mich das frische Tattoo auf seiner Leiste bewundern.
Ich lächle, beiße mir auf die Lippe und setze mich auf, um mit den Fingern darüber zu streichen. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir das wirklich machen«, gebe ich zu.
»Und wieso nicht?«
»Ich weiß auch nicht. Das hat sowas Endgültiges. Fast als hätten wir geheiratet.«
»Es bedeutet viel mehr als eine Heirat«, erwidert East. »Was ist schon ein Ring? Den kann man abnehmen. Aber du …« Er legt mir eine Hand auf die Wange und hebt mein Gesicht an, sodass unsere Blicke sich treffen. »Du bist jetzt unter meiner Haut, Jessy.«
Das Kribbeln in meinem Inneren wird stärker. Bevor ich East kannte, hätte ich nicht gedacht, dass sich Liebe so anfühlt. So elektrisierend. »Und du unter meiner«, sage ich leise.
East streicht mir über die Wange, sein Lächeln nimmt eine nachdenkliche Note an. »Baby. Du weißt, dass das Leben an meiner Seite nie normal sein wird, oder?«
Wie könnte ich das nicht wissen? Vergangene Nacht haben wir für einen reichen Russen eine Kunstsammlung ausgeraubt. Letzte Woche einen Banker im Auftrag seiner Exfrau. Und heute? Heute haben wir den Unabhängigkeitstag gefeiert, indem wir das offizielle Feuerwerk über dem Detroit River gehackt und zu unserem eigenen gemacht haben. »Und du weißt hoffentlich …« Ich drücke ihm einen Kuss auf die Brust. »… dass ich nie ein normales Leben gewollt habe.«
Damit lehne ich mich an ihn, schließe die Augen und lausche seinem gleichmäßigen, festen Herzschlag.
»Ich auch nicht«, sagt er nach einem Moment – ernster, als ich es von ihm gewohnt bin. »Ich habe es nicht gewusst, bevor ich dich kannte. Aber ich glaube, ich habe immer nur dich gewollt.«
Ich spüre, wie mich bei seinen Worten Glückshormone durchfluten. Ich weiß genau, was er meint.
Bevor ich ihn kennenlernte, kam mir mein Leben nicht einsam vor. Aber genau das war es. Als wäre ich blind geboren worden und hätte plötzlich zu sehen gelernt.
Ich öffne die Augen und schaue zu East auf. Sein Blick ist auf den Fluss gerichtet, der sich wenige Meter von uns erstreckt.
»Versprich mir etwas«, flüstere ich.
East sieht zu mir runter. Er weiß, was ich von ihm hören will, ohne dass ich es sagen muss.
»Das habe ich doch schon«, erwidert er, und dann senkt er seine Lippen auf meine, gibt mir einen langen, tiefen Kuss.
»Für immer, Baby«, sagt er, als sich unsere Lippen irgendwann voneinander lösen.
Und während meine Augen noch geschlossen sind und seine Worte wie ein Echo durch meinen Kopf hallen, hebt er mich hoch und trägt mich runter zum Wasser.
Mit mir auf dem Arm watet er in den Fluss. Dort lässt er mich runter, ich schlinge die Arme um ihn und wir küssen uns erneut. Das Wasser zerrt an uns, die Nacht wird dunkler, die letzten Feuerwerke verklingen.
Ich halte mich an East fest und während unsere Körper verschmelzen, weiß ich, dass ich nie etwas anderes als das hier brauchen werde.
Nie etwas anderes als ihn.
Ich stoße mit dem Fuß gegen eine leere Coladose, die auf dem Rasen des Lakeside Park liegt. Sie kullert davon und das blecherne Geräusch reißt mich aus meinem Tagtraum. Ich sehe mich um. Der Morgen graut schon fast und ich fühle mich vollkommen leer.
Wie kann es sein, dass ein einziges Jahr alles geändert hat? Ich dachte, das mit mir und East wäre für immer. Ich dachte auch, die Black Bones würden immer meine zweite Familie sein.
Wo sind sie hin? Als ich verhaftet wurde, hatten die Bones acht Mitglieder. Im Haus war immer etwas los. Und jetzt?
Ob die anderen es mir echt übelnehmen, dass ich erwischt worden bin?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. East muss dahinterstecken. Es ist typisch für ihn.
Alles oder nichts, ganz oder gar nicht.
Für ihn gibt es nichts dazwischen.
Kennengelernt habe ich ihn mit 17. Ein Hackerkollektiv aus Michigan hatte einen Wettbewerb ausgerufen: Wer es als Erstes schaffte, sich in das Lautsprechersystem von Walmart zu hacken und dort einen Song seiner Wahl einzuspeisen, natürlich landesweit, sollte ein Jahr lang freien Zugriff auf einen anonymen Server bekommen. East und ich nahmen beide teil.
Außer uns noch eine Reihe anderer, aber die haben wir schnell ausgebootet.
Ich erinnere mich genau an diese Nacht. Mit brennenden Augen saß ich vor meinem Computer, meine Finger flogen nur so über die Tasten. Doch immer wieder wurde ich ausgebremst, rausgeworfen, abgeblockt. Schnell stellte ich fest, dass nicht etwa das Sicherheitssystem der Supermarktkette, sondern ein anderer Hacker dafür verantwortlich sein musste. Ich schlug zurück, griff ihn an, wo ich nur konnte. Zwischen uns entwickelte sich das reinste Wettrennen. Doch schließlich war es mein Song, der morgens bei Ladenöffnung durch sämtliche Walmarts der Vereinigten Staaten schallte: ‚I don’t care‘ von Fall Out Boy.
Ich triumphierte innerlich, machte den PC aus, legte mich schlafen – und wachte davon auf, dass jemand an meinem Bett stand, mit einem Smartphone in der Hand, aus dem mein Song ertönte.
East. Er hatte unseren kleinen Wettkampf als Vorwand genommen, um mich aufzuspüren. Mit seinen stechend blauen Augen und einem selbstzufriedenen Lächeln auf den Lippen blickte er auf mich herab. Ein tätowierter Outlaw, der selbst dann noch wie ein Gewinner wirkte, als er verloren hatte.
Ich erschreckte mich zu Tode und verliebte mich noch am selben Tag unsterblich in ihn.
Tja, das ist alles Vergangenheit.
Frustriert lasse ich die erste Trailerreihe hinter mir und will gerade die Stufen zu unserem Wohnwagen hinaufsteigen, als ich hinter mir eine Stimme vernehme: »Erwischt, würde ich sagen.«
Wie vom Donner gerührt bleibe ich stehen. Oh, nein. Das habe ich nicht wirklich gehört. Es muss Einbildung gewesen sein.
Ich kneife die Augen fest zu, steige wie in Zeitlupe die erste Stufe hinauf und hoffe, dass alles still bleibt. Aber das tut es nicht.
»Ich kann dich sehen, Jessica. Auch wenn dir das nicht passt.«
Shit. Diese Stimme bilde ich mir definitiv nicht ein. Sie gehört ohne Zweifel zu Goldman.
Ich höre das Rascheln seiner Schritte im feuchten Gras und verharre reglos auf der Treppe, bis er hinter mir stehenbleibt.
»Ich dachte, ich hätte dir ziemlich klar gesagt, was passiert, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.«
»Ich war nur unten am –«
»Lüg mich nicht auch noch an«, unterbricht er mich harsch. »Du gehst jetzt von der Treppe runter und stellst dich mit dem Gesicht zur Wand, die Hände über den Kopf. Na, los.«
Verdammt. Das darf doch alles nicht wahr sein.
Obwohl ich am liebsten wegrennen würde, tue ich, was Goldman will, und stelle mich vor die Wohnwagenwand. Ich lege die Hände an die rostige Verkleidung und höre mich selbst durchatmen. In den Knast will ich unter gar keinen Umständen, also muss ich mir etwas einfallen lassen.
Ich spüre, wie Goldman dicht hinter mich tritt, dann legen sich seine Hände auf meine Arme, fahren mit leichtem Druck daran hinauf.
»Ich habe nichts«, sage ich, auch wenn ich gar nicht genau weiß, was er sucht. Drogen? Diebesgut?
»Und abgehauen bist du vermutlich auch nicht.«
Wieder bin ich versucht ihm zu sagen, dass ich nur unten am Kanal war, doch er scheint zu wissen, dass das nicht stimmt. Wie kann das sein? Meine Methode war sicher, das Programm, das ich geschrieben habe, absolut unauffindbar.
Aber das dachte ich damals bei der IOTN Corporation auch, oder nicht?
Wer weiß, vielleicht bin ich einfach nicht so gut, wie ich denke.
Aber andererseits war ich das vorher ja auch. Da kann es doch nicht sein, dass ich plötzlich jeden Hack versaue.
Goldmans Hände gleiten an meinen Armen wieder hinab und fahren dann meine Seiten herunter zu meinen Hüften. Keine Ahnung, ob er das überhaupt darf, aber ich weise ihn lieber nicht darauf hin.
Seine Hände fahren meinen Hosenbund entlang, schieben sich in meine Taschen. Ich spüre den Druck seiner Finger auf meiner Leiste und ignoriere die leichte Gänsehaut, die sich dabei auf meinem Körper ausbreitet.
Komm schon, Jess. Nicht die richtige Situation, nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Kerl.
Trotzdem verschwindet die Gänsehaut nicht, sondern wird nur noch stärker, als Goldman hinter mir in die Hocke geht und meine Beine abtastet, erst das linke, dann das rechte, innen und außen. Erst als er sich meinen Schuhen zuwendet, spüre ich, wie ich mich entspanne.
»Okay, umdrehen.«
Ich tue, was er sagt, und nehme die Hände runter.
Goldman verschränkt die Arme und mustert mich unzufrieden. Noch immer steht er ganz nah vor mir. Er hat dieselbe Jacke an wie gestern, jetzt allerdings mit einem dunklen Shirt, unter dem sich selbst im Zwielicht des aufziehenden Morgens seine Muskeln abmalen.
»Wo warst du?«, will er von mir wissen.
»Nirgends«, erwidere ich automatisch.
»Jess.« Der Blick seiner dunklen Augen bohrt sich in die meinen. »Wo warst du?«, wiederholt er.
Schnell, Jessica. Denk dir was aus. »Ich bin schlafgewandelt.« Ich rette mich in ein breites Lächeln, von dem ich hoffe, dass es charmant wirkt, aber Goldman mustert mich, als wäre ich einfach nur dämlich.
»Du willst es mir also nicht sagen«, stellt er fest. »Gut. Dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten.«
Zwei? Das überrascht mich. Ich war fest davon ausgegangen, dass mir jetzt der Knast blüht und sonst nichts. Egal, was die zweite Möglichkeit ist – ich wähle sie. Und wenn es bedeutet, dass ich zurück nach Hudson Mills muss.
»Welche wären das?«, frage ich, um Festigkeit in meiner Stimme bemüht.
Ich gebe es nicht gern zu, aber dieser Mann schüchtert mich ein. Weil er mich in der Hand hat und ich ihn nicht einschätzen kann. Etwas, das bisher noch nicht oft vorkam.
Er wirkt extrem kontrolliert. Ruhig und lauernd. Und dabei irgendwie beeindruckend.
»Entweder«, sagt er, wobei er mich immer noch mit seinem undurchdringlichen Blick fixiert, »dein Bewährungsverfahren wird aufgehoben und du gehst ins Frauengefängnis von Huron Valley.«
»Oder?«, frage ich, denn Huron Valley ist für mich mit Sicherheit keine Option.
»Oder …« Goldman mustert mich von oben bis unten und ein gefährliches Funkeln erscheint in seinem Blick. »Du tust mir einen Gefallen.«
Mir ist sofort klar, was er meint. Ein Mann, der offenbar bis obenhin voll mit Testosteron und noch dazu in einer Machtposition ist – was könnte so jemand von einer 21-Jährigen wollen? Klar. Sex.
Mein letztes Mal hatte ich mit East. Der Sex mit ihm war, als würde man versuchen, ein wildes Tier zu bändigen. So lange, bis man einsieht, dass man machtlos ist und sich einfach hingibt. Mit ihm zu schlafen war perfekt. Er war in der Lage, meinen Körper voll und ganz zu vereinnahmen und mich alles andere vergessen zu lassen.
»Okay«, sage ich und blicke auf seine Brust. »Ich wähle B.«
Damit stelle ich mich auf die Zehenspitzen, packe meinen Bewährungshelfer am Kragen und küsse ihn. Angriff ist die beste Verteidigung – das sagt man doch so.
Für den Bruchteil einer Sekunde wirkt er überrascht. Dann jedoch packt er mich im Nacken, erwidert meinen Kuss, und es fühlt sich ganz anders an, als ich gedacht hätte.
Nicht erzwungen, sondern vielmehr, als wären wir auf Augenhöhe. Als wäre er mir gar nicht so unähnlich, sondern als schlügen unsere Herzen im selben Takt.
Seine Zunge teilt meine Lippen mühelos. Ich lasse zu, dass er meinen Mund erobert und mit meiner Zunge zu spielen beginnt. Wieder ist da dieses Kribbeln, das mich schon bei der Leibesvisitation überkam.
Meine Atmung beschleunigt sich und ich wehre mich nicht, als Goldmans Hände auf Wanderschaft gehen. Er streichelt meinen Rücken hinab, schiebt seine Finger unter meinen Hoodie und umschließt meine Pobacken, drückt sie kräftig.
Gott. Warum macht mich das an?
Ich kann mich nicht dagegen wehren und keuche leise, als Goldman meinen Hintern umfasst. Ich trete einen Schritt näher an ihn heran. Sein Kuss gewinnt an Leidenschaft, ein leichter Schwindel erfasst mich …
Und dann hört er plötzlich auf und lässt von mir ab. Nicht nur seine Lippen lösen sich von meinen, sondern seine Hände lassen auch meinen Po los. Er sieht zu mir runter, mit einem Grinsen im Gesicht, das mich irritiert.
»Nicht schlecht«, sagt er anerkennend. »Aber ich meinte eine andere Art von Gefallen.«
Was? Irritiert sehe ich ihn an.
Goldman lacht und es wirkt echt. Nicht, dass er sonst nicht echt wirken würde, aber dieses Lachen kommt mir irgendwie ehrlicher vor als sein restliches Verhalten. »Du überraschst mich, Jess«, sagt er und mir fällt jetzt erst auf, dass er mich, anders als gestern, duzt.
»Was sollten Sie sonst wollen?« Ratlos zucke ich mit den Schultern.
Goldman gibt mir keine Antwort, sondern lässt mich eine Weile zappeln, wobei er mich eingehend mustert. Dann endlich öffnet er den Mund. »Ist dieser Schlabberlook alles, was du hast?«
Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. »Mein Pullover?«, stammle ich wenig geistreich.
Goldman wirkt ein wenig ungeduldig. »Hast du nur solche Klamotten? Oder auch etwas Anständiges?«
Wenn er mit etwas Anständigem Röcke und Blusen meint, muss ich ihn enttäuschen. »Ich verstehe nicht ganz.«
»Kleider, Shorts, Oberteile, die deinen Körper nicht aussehen lassen wie den eines Jungen.«
Will er jetzt, dass ich mich in ein sexy Outfit schmeiße, bevor wir es treiben? Oder ist das Sex-Ding vom Tisch? Dieser Typ verunsichert mich langsam, aber ich bin immer noch bereit dazu, mit ihm ins Bett zu gehen, um meinen Hintern zu retten. Mehr denn je, wie ich mir eingestehen muss, denn seine Art gefällt mir. Und nicht nur die. Auch sein Äußeres spricht mich extrem an. Ich weiß, dass es unangebracht ist, trotzdem schaffe ich es nicht, ihn nur als Autoritätsperson anzusehen. Sicher, er wirkt respekteinflößend, aber nicht auf die Art, wie es ein Bewährungshelfer tun sollte.
In Gedanken gehe ich die Sachen durch, die sich unter meinem Bett befinden. Da ist so einiges bei, was nach seinem Geschmack sein könnte.
Ich nicke. »Sowas habe ich.«
»Schön. Dann zieh dir was davon an. Ich hole dich heute Abend ab.«
»Sie holen mich ab? Etwa für den Knast?«
Sein strenger Blick nimmt erneut eine amüsierte Note an. »Für eine Party.«
Träume ich das gerade? Oder verlangt mein Bewährungshelfer tatsächlich von mir, mit ihm auf eine Party zu gehen, dafür, dass er mich nicht in den Knast steckt?
Ist er so einsam oder steckt da mehr hinter?
»Was für eine?«
»Was denkst du denn?«
Die Worte platzen aus mir heraus, ohne, dass ich vorher darüber nachdenken kann. »Eine Swingerparty.«
Goldmans Augen verengen sich zu Schlitzen, dann lacht er. »Eine Swingerparty? Sehe ich aus, als hätte ich so etwas nötig?«
Nein. Er sieht aber auch nicht aus, als hätte er es nötig, seine Klienten mit Sex zu erpressen, und trotzdem habe ich es für möglich gehalten.
Wortlos schüttle ich den Kopf.
»Es ist eine normale Party, Jess. Und wenn du nicht willst, dass sie dich in Handschellen abführen, willigst du besser ein.«
»Okay«, sage ich schnell. »Ich bin dabei.«
»Na, bravo.« Goldman greift in seine schwarze Umhängetasche und hält mir eine Flasche Eagle Rare hin. Ich bin zwar kein Whisky-Experte, aber eines weiß ich sicher: Das hier ist kein billiger Fusel.
Warum um alles in der Welt läuft Goldman mit Hochprozentigem in der Tasche herum?
»Gib die gegen acht deinem Vater. Das ist starkes Zeug. Wenn er davon eingeschlafen ist, kommst du runter zur Straße. Ich warte da auf dich.«
Ich hole Luft, aber Goldman legt mir einen Finger auf die Lippen.
»Ssh. Tu einfach, was ich sage.«
Damit wendet er sich ab und lässt mich stehen.
Ich sehe ihm verwirrt nach. Was will Goldman von mir? Ich glaube nicht, dass er nach dieser Party einfach Ruhe geben wird.
Er will mehr.
Die Frage ist nur, was genau. Auf Sex ist er nicht aus, aber worauf dann?
Erst als Goldman außer Sichtweite ist, wende ich mich ab und gehe die Stufen wieder nach oben. Ich betrete den Wohnwagen, schleiche mich zu meinem Zimmer – und sehe, dass die Falttür gegenüber von meiner offen ist.
Cas lehnt im Rahmen, bekleidet mit nichts als Boxershorts. Irgendwie ist es komisch, meinen Bruder so zu sehen, nachdem er sich derart verändert hat.
»Hey«, flüstere ich und will an ihm vorbei.
»Wo warst du?«, fragt er und gibt sich keine Mühe, leise zu sein.
»Draußen«, erwidere ich vage, denn anlügen will ich ihn nicht.
»Mit wem hast du geredet?«
Nun sehe ich ihn doch noch an und entdecke Misstrauen in seinem Blick.
»Mit meinem Bewährungshelfer«, antworte ich.
Cas mustert mich zweifelnd. »Bau keine Scheiße, Jess«, sagt er dann. »Wenn sie dich einlochen …«
Seine Wut von gestern Morgen scheint verflogen. Er spricht nicht weiter, doch ich weiß genau, was er sagen will. Wenn sie mich verhaften, ist er wieder allein hier.
Ich strecke die Hand aus und drücke seine Schulter. »Keine Sorge. Und jetzt schlaf noch ein bisschen. Du musst bald zur Schule.«
Damit gehe ich in mein Zimmer. Ich kann nur hoffen, dass ich Goldman trauen kann. Wenn ich eines nicht will, dann ist das, meinen Bruder nochmal zu enttäuschen.