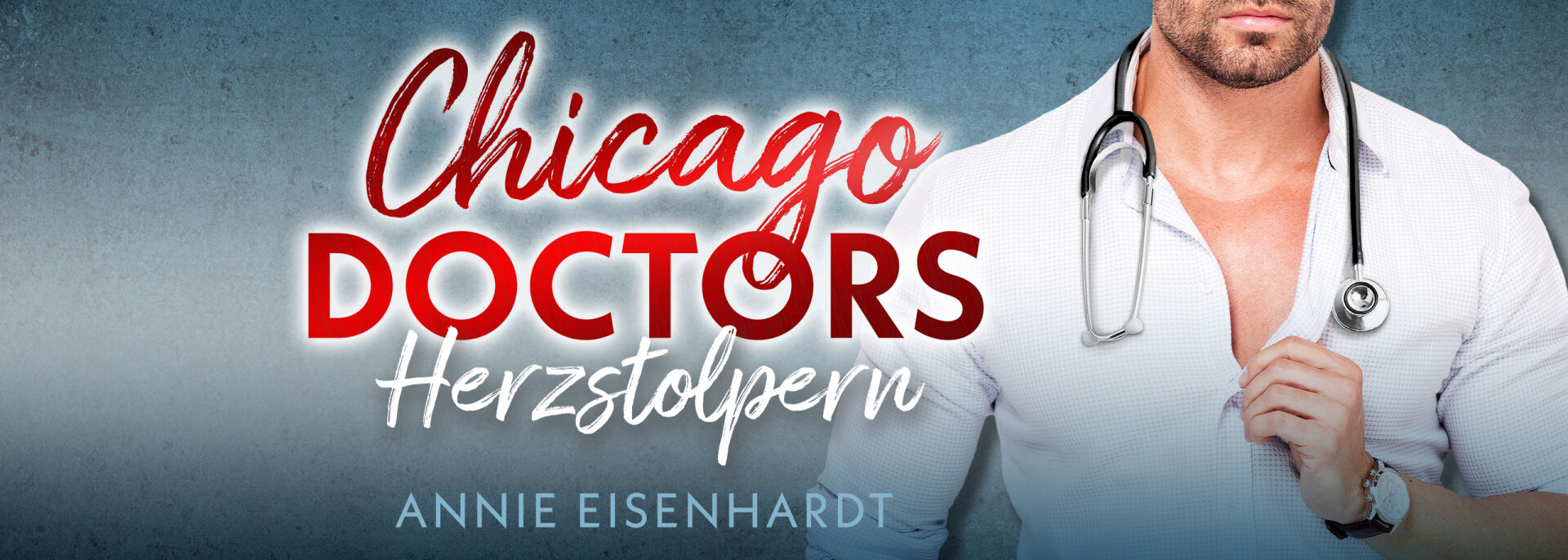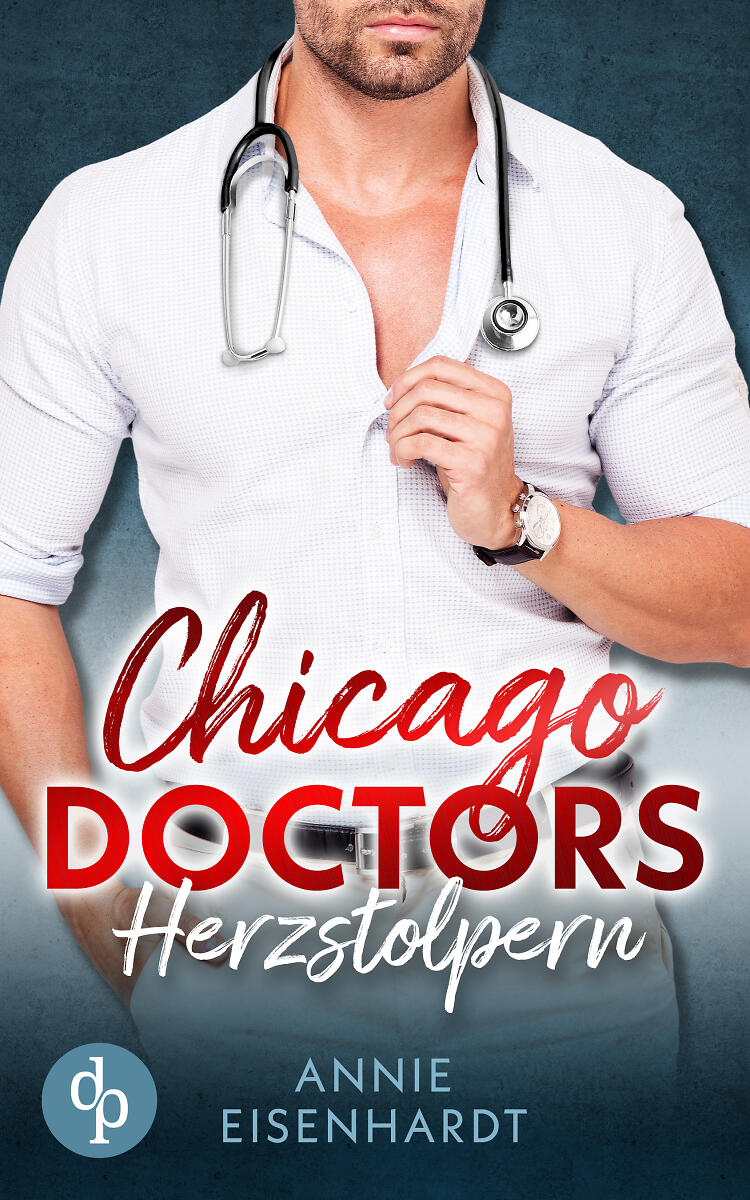Kapitel I: Ein Date
Neues Leben, neues Ich und in meinem Fall eine neue Frisur. Meine Haare reichten nun kaum mehr bis zum Kinn. Eine Tatsache, die mir vor einem Jahr noch Albträume bereitet hätte. Ich hasste Veränderungen, zumindest tat das mein altes Ich. Mein neues Ich hingegen hatte jetzt einen Bob und ein Nasenpiercing. Denn mein neues Ich war lässig, cool und selbstbewusst. Mit den Fingern fuhr ich durch die Haare und fächerte die einzelnen Strähnen auf. So weich waren sie sicher noch nie in meinem Leben gewesen.
„Und, gefällt es dir?“, fragte mein neuer Friseur namens Tom. Er musterte mich augenzwinkernd im Spiegel. Vermutlich sah man mir die Entgeisterung an. Tom hielt den Föhn noch in einer Hand und in der anderen die Schere, mit der er wieder gefährlich nahe an meinen Kopf kam. „Oder noch ein Stück kürzer?“ Er lachte laut.
Panik wallte in mir auf. Noch weniger Haare würde meine Seele nicht verkraften, ich war mir jetzt schon völlig fremd. Die Idee mit dem Piercing vor einigen Wochen kam mir bereits verrückt vor, aber diese Frisur war … war einfach zu kurz. Ich hatte meine Haare bisher immer lang getragen, immer! Mühsam zwang ich mich zu einem Lächeln und sagte: „Ja, ganz wunderbar. Die Länge passt so, denke ich.“ Gab es überhaupt Menschen auf der Welt, die ihrem Friseur jemals die Wahrheit sagten? Ich strich mir nochmals durch die Locken und musste schlucken, da die Bewegung nicht länger als eine Sekunde gedauert hatte. Meine Haare hatten mir vorher bis unter die Brust gereicht. Neues Leben, neues Ich. Da war der Neubeginn, den ich mir so gewünscht hatte. Nicht, weil er notwendig war, sondern weil ich ihn wollte. Es war an der Zeit, mich zu verändern. Mein altes Ich hatte jahrelang über Büchern gegrübelt und die Welt dort draußen an sich vorbeiziehen lassen. Mein neues Ich war bereit, sich endlich dem Leben zu stellen, und zwar als knallharte Chirurgin. Ich konnte es immer noch kaum glauben, ich war Ärztin. Endlich.
Diesmal ging mir das Lächeln leichter über die Lippen. „Danke, Tom. Ich glaube, es gefällt mir.“ Noch so ein Satz, den man zu Friseuren sagte, ohne ihn tatsächlich zu meinen.
„Kein Problem. Wenn es dir nicht gefällt, kommst du einfach vorbei und wir überlegen uns etwas anderes. Es gibt immer noch Extensions.“ Er zwinkerte.
Anscheinend war mein Pokerface so miserabel wie dieser Haarschnitt. Ich zahlte und gab Tom ein saftiges Trinkgeld, weil ich seinen mitleidigen Blick nicht länger ertragen konnte. Dann trat ich auf die Straße.
Die Sonne versank bereits hinter den hochaufragenden Wolkenkratzern der Stadt. Chicago, meine alte Heimat. Goldenes Licht spiegelte sich in den glatt polierten Fassaden aus Glas und Beton wider und brachte die Welt um mich herum zum Funkeln.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sog die letzten Sonnenstrahlen in mich auf. Meine Haut kribbelte leicht und ich nahm einen tiefen Atemzug der merklich kühler werdenden Luft. Die Stadt roch nach Leben und Herbst. Columbus war nichts im Vergleich dazu, ein Glück war ich zurückgekehrt.
Am Pier des Chicago River tummelten sich Menschen, bevölkerten die vielen kleinen Bars, die sich entlang des Ufers erstreckten. Ein älterer Mann stand am Pier, in seinen Händen ein Saxofon, in das er voller Pathos hineinblies. Zu seinen Füßen lag eine Musikbox, aus der die ausgelassenen Töne eines Jazzstücks quollen. Die meisten Menschen hatten ihm den Rücken zugedreht, dennoch waren ihre Gespräche gedämpfter und auf ihren Gesichtern sah ich ein zufriedenes Strahlen. Weiter hinten hatte sogar ein Paar angefangen, sich im Takt der Musik zu wiegen. Die Stimmung war ausgelassen, lebhaft, aber dennoch hatte sie diesen Filter darüber, den nur ein Spätsommerabend am Pier mit sich bringen konnte. Ich musste lächeln, das hier war meine Heimat. Chicago, eine Stadt, die mir binnen weniger Tage die alte Lebensfreude zurückgebracht hatte. Es ging gar nicht anders.
Die Jahre, die ich für mein Studium in Columbus verbracht hatte, waren anstrengend gewesen. Doch ich hatte es geschafft. Mit Bestnoten und Empfehlungsschreiben war es mir gelungen, einen der begehrtesten Ausbildungsplätze überhaupt zu erlangen. Ich war nun eine Assistenzärztin in der Chirurgischen Klinik des Chicago Med. Ab jetzt würde alles anders werden. Keine staubigen Bücher und Leichen aus der Anatomiehalle mehr. Nein, ich durfte echte Menschen behandeln. Ich würde eine richtige Ärztin in einer der besten Kliniken des Landes sein.
Mein Nacken juckte leicht und ich unterdrückte den Drang, die feinen Haarreste weiter zu verreiben. Normalerweise würde ich jetzt nach Hause gehen und duschen, aber Tom hatte sich so viel Mühe mit meiner Föhnfrisur gegeben, dass ich es schlichtweg nicht übers Herz brachte, sie zu zerstören. Außerdem war da noch dieses Date, das mich in einer halben Stunde erwartete.
Mein Herz machte einen kleinen freudigen Satz nach vorn, während ich entlang des River Walk spazierte und die Musik langsam hinter mir ließ. Nach Erhalt meines Doktortitels hatte ich meine selbstauferlegte Sperre bezüglich Männer beendet. Es war an der Zeit, dass ich mir wieder etwas Spaß gönnte. Max schien genau der Richtige dafür zu sein. Ein bisschen Spaß, ein wenig Ablenkung zum Jobbeginn, keine große Sache. So hatte ich es mir zumindest selbst verkauft, als ich die Dating-App heruntergeladen hatte. Für mehr würde ich in den kommenden Monaten keine Zeit haben.
Mein Magen rumorte und ich strich unwillkürlich darüber. Ob es von der Aufregung kam oder vor Hunger, ließ sich nicht sagen, beides würde sich hoffentlich bald legen. Mein Handy vibrierte. Ich zog es aus der Jackentasche und blickte auf das Display.
Bist du schon da? Stehe vor der Tür …
Hastig beschleunigte ich meine Schritte und verließ den River Walk Richtung Clark Street. Die Straßen leerten sich nun zunehmend und nahmen wieder das Flair der Großstadt an, vorbei war es mit dem bunten Getümmel zur Jazzmusik. Ein paar Blöcke weiter entdeckte ich ihn.
Da stand Max. Mit dem Rücken lässig an die Hausfassade gelehnt, den Blick auf sein Handy gerichtet. Er trug eine dunkelblaue Bomberjacke, darunter ein weißes Hemd, passend zur grauen Stoffhose und den dunkelbraunen Lederschuhen. Seine hellblonden Haare hatte er nach hinten gegelt, ganz der Jurist. Ich schmunzelte leicht, als ich seine Sonnenbrille sah. Die Sonne war längst hinter der Skyline verschwunden und seine Brille absolut unnötig. Dennoch schaffte es Max damit keineswegs lächerlich zu wirken. Er versprühte diese Mischung aus Schick und Eleganz, ohne dabei schmierig zu sein. Eigentlich hätte ich Kisten auspacken müssen, aber der Gedanke an Montag machte mich jetzt schon völlig wirr im Kopf. In den letzten vierundzwanzig Stunden war das Treffen mit Max noch eine meiner besseren Entscheidungen, wenn man bedachte, dass ich gerade den Großteil meiner Haare im Friseursalon gelassen hatte. Vermutlich hätte ich mir sonst noch aus Panik ein Tattoo stechen lassen. Da gab es dieses House of Pain, das ich vorhin gesehen hatte. Dort hatten sie teilweise richtig schöne Ex …
Nein. Ich würde mir jetzt kein Tattoo stechen lassen. Das wäre absolut unvernünftig, besonders ohne Motividee. Am Ende wäre es die obligatorische EKG-Linie geworden und dabei wusste jeder Arzt, dass Chirurgen keine Ahnung von EKGs hatten.
Meine Schultern spannten sich unwillkürlich an. Ich kannte mich gut mit EKGs aus, obwohl ich Chirurgin war. Alles wird gut, Anna. Du wirst jetzt Zeit mit Max verbringen und einfach nicht an Montag denken.
Max tippte weiterhin auf seinem Handy herum, aber in meiner Tasche vibrierte nichts. Er wirkte völlig gelassen, wie er da so an der Wand lehnte. Eigentlich sollte ich auf ihn zugehen. Stattdessen genoss ich es, ihn für einen Moment einfach in Ruhe zu betrachten. Allein diese Nase. Kein Mensch hatte so eine gerade Nase im Profil, kein einziger Hubbel. Ich seufzte eifersüchtig.
Max blickte auf und seine Lippen verformten sich zu einem Lächeln. „Du bist ja schon da“, begrüßte er mich und umarmte mich, bevor ich etwas erwidern konnte. Er roch nach Aftershave und einem Hauch Zitrone.
Ich schloss die Augen und sog seinen Duft in mich auf. Er löste sich schneller von mir, als mir lieb war.
„Hi.“ Dann, um noch irgendetwas Sinnvolles anzufügen: „Du bist zu früh“, sagte ich mit einem gespielt vorwurfsvollen Blick. Max grinste und steckte seine Sonnenbrille in ein ledernes Etui, das er aus seiner Brusttasche holte. Seine strahlend blauen Augen funkelten belustigt. Ich hatte es mir nicht eingebildet: Sie waren tatsächlich so blau wie der Lake Michigan, wenn man am frühen Morgen aufs Wasser hinauspaddelte.
„Du bist aber auch nicht gerade spät dran“, erwiderte er.
„Ich wollte die Location auschecken. Falls du beim zweiten Date plötzlich langweilig bist, will ich zumindest gut gegessen haben.“
„Nun, dafür ist es jetzt zu spät. Aber du kannst mir vertrauen, die Pasta ist gut.“ Er beugte sich vor und flüsterte in mein Ohr. „Und langweilig bin ich auch nicht.“ Ich musste schmunzeln. Hätte Max gewusst, dass meine Mutter Italienerin war und niemand auf der Welt so gute Pasta machen konnte wie sie, hätte er es sich vielleicht noch einmal überlegt.
„Wollen wir reingehen?“, fragte ich.
Max nickte, ergriff meine Hand und führte mich ins Foyer des Restaurants. Es fühlte sich seltsam vertraut an ihn zu berühren, irgendwie richtig und doch … Wir kannten uns kaum. Bisher hatten wir nur ein paar Mal miteinander telefoniert und uns auf einen Kaffee getroffen und dennoch fühlte ich mich sofort bei ihm wohl.
Ein Kellner führte uns zu unserem Tisch und Max ließ meine Hand los, um für mich den Stuhl zurückzuschieben. Eigentlich mochte ich diese Art der Sonderbehandlung nicht, aber bei Max wirkte sie ganz natürlich. Als wären seine Manieren selbstverständlich und hätten nichts mit dem Plan zu tun, mich aufzureißen. Wobei das auch eher meinem Ziel entsprach. Das Hemd unter seiner Jacke war zwar blickdicht, dennoch konnte ich seinen schlanken, definierten Oberkörper darunter durchaus erahnen. Ich betete darum, dass ich heute einen Blick darauf erhaschen würde. Das wäre die beste Ablenkung vor Montag … Ach verdammt.
„Wie war der Umzug?“
„Gut, denke ich. Also, Caroline hat viel geflucht und Tim hauptsächlich die Kisten getragen, aber ich hatte ja nicht sonderlich viel.“
„Caroline war deine Mitbewohnerin, oder?“
„Ja, und frühere Nachbarin und zukünftige Kollegin. Allerdings macht sie Onko und nicht Chirurgie. Tim ist ihr Freund. Er musste beruflich wegziehen, weswegen ich sein Zimmer haben kann.“
„Glück gehabt, wenn du gleich bei einer Freundin wohnen kannst.“
„Sag das nicht Caroline.“
Max lachte auf und reichte mir eine der Karten, die uns die Kellnerin gebracht hatte. Mein Magen zog sich freudig zusammen, während ich die Speisekarte las. Mein Gott, hatte ich Hunger.
„Und wie war dein Tag?“, fragte ich beiläufig. Max arbeitete in einem dieser Wolkenkratzer, die ich meist kaum unterscheiden konnte. Seinem Vater gehörte eine große Kanzlei, ‚Williams and Partners‘ oder so ähnlich. Ich hatte noch nie davon gehört, was aber nichts heißen musste. Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter hatte mit vier Kindern mehr als genug zu tun. Ich war in einem der Außenbezirke Chicagos aufgewachsen und das Leben der Schlipsträger im Central Loop war für mich eine völlig fremde Welt.
„Ganz gut.“ Max schwieg für einen Moment. Ein Hauch der Unzufriedenheit huschte über sein Gesicht, dann klappte er die Speisekarte zu. „Wann geht es bei dir los?“
Ich unterdrückte den Drang, mir durch meine kurzen Haare zu streichen. „Montag.“
Max musterte mich mit durchdringendem Blick, eine seiner blonden Augenbrauen hatte er schräg angehoben. Ich hielt ihm stand, wir beide spürten das Ungesagte in meinen Worten. Gedanken drehten sich in meinem Kopf, losgetreten von seiner unschuldigen Frage.
Montag. Ich würde von Professor Vadasz, einer der besten Chirurginnen des Landes, lernen. Ein Traum wurde für mich wahr – und trotzdem war da diese Angst. Jene Angst, die einen überkam, wenn man ein neues Buch aufschlug und nicht wusste, ob die kommende Geschichte einem Freude bereiten würde oder einen in die tiefsten Abgründe stürzen ließ. Ich war mit dem Ziel hierhergekommen, von Professor Vadasz zu lernen, die Beste zu werden. Doch dafür würde ich mich in ein Haifischbecken stürzen müssen. In eine Klinik, in der jeder Fehler, jedes Zeichen von Schwäche das sofortige Ende meiner Karriere bedeuten konnte.
Wieder spannten sich meine Schultern an und spürte den leichten Druck auf meinen Kopf. Dieser Druck wurde in den letzten Tagen immer schlimmer, je näher der Montag kam.
Max räusperte sich und ich zuckte zusammen.
„Sollen wir besser nicht darüber reden?“, fragte er sanft.
Dankbar nickte ich. „Bitte lenk mich einfach ab.“ Meine Stimme war zu einem Quietschen geworden.
Er lachte leise und griff nach meiner Hand. Sofort legte sich das Zittern in mir ein wenig und ich atmete erleichtert auf. Dieses Date war eine gute Entscheidung. Max beugte sich vor und ich hielt unwillkürlich den Atem an, als er eine Haarsträhne hinter mein Ohr strich. „Schicke Frisur übrigens, kurz steht dir“, flüsterte er.
„Du hast es bemerkt“, sagte ich tonlos. Ein Hauch seines Aftershaves wehte mir entgegen.
Er nickte. „Natürlich. Allerdings sind die vielen kleinen Haare in deinem Ausschnitt auch ein guter Hinweis.“
Er lehnte sich zurück und ich starrte ihn entgeistert an. Dann wanderte mein Blick zu meinem Dekolleté. Oh nein. Entsetzt sprang ich auf und rannte zur Toilette. Tatsächlich hob sich mein schwarzer Pullover nur noch unmerklich von meiner Haut darunter ab. Er war über und über mit dunklen Härchen bedeckt. Verdammt. Ich versuchte, so viele wie möglich zu beseitigen, ohne mich einmal unter den Wasserhahn zu legen. Frustriert kehrte ich zu unserem Tisch zurück. Die geistreiche Erwiderung bezüglich seines Blicks in meinen Ausschnitt blieb mir im Hals stecken, als mir Max unaufgefordert ein Glas Wein entgegenhielt. Dankbar nahm ich einen großen Schluck und ließ mich neben ihn sinken.
„Sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Aber ich musste es dir irgendwie sagen.“
„Schon gut“, sagte ich und nahm einen weiteren Schluck.
„Sieht, wie gesagt, gut aus.“
Überrascht hob ich den Kopf und fand mich zugleich in Max’ Augen wieder. Sie wirkten so klar, so ehrlich, dass ich ihm glauben musste. „Danke.“
„Es ist nur die Wahrheit.“ Max winkte lässig ab.
Erneut griff ich nach dem Glas Wein vor mir und nahm einen großen Schluck. Ich hasste es, tollpatschig zu sein. Das passte nicht zu meinem neuen Image.
Max lachte und in seiner rechten Wange bildete sich ein kleines Grübchen. „Bin ich so schlimm?“
„Du hast ja keine Ahnung.“ Ich leerte mein Weinglas und stellte es klirrend auf dem Tisch ab.
Mit Fortschreiten des Abends wurde es immer lauter im Lokal, sodass wir notgedrungen näher zusammenrückten, um einander zu verstehen. Irgendwann lag Max’ Arm über meiner Stuhllehne und ich streifte hin und wieder sein Knie mit der Hand. Mir war heiß und das hatte nicht das Geringste mit der stickigen Luft im Restaurant zu tun. Als schließlich ein betrunkener Gast unseren Tisch rammte und mein „Ganz-sicher-das-letzte-Glas“ Wein umwarf, entschieden wir uns zu gehen. Wir wussten beide, was nun kommen würde, und so langsam wurde ich ungeduldig. Ich wollte endlich herausfinden, ob seine Lippen zu mehr taugten als nur zum Reden.
Kaum hatten wir gezahlt, zerrte ich ihn auch schon vom Stuhl. Max griff noch hastig nach seiner Jacke, da hatte ich ihn raus auf die Straße gezogen. „Endlich atmen.“ Ich seufzte zufrieden, während frische Luft durch meine Lungen strömte und ich mich mit ausgestreckten Armen im Kreis drehte.
Max erwiderte nichts. Stattdessen griff er nach meiner Hand und verschränkte seine Finger mit meinen. Ich blickte darauf und genoss die Wärme, die von ihm auf mich überströmte. Er hatte seine Lippen zu einem schelmischen Grinsen verzogen, doch sie waren noch zu weit entfernt, um sich jetzt gleich auf sie zu stürzen.
„Komm“, sagte er. „Lass uns ein wenig spazieren gehen. Ein bisschen ausnüchtern.“
Max führte mich entlang des gleichen Wegs, über den ich hergekommen war. Wo vorhin noch der Saxofonist gewesen war, fanden sich nun blanke Pflastersteine und einsame Fußgänger. Niemand beachtete uns, als wir entlang des Piers gingen. Neben uns plätscherte das Wasser des Chicago River in einem glitzrigen Schwarz vor sich hin. Während hier vorhin das blühende Leben geherrscht hatte, war jetzt nur noch die Erinnerung daran zurückgeblieben. Die hochaufragenden Gebäude am Rande des Piers tauchten die Stadt in bunte Lichter, die bis zu den Sternen reichten. Dennoch wirkten sie heute Nacht viel stiller als sonst. Als hätte man einen Schleier über den Fluss, die Straßen und Wolkenkratzer geworfen, der alle Geräusche dämpfte. Ich blieb stehen und betrachtete fasziniert den Tanz der Lichter auf der Wasseroberfläche. Max legte seine Arme um meine Taille. Er hatte genau die richtige Größe, um seinen Kopf auf meinem abzustützen. Ich genoss die Berührung und seine Wärme, die mich langsam einlullte.
„In welchem von denen arbeitest du?“
„Mhm?“
Ich hob meine Hand und deutete auf die leuchtenden Türme gegenüber von uns. „Der hier?“
Max brummte etwas Unverständliches und griff nach meinem Handgelenk. Er führte es ein Stück weiter nach rechts und verharrte.
„Der hier. Der Bluecordtower.“
„Wie ist die Aussicht von dort oben?“
„Anders. Aber nicht halb so schön wie jetzt.“
Ich unterdrückte ein sarkastisches Hüsteln. Das war selbst mir eine Spur zu klebrig.
„Mhm.“ Ich ließ den Arm sinken und starrte stattdessen in den Himmel. Das mochte ich so an Chicago. Es gab eine Unmenge an Wolkenkratzern und doch verbargen sie die Sicht auf den Himmel nicht. Nicht so wie in New York, wo man kaum den Wechsel der Tageszeiten mitbekam. Der Nachthimmel hier war mit Sternen übersät, die um die Wette funkelten und glitzerten.
„Das ist jetzt wirklich unrealistisch, schau dir den Himmel an. Diese Sterne sind einfach übertrieben. So viel Kitsch kann es nicht geben“, flüsterte ich.
„Ich kann es noch toppen, wenn du willst.“
Ich spürte, wie sich seine Brust in meinem Rücken langsam hob und senkte, seine Stimme war tiefer geworden.
„Wie willst du das schaffen?“
„Ich könnte dir versprechen, dir die Sterne vom Himmel zu holen“, erwiderte Max leise.
Ich überlegte, ein Kotzgeräusch zu mimen, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen. Denn irgendetwas geschah in diesem Moment mit mir. Mein Herz begann schneller zu schlagen, ich konnte es nicht verhindern. Max und ich, das sollte eigentlich nichts Ernstes werden. Es waren nicht seine Worte, sondern die Gefühle, die seine Umarmung in mir hervorrief. Sie rührten etwas, was ich so nicht erwartet hatte. Vielleicht lag es aber auch an dem Wein, der durch meine Adern floss.
„Da hättest du aber einiges zu tun“, sagte ich stattdessen und griff mit meinen Händen nach seinen. Seine Nähe fühlte sich richtig an.
„Stimmt“, sagte Max schlicht.
„Wie kommt es eigentlich, dass alle zu den Sternen aufblicken und von ihren Träumen reden, aber niemand die Hand ausstreckt, um nach ihnen zu greifen?“, fragte ich in die Stille hinein.
Max schwieg eine ganze Weile, als überlegte er tatsächlich und als wäre meine Frage nicht nur ein Ablenkungsmanöver, um mich enger an ihn zu schmiegen.
„Es wäre ungemütlich und äußerst anstrengend.“
„Ja. Aber träumst du nicht davon, etwas da oben zu verändern? Ob du einen Stern nimmst oder hinzufügst, ist doch einerlei. Hauptsache, du hinterlässt einen Abdruck da oben“, sagte ich.
„Das denke ich nicht. Wenn du den Menschen ihre Sterne nimmst, stiehlst du ihnen ihre Träume.“
„Und Träume sind etwas so Wunderbares“, fügte ich hinzu. Max hob seinen Kopf von meinem an und drehte mich in seinen Armen.
„Was sind deine Träume, Anna?“ Ehrliche Neugierde lag in seiner Frage und ich begriff, das hier war etwas Besonderes. Es war persönlich. Wie auch immer wir da hineingeraten waren, ich würde mich an diesen Moment mein Leben lang erinnern. Nicht unbedingt wegen Max, sondern der Wahrheit in meiner Antwort. Von dem Traum zu erzählen, der mich schon seit Jahren immer wieder verfolgte.
„In letzter Zeit träume ich vom Meer. Ich segle darauf durch die Stürme der Gezeiten. Durch Ebbe und Flut. Ich beherrsche es.“ Für einen Moment war es still, er sah mich nur an. Es war, als blickte er mir direkt in die Seele.
„Macht also“, sagte er.
Ich wusste nicht, ob er recht hatte. Aber wahrscheinlich war es genau das, was ich schon immer gewollt hatte. Erfolg, eine Karriere in der Chirurgie. War das wirklich alles? Ich verdrängte den Gedanken. Die Tatsache, dass die Chirurgie alles sein sollte, was ich wollte.
„Wovon träumst du denn?“ Ich wollte dieses unangenehme Gefühl loswerden, dass ich zu viel von mir offenbart hatte.
Er schwieg einen Moment, bevor er antwortete: „Von einer besseren Welt. Von Gerechtigkeit.“
Neugierig musterte ich ihn. „Das Ziel ist aber sehr hochgesteckt.“
Er lächelte. „Deswegen nennen wir es ja auch Träume. Sie sind wie die Sterne zu weit weg, um nach ihnen zu greifen.“
„Ja, aber versuchen können wir es.“ Und in diesen Moment hatte ich keine Angst mehr vor dem kommenden Montag. Ich war bereits dabei, nach den Sternen zu greifen. All die Jahre des Büffelns hatten mich auf diesen Moment vorbereitet. Meine Karriere im Chicago Med.
Wir standen noch eine sehr lange Zeit gemeinsam so da. Es war der perfekte Moment. Ich war dankbar, dass er meine Träume nicht infrage stellte. Dass er mich so akzeptierte.
Da strich eine Hand langsam über die nackte Haut unter meinem Pullover, glitt entlang meiner Taille und hinterließ ein Kribbeln auf meinem Körper. Hitze wallte in mir auf und zu dem Ziehen in meiner Brust gesellte sich ein Gefühl der Lust. Max ging mir eindeutig unter die Haut.
„Erzähl mir etwas über dich, was ich noch nicht weiß. Etwas Persönliches“, flüsterte Max in mein Ohr. Seine Stimme war tiefer geworden, irgendwie rauchig. Er löste seine Hand nicht von mir, sondern streichelte weiter sanft über meine Hüften. Ich unterdrückte ein Stöhnen und schloss die Augen.
„Mein richtiger Name ist Adriana Lucretia Rosso.“
Max prustete los und ohne nachzudenken reagierte ich. Sofort umklammerte ich ihn so fest, dass er kaum zu Atem kam. Sein Lachen verwandelte sich in ein Husten.
„Ich lasse dich hier ersticken, wenn du nicht aufhörst zu lachen.“ Das brachte ihn noch mehr zum Lachen und mit einer Leichtigkeit, die nicht hätte sein sollen, löste er sich aus meiner Umklammerung.
„Und genau deswegen erzähle ich das niemandem!“, rief ich.
Ohne Max’ Körper an mir war es kalt hier draußen. Allmählich beruhigte sich Max und versuchte einigermaßen ernst dreinzublicken.
„Meine Mutter war wohl etwas benebelt von der Narkose bei der Namensgebung. Das behauptet zumindest mein Vater; meine Mutter ist immer noch begeistert von diesem Namen. Sie ist auch die Einzige, die mich so nennt“, berichtete ich und schaute dabei etwas verlegen zu Boden.
„Ich finde den Namen gar nicht so schlimm“, sagte Max und tätschelte mir sanft die Schulter. „Wirklich nicht. Du hättest es schlimmer treffen können. Beispielsweise, wenn jeder um diesen Namen wüsste.“
Spielerisch boxte ich ihn gegen die Schulter. Doch Max fing meine Hand ab und zog mich wieder in seine Arme.
Dann starrte er mich mit funkelnden Augen an. Eine blonde Strähne fiel ihm wirr ins Gesicht. Ich griff danach und schob sie zu den anderen säuberlich angeordneten Haaren zurück. Meine Hand streifte seine Wange und ich spürte die raue Haut unter meinen Fingern. Max’ Augen verdunkelten sich und er zog mich nah an seine Brust. Seine Hände fühlten sich heiß durch den Stoff meines Pullovers an.
Mir blieb keine Zeit, weitere Fragen zu stellen, denn seine Lippen waren meinem Mund plötzlich ungewöhnlich nahe. Sie waren recht schmal, hatten aber einen einladenden Schwung. Wir würden uns jetzt küssen. Das war der Moment. Endlich.
Ein lautes Krachen und Hupen hallten von der Straße zu uns herüber. Erschrocken fuhren wir herum. Wie in Zeitlupe flog der Fahrradfahrer über die Motorhaube, prallte von ihr ab und landete auf der Straße, daneben die Überreste seines Fahrrads. Ich rannte los.
Kapitel II: Der Unfall
Als ich zwölf war, fuhr mein Vater mit mir zu einem Oldtimertreffen, um Ersatzteile für Helga zu kaufen. Helga war unser alter Opel Kadett, an dem er herumschraubte, seit ich denken konnte. Auf dem Weg zu dem Treffen gab es einen Autounfall. Eine Massenkarambolage, wie man heute sagen würde. Mindestens zehn Autos kollidierten miteinander. Wir waren die ersten Helfer vor Ort. Mein Vater verständigte den Rettungsdienst und stellte mich an den Straßenrand mit einer viel zu großen orangenen Warnweste. Überall herrschte Chaos. Er und einige andere eilten zu den verschiedenen Verkehrsopfern und versuchten, sie aus den Autos zu befreien. Ich stand nur da und sah zu. Dieses Gefühl, nutzlos zu sein, machte mir mehr Angst als die blutenden Menschen vor meinen Augen.
Ein Mann tauchte auf, er war Arzt. Binnen weniger Minuten ordnete er das Chaos – wie ein Dirigent, der aus krächzenden Instrumenten wunderbare Musik machte. Mich beachtete er nicht, aber ich beobachtete ihn die ganze Zeit. Im Gegensatz zu mir und all den anderen wusste er, was zu tun war. Von da an schwor ich mir, dass ich mich nie wieder hilflos fühlen wollte.
Der Fahrradfahrer lag seltsam verkrümmt auf dem Straßenboden und stöhnte. Entsetzt keuchte ich auf, spürte eine altbekannte Angst vor der Hilflosigkeit in mir aufwallen. Dann sah ich das Blut. Es tropfte auf den steinernen Asphalt. Dieser Anblick versetzte mich schlagartig in einen Zustand völliger Nüchternheit. Da war Blut, wo keins sein sollte. Damit kannte ich mich aus. Ich war Chirurgin, mit so etwas konnte ich umgehen. Ich kniete mich neben ihm nieder und sofort wurde meine Hose von einer warmen Flüssigkeit durchtränkt. Zu dem Geruch nach Eisen gesellte sich nun auch der Geruch von Urin. Sein Gesicht war schmerzverzerrt, die Augen hatte er fest zusammengekniffen, während ihm dunkle Rinnsale über die Stirn liefen. Der junge Mann wimmerte leise und das war gut. Es bedeutete, dass er lebte.
Der Autofahrer stolperte auf uns zu. Er hatte sich von dem Schock erholt, der ihn hinter dem Lenkrad gehalten hatte.
„Alles in Ordnung?“, fragte er.
Ich verkniff mir ein ironisches Lachen, denn nichts war in Ordnung, rein gar nichts. Ein Blick über die Schulter verriet mir, dass der Mann einigermaßen unverletzt geblieben war. Er hatte schließlich die gigantische Motorhaube seines SUVs als Schutz gehabt.
Der junge Mann vor mir hatte nicht einmal einen Fahrradhelm getragen. Sein Fahrrad lag mehrere Meter von uns entfernt, ein Haufen Schrott.
„Max, ruf einen Krankenwagen!“ Mein Befehl klang knapp und herrisch, aber für mehr hatte ich keine Zeit. Ich sah zu dem Autofahrer hoch: „Holen Sie Ihren Erste-Hilfe-Kasten oder die Box. Irgendetwas haben Sie ja sicher im Auto.“ Der Mann nickte und eilte davon.
„Wir rufen einen Krankenwagen, okay?“ Ich strich dem jungen Mann durch die Haare, tastete weiter entlang seines Hinterkopfes und spürte, wie meine Finger warm und klebrig wurden.
Scheiße. „Mein Name ist Anna Rosso, ich bin Ärztin. Ich werde dich jetzt untersuchen, okay?“
Der junge Mann nickte stöhnend und wandte den Kopf ab. Doch seine Atmung war flach und schnell. Vorsichtig tastete ich nach seinem Puls, tachykard, viel zu hoch.
„Bitte, sieh mich einmal an!“
Bitte, bitte lass es keine Hirnblutung sein, sondern nur eine oberflächliche Kopfplatzwunde. Wieso hatte er keinen Helm getragen? Dieser Idiot.
Der Mann bewegte sich nicht. „Wie heißt du?“, fragte ich. Nichts. Ich rüttelte an seiner Schulter und endlich reagierte er. Er wandte den Kopf und sah mich fast entrüstet an. Die Pupillen waren gleich groß, als ich sie mit meinem Handy beleuchtete und – er stöhnte wieder und krümmte sich zusammen, fasste sich an den Bauch.
„Das ist alles, was ich gefunden habe!“
Der Autofahrer hielt mir ein noch in Folie eingepacktes Erste-Hilfe-Täschchen hin. „Danke“, sagte ich knapp und riss die Folie von der Tasche. Eine goldene Rettungsdecke, einige Mullbinden und Pflaster. Handschuhe. Desinfektionsmittel, sonst nichts. Okay, wow. Da war nichts, was mir auch nur im Entferntesten helfen konnte.
„Die Polizei und der Krankenwagen sind unterwegs“, meldete Max, der plötzlich neben dem Autofahrer auftauchte.
„Könnt ihr die Unfallstelle sichern? Max, kannst du dich um ihn kümmern? Ich rufe dich, wenn ich dich brauche.“
Max nickte stumm und griff nach dem Arm des Autofahrers. Seinen panischen Blick konnte ich jetzt nicht gebrauchen, nicht wenn ich mich konzentrieren musste.
„Ich werde dich jetzt untersuchen, nicht erschrecken“, erklärte ich dem jungen Mann. Dieser reagierte nur mit einem leisen Stöhnen. Ich griff nach dem Kapuzenpullover, der erstaunlicherweise nichts abbekommen hatte, und zog ihn nach oben. „Fuck!“ Diesmal konnte ich mir den Fluch doch nicht verkneifen.
„Was ist?“, fragte Max.
„Nichts, alles gut!“, rief ich über die Schulter zurück. Dabei war gar nichts gut. Der Bauch war über und über mit roten Flecken und Schrammen bedeckt. Von der linken Flanke bis zum Rand seiner Jeans war fast die gesamte Haut abgeschmirgelt und blutete leicht. Doch die Haut war nicht das Problem. Das Problem lag darunter, da wo ich nicht hinblicken konnte. Ich strich vorsichtig über die Bauchdecke und der junge Mann schrie gequält auf. Die kurze Berührung reichte, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Er war hart. „Zieh die Beine leicht an, okay? Dann wird es mit den Schmerzen besser. So, genau“, leitete ich ihn an. Ich wollte die Beine bewegen, doch er schrie auf. Mein Blick wanderte weiter nach unten. Durch den Stoff seiner Jeans am linken Schienbein ragte mit ziemlicher Sicherheit ein Stück Knochen.
Zumindest der Rest seines Körpers schien unverletzt. Okay, viel war da nicht mehr übrig, was noch kaputt gehen konnte. Zumindest der Bruch war nicht lebensbedrohlich, die inneren Blutungen im Bauch allerdings schon.
Das war alles schön und gut zu wissen, half mir aber gerade nur sekundär. Schweiß trat mir auf die Stirn.
Akutes Abdomen. Schädelhirntrauma. Er brauchte eine Operation. Etwas, das ich auf offener Straße nicht leisten konnte. Wenn er instabil wurde, wäre ich handlungsunfähig. Keine Medikamente, kein OP. Da war es wieder – dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Ich hatte mir geschworen, es nie wieder zu spüren. Und doch war es da, schnürte mir den Atem ab. Es raubte mir die Kontrolle über die Situation. Was sollte ich tun? Ich blinzelte.
Blut! Es war mein Anker, der mich zurückbrachte, bevor ich panisch werden konnte. Rasch verband ich die Platzwunde am Kopf und wickelte den Mann in die goldene Decke. Dennoch fühlte ich mich nutzlos. Der junge Mann würde sterben, wenn der Notarzt nicht bald kam. Mein Atem beschleunigte sich wieder. Wieso dauerte das so lange? Das war nicht gut, ganz und gar nicht. Mit jeder Minute, die verstrich, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass er innerlich verblutete.
Sirenen. Endlich raste ein Krankenwagen auf uns zu. Ich atmete erleichtert auf. „Der Krankenwagen ist da. Sie geben dir etwas gegen die Schmerzen und dann kommst du ins Krankenhaus, okay?“
Der junge Mann nickte kaum merklich, er hatte die Augen immer noch zusammengekniffen.
Zwei Paramedics und ein Notarzt eilten auf uns zu. Sofort knieten sie sich neben mich und begannen den Mann zu untersuchen, legten ihm einige Zugänge in die Venen.
Ich stand auf. Meine Knie waren weich wie die Pannacotta, die ich vorhin noch verschlungen hatte, und ich zitterte am ganzen Körper. Der Notarzt stand vor mir. Seine orangene Uniform leuchtete im Licht der Straßenlaternen so grell, sodass ich die Augen zusammenkneifen musste. Er hielt mir eine Hand entgegen und stützte mich, als ich ins Straucheln geriet. Seine Hand war warm und jetzt erst bemerkte ich, wie nass und klamm ich war, durchtränkt von Urin und Blut.
„Alles in Ordnung?“, fragte der Notarzt. Wieso war er hier? Normalerweise blieben die Ärzte in der Klinik oder machte er eine Sonderausbildung?
Er starrte mich durch eine drahtige Brille besorgt an und ich nickte stumm. Zufrieden wollte er sich schon von mir abwenden, da krächzte ich. Eigentlich wollte ich ihm sagen, was ich bereits herausgefunden hatte, aber mein Körper wehrte sich dagegen. Es schien, als wäre all das Adrenalin von eben wie fortgewischt und nur noch eine leere Hülse aus Fleisch übrig. Ich hatte es geschafft und doch fühlte ich mich … leer. Schweiß trat mir auf die Stirn und das Zittern meiner Hände breitete sich auf meinen ganzen Körper aus.
„Was ist passiert? Alles in Ordnung?“
Der Notarzt wirkte plötzlich besorgter als zuvor. Er hielt mich offensichtlich für eins der Unfallopfer, sonst würde er mich nicht so eindringlich mustern. Dabei war das nicht mein Blut, sondern das Blut des Mannes vor mir. Blut. Ich blickte meine Hände an und gewann meine Fassung zurück.
„Wir haben den Unfall nur aus der Entfernung gesehen. Der Autofahrer hat ihn volle Kanne von der Seite erwischt, er ist vornüber von seinem Fahrrad gestürzt und über die Motorhaube gerollt, hat sich dabei sogar überschlagen. Atmung wirkt soweit frei. Er hat keinen Helm getragen und eine Kopfplatzwunde, Pupillen aber seitengleich. GCS zehn würde ich sagen. Das Problem ist der Bauch. Der Patient hat sicher innere Blutungen, sein Bauch ist bretthart und die Blase hat sich vollständig entleert.“ Ich beendete meinen Vortrag und begann sofort unkontrolliert zu zittern. War das eine Panikattacke? Ich hatte noch nie eine gehabt, doch so musste es sich anfühlen, oder? Angst verursachte eine Adrenalinausschüttung und jetzt hatte mein Körper eindeutig zu viel davon. Fight or Flight. Mein Zittern wurde stärker und Tränen bildeten sich in meinen Augenwinkeln. Ich war am Ende. Noch ein bisschen mehr und ich würde heulen wie ein Schlosshund. So war ich nun mal, bei Stress gingen meine Emotionen mit mir durch. Graue Augen blickten mich durch eine Brille aufmerksam an. Sie wirkten so ruhig im Gegensatz zu dem Sturm, der in mir tobte, bewahrten mich davor, völlig zusammenzubrechen. Die Augen und das Blut.
„Vom Fach?“, fragte der Notarzt.
„Morgen fange ich im Chicago Med an.“ Meine Stimme war zu einem Quieken verkommen und meine Beine drohten unter mir wegzubrechen. Unwillkürlich griff er nach meinem Arm, damit ich nicht stürzte.
Ein Grinsen breitete sich in seinem Gesicht aus. „Na, dann ist das ja der perfekte Einstieg. Ich bin Sebastian Holden. Keine Sorge, ich lass dich nicht fallen.“ Was war das denn für ein Machospruch?
Ruckartig zog ich meinen Arm zurück. „Anna Rosso und ich kann stehen, danke“, erwiderte ich bissig.
„Kein Grund, die Nerven zu verlieren, Anna. Du hast alles richtig gemacht. Am besten setzt du dich kurz hin, okay?“
Er legte mir eine Hand auf die Schulter und drückte sanft zu. Unwillkürlich verlangsamte sich mein Atem und Ruhe legte sich über mich. Sofort bereute ich meine unfreundlichen Worte ihm gegenüber. Er hatte es nur gut gemeint, weil er meine Angst gesehen hatte. Und genau diese Sache störte mich.
Er hatte meine Angst gesehen.
„Holden, kommst du jetzt mal helfen?“, rief eine der Paramedics.
„Ihr habt doch schon alles gemacht. Was soll ich da noch groß tun? Load and Go, Leute. Wir fahren schnellstmöglich in die Klinik, informiert den Schockraum. Für den Rest ist Zeit im Wagen.“
„Wir sehen uns, Anna. Danke für deine Hilfe.“ Er zwinkerte mir zu und wandte sich ab.
Binnen weniger Minuten hatten sie den Mann fortgetragen. Ich stand nur da, unfähig, mich zu bewegen, die Arme um mich geschlungen.
Max redete in der Ferne mit einem uniformierten Polizeibeamten. Er wirkte so sauber, während ich mit Dreck und Blut verschmiert war. Seine Hände waren rein und ich stank nach Urin.
Als hätte Max meinen Blick gespürt, wandte er sich zu mir um. Er sagte noch etwas zu dem Polizisten und kam danach auf mich zu. „Ist alles in Ordnung?“
„Ja, mir ist nur kalt.“
Er sah mich eindringlich an. Etwas Mitleidiges lag in seinem Blick, das mir nicht so recht gefiel.
„Keine Sorge, du hast es fast geschafft. Die Polizei will nur noch deine Kontaktinformationen und dir ein paar Fragen stellen.“
„Wo ist der Autofahrer?“
„Den haben sie in einem anderen Krankenwagen mitgenommen. Hast du es nicht mitbekommen?“
„Nein.“ Ich hatte ihn mir gar nicht genauer angesehen. „Ist er verletzt?“, fragte ich erschrocken.
„Ich denke nicht, sie wollen ihn nur sicherheitshalber durchchecken.“ Max legte mir eine Hand auf die Hüfte, zog sie aber zurück, als er die Feuchtigkeit bemerkte. Er rümpfte angewidert die Nase. „Komm, bringen wir es hinter uns. Du solltest dich baldmöglichst umziehen.“
Ich nickte und folgte ihm. Doch mein Aussehen war tatsächlich nicht meine größte Sorge. Ich hatte Panik bekommen. Es war eine Notfallsituation und ich war Ärztin. Das durfte nicht passieren.