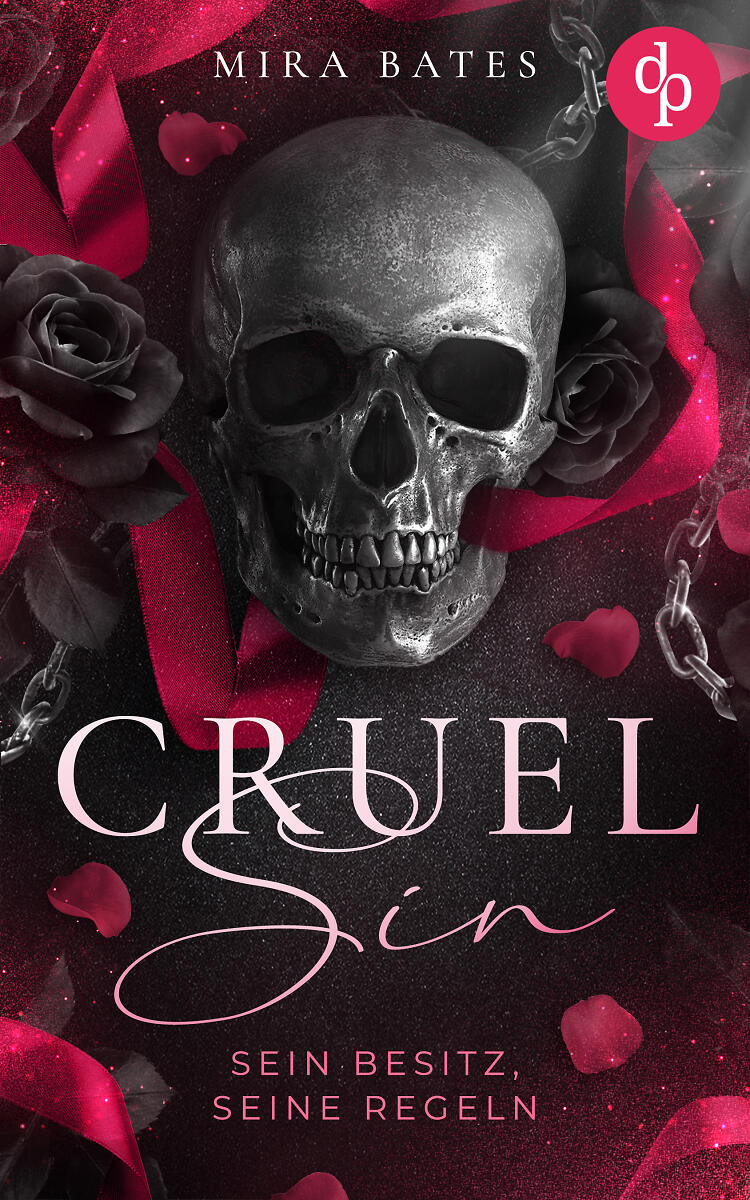1. Trapani
Georgia
Die Pistole liegt kühl und vertraut in meiner Hand, als ich sie hebe und auf die Scheibe ausrichte. Das Gewicht des Metalls ist wie ein Anker. In Momenten wie diesen, wenn ich den Atem anhalte und mich auf den schwarzen Punkt in der Mitte konzentriere, verspüre ich etwas, das ich an keinem anderen Ort finden kann: Ruhe. Kontrolle. Sicherheit.
Alles andere – die Sorgen, die ständige Ungewissheit über die Zukunft, die Schatten der Vergangenheit – verblasst in diesen wenigen Sekunden. Mein Puls verlangsamt sich, meine Hände werden ruhig und nur der Moment zählt.
Mit der jahrelangen Übung ist das Schießen für mich zu einer Art Meditation geworden, die mich zwingt, alles andere auszublenden. Die Angst, die Schuld und die Fragen, auf die es keine Antworten gibt.
Als ich abdrücke, zuckt die Waffe kaum in meiner Hand. Die Kugel durchschneidet die Luft, trifft punktgenau die Zehnermitte. Das Echo des Schusses hallt noch nach, als ich das winzige Einschussloch begutachte. Ein Volltreffer. Ein flüchtiger Moment, in dem ich nicht nur die Meisterin meines Könnens bin, sondern auch meines Lebens. Hier, auf dem Schießstand, verschwindet meine Angst. Ich lasse den Geruch von Schießpulver und verbranntem Metall in meine Lungen dringen. Die Beretta 92 liegt in meiner Hand – kalt, präzise, verlässlich. Anders als Menschen. Das Schießen ist meine Konstante, der einzige Anker in einer Welt aus Angst und Unsicherheit. Mit jeder Kugel, die ihr Ziel findet, weichen die Erinnerungen zurück. Zumindest für einen Moment.
Mein Atem geht schwer, aber meine Hände sind ruhig, als ich die Waffe ins Holster zurückgleiten lasse. Ein Ritual, das mir Halt gibt. Doch kaum ist der letzte Schuss verhallt, spüre ich, wie die Angst zurückkehrt. Wie ein dunkler Schleier legt sie sich über meine Gedanken, zieht mich hinab in jene Tiefen, vor denen ich so verzweifelt fliehe.
„Verdammt, Georgia! Du schaffst es immer wieder, uns alle zu deklassieren“, ruft Enrico, während er die Ergebnisse auf der Anzeigetafel studiert. Seine Bewunderung ist aufrichtig, macht es jedoch nur noch schwerer.
Ich zwinge mich zu einem Lächeln, doch innerlich gehe ich auf Abstand. „Danke!“, sage ich leise. Die Worte fühlen sich fremd an auf meiner Zunge.
Gewinnen sollte sich gut anfühlen. Aber für mich ist es nur eine weitere Bestätigung dessen, was ich tun muss, um zu überleben. Das Schießen ist keine Leidenschaft – es ist meine Verteidigung. Eine Sicherheit, die ich mir selbst geschaffen habe in einer Welt, in der Vertrauen tödlich sein kann.
„Hey, Georgia, kommst du mit zum Feiern?“ Enrico grinst breit, seine Augen leuchten vor Freude und etwas anderem, das ich nicht zulassen darf.
„Ich muss ins Restaurant“, sage ich und hasse mich dafür, wie leicht mir diese Lüge über die Lippen kommt. Seine Enttäuschung trifft mich. Aber die Wahrheit ist, dass ich ihm keine Hoffnung machen darf. Die Gefühle, die er sich wünscht, sind ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann.
Enrico nickt verständnisvoll, seine Augen werden weich. „Wenn du irgendetwas brauchst, lass es mich wissen.“
Ich nicke zurück, den Blick bewusst abgewandt. Worte wie diese sind gefährlich. Sie verlocken mit einer Nähe, die für mich zu riskant ist. „Danke, Enrico!“
Langsam wendet er sich ab, um sich den anderen anzuschließen. Seine Schritte hallen auf dem Schießstand wider, vermischen sich mit dem Echo der Schüsse, die noch immer in meinem Kopf nachhallen. Sein Weggang ist eine Erleichterung und ein Stich zugleich.
Ich schaue ihnen nach. Sie lachen und plaudern, als wäre diese kleine Feier das Wichtigste auf der Welt. Als gäbe es keine Schatten, keine verborgenen Abgründe. Francesca steht dort wie eine lebende Mauer, ihr Rücken eine einzige Ablehnung. Ich kenne diesen Anblick zu gut – die Art, wie sie ihre Schultern strafft, sobald ich den Raum betrete, als müsste sie sich gegen meine bloße Existenz wappnen.
Mein Lächeln verblasst. Francesca und die anderen werden nie verstehen, warum jeder Schuss, jede Übungsstunde über Leben und Tod entscheiden könnte. Wie soll ich ihnen erklären, dass das simple Geräusch einer zuschlagenden Tür ausreicht, um mich zurück zu jenem Tag zu katapultieren, als meine Welt in Scherben zerbrach? Nein, das Schießen ist kein Sport für mich – es ist meine Versicherung gegen die Hilflosigkeit, die ich nie wieder spüren will.
Mit mechanischen Bewegungen packe ich meine Sachen zusammen. Die Stimmen und das Lachen verblassen zu einem fernen Summen. Die kühle Brise vom Mittelmeer streicht über meine Haut, trägt den salzigen Geschmack der Freiheit, die mir nie gehören wird. Mein Blick wandert über die blühende Landschaft Siziliens – die verwitterten Trockensteinmauern, die sich windenden Olivenhaine, die sich wie ein graugrüner Teppich bis zum Horizont erstrecken. Es sieht, trotz der aufziehenden Wolken, so friedlich aus, wie ein Ort aus einer Welt, die nicht die meine sein kann.
Ich seufze und schüttle den Gedanken ab.
Mit schnellen Schritten eile ich zum Wagen meines Onkels und lasse mich hinter das Lenkrad sinken. Der vertraute Geruch von Leder umhüllt mich wie eine schützende Hülle.
Eine halbe Stunde später erreiche ich die schmalen Gassen der Altstadt. Die Straßen sind in der Abenddämmerung nur noch spärlich beleuchtet und der Wind hat merklich aufgefrischt. Ich ziehe die Jacke enger, doch die kühle Brise dringt durch meine schwarzen Hosen und durch die dünne graue Jacke. Der Himmel über mir ist dunkel und schwer, mit Wolken, die so dicht und drückend sind, dass es fast körperlich spürbar ist. Ein Spiegel meiner Seele, denke ich bitter und ziehe die Schultern hoch, als könnte die bloße Bewegung den Druck von meiner Brust nehmen. Onkel Tito ist tot, und alle glauben, dass ich das Restaurant erbe – als wäre es ein Geschenk und nicht der Ort, an dem ich jahrelang ohne Lohn geschuftet habe. Die Worte meines Onkels hallen noch immer in meinen Ohren nach: „Sei froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast und ich bereit bin, die Gefahr deiner Anwesenheit mitzutragen.“ Doch jetzt ist er fort, hat mich zurückgelassen mit nichts als Fragen und der lähmenden Angst, dass mir der einzige Zufluchtsort, den ich kenne, jederzeit genommen werden kann.
Der Kloß in meinem Inneren schwillt an. Die Markisen des Restaurants peitschen im auffrischenden Wind, als ich den Vorplatz erreiche.
Atmen, Georgia, atmen!
Ich husche durch den Eingang, und der vertraute Duft von Basilikum und Knoblauch empfängt mich. Für einen Moment schließe ich die Augen. Die schweren Holztische, die karierten Tischdecken, die Schwarz-Weiß-Fotos von Trapani an den terrakottafarbenen Wänden – all das gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Genau wie die Buchhaltung, die Bestellungen, die endlosen Rechnungen – ich klammere mich an diese Aufgaben wie an einen Rettungsring. Denn zwischen diesen vertrauten Wänden scheint die Welt noch in Ordnung. Nachts sitze ich allein im Restaurant, umgeben von einer Stille, die es sonst nie gibt, und stelle mir vor, wie es wäre, wenn dieser Ort mir gehörte. Doch mit dem Gedanken kommt die Angst. Was, wenn jemand herausfindet, dass ich nicht die bin, für die sie mich halten? „Die Monster schlafen nur“, höre ich die Stimme meines Onkels. „Ein falscher Schritt und sie wittern deine Spur.“ Seine Worte verfolgen mich, weil ich weiß, dass er recht hatte. Wer auch immer meine Familie getötet hat, ist wie ein Schatten – unsichtbar, aber immer da.
Das Klirren von Besteck, das leise Gemurmel der Gäste vermischt sich mit meinen kreisenden Gedanken. Am Tresen hackt Giancarlo Kräuter. Er lächelt mir warm zu.
„Alles in Ordnung, Georgia?“
Wenn er wüsste. Das Geld im Safe wird weniger, Tag für Tag. Onkel Titos Reserven – dicke Bündel, die er nur „Betriebskapital“ nannte – verschwinden. Sie rinnen mir durch die Finger wie Sand, während ich verzweifelt versuche, das Restaurant am Laufen zu halten. Es muss einfach weitergehen.
Die Stammgäste sitzen an ihren üblichen Plätzen, lachen, reden, als wäre die Welt noch in Ordnung.
„Ah, Bella Georgia! Komm, setz dich zu uns!“ Rico winkt mir zu, sein breites Grinsen ist so vertraut wie die Wände dieses Restaurants. Seine Herzlichkeit ist echt und das macht es nur noch schwerer.
Ich schüttele lächelnd den Kopf, spüre wie sich meine Gesichtsmuskeln dabei verkrampfen. „Ich habe noch einiges zu erledigen, bevor ich mich zu den Gästen gesellen kann.“
Das Lächeln hält, bis Giancarlo sich zu mir herüber lehnt, sein Gesicht wird plötzlich ernst. „Georgia, vorhin war ein Mann hier und hat nach dir gefragt.“
Der graue Nebel kriecht in meinen Kopf. Ich will darin verschwinden – weil er wenigstens vertraut ist. „Ein Mann?“ Die Worte kommen klar, während die Angst mich lähmt, meine Glieder bleischwer macht. Bitte lass es niemanden sein, der weiß, wer ich wirklich bin.
Giancarlo nickt langsam. „Er sah aus, als könnte er Ärger bedeuten. Er wollte keinen Namen nennen, aber er hatte diese … Aura an sich.“
Die Beschreibung ist vage, aber in Trapani ist das genug. Jeder hier weiß, wie die Mafia sich gibt und dass man besser keine Fragen stellt.
„Danke, Giancarlo!“ Meine Stimme klingt kontrolliert, eine dünne Fassade über dem Chaos in meinem Inneren. Der Nebel umhüllt mich wie ein schützender Kokon, während ich mir ausmale, wer dieser Mann sein könnte – und was er wollte.
„Ich hoffe, es ist nichts Ernstes.“ Giancarlos Blick ist mitfühlend, und für einen Moment wünsche ich mir, ich könnte ihm sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber ich möchte ihn nicht anlügen. Auch wenn die Vorstellung, dass die Mafia Interesse an unserem Restaurant haben könnte, absurd erscheint. Aber irgendetwas an Giancarlos Tonfall lässt die Unsicherheit in mir auflodern.
Es gibt nur eine Möglichkeit, meiner Angst zu entkommen: Ablenkung. „Giancarlo? Lass mich dir helfen. Buchhaltung ist gerade das Letzte, was ich brauche.“
Er mustert mich kurz und reicht mir dann nickend eine Schüssel. „Hier, du kannst den Salat anrichten.“
Erleichtert stelle ich mich an die Anrichte. Die mechanische Arbeit vertreibt den Nebel für einen Moment. Mein Blick wandert über die Zutaten: frische Kräuter, knackiges Gemüse, aromatische Gewürze. Die Farben und Texturen sind wie Anker in der Realität. Doch selbst jetzt, während meine Hände mechanisch die Arbeit verrichten, bleibt die Frage in meinem Kopf: Wer war dieser Mann? Und hat er nach Georgia Carbone gefragt, dem Namen, unter dem Giancarlo mich kennt? Ich versuche die Gedanken wegzuschieben, doch sie sind wie Schatten – immer da, egal wie hell das Licht im Ristorante auch scheint.
Als ich eine Handvoll Basilikumblätter zwischen den Fingern zerreibe, strömt mir der herbe, leicht pfeffrige Duft entgegen. Ich schließe die Augen, atme tief ein. Das Aroma lenkt mich ab und durchdringt die Sorgen in meinem Kopf wie ein Lichtstrahl. Manchmal frage ich mich, ob es mehr geben könnte als das hier. Mehr als Kontrolle, mehr als Sicherheit. Aber solche Gedanken sind gefährlich. Ich habe gelernt, sie wegzusperren – genau wie alles andere, das nach Leben schmeckt. Doch dann zerspringt der Moment. Die Eingangstür fliegt mit einem lauten Knall auf. Die Basilikumblätter gleiten aus meinen zitternden Fingern und ich erstarre.
Ein Mann betritt den Raum – und mit ihm eine Präsenz, die die Luft schwer werden lässt. Seine Gesichtszüge sind wie aus Marmor gemeißelt, hart und makellos. Die dunklen Locken, die ihm in die Augen fallen, werden von einer einzelnen silbernen Strähne durchbrochen – wie ein Riss in seiner sonst perfekten Fassade. Mit seiner düsteren Ausstrahlung und dem Silberstreifen erinnert er mich an einen Todesengel. Der schwarze Maßanzug unterstreicht seine dominante Präsenz, die gleichzeitig anziehend und abstoßend wirkt.
Alles in mir schreit, dass ich wegsehen, weglaufen sollte. Aber ich kann nicht.
Sein Blick trifft mich – hart, direkt, unerträglich klar. Und doch … da ist etwas in mir, das still wird. Wie der Moment vor einem Schuss. Ich kenne diese Ruhe. Sie kommt kurz vor dem Beben. Für den Bruchteil einer Sekunde zieht sich seine linke Augenbraue nach oben – eine minimale Bewegung, die seinen sonst undurchdringlichen Ausdruck durchbricht. Als hätte er in mir etwas erkannt, das er nicht erwartet hatte.
Die Gespräche verstummen und die Stille, die zurückbleibt, ist drückend. Alle scheinen die Gefahr zu spüren, die von ihm ausgeht, wie eine unsichtbare Kraft, die alle in ihren Bann zieht.
Ich merke, dass ich ihn anstarre, während er auf mich zukommt, und zwinge mich, die Fassade zu wahren. Meine Stimme zittert. „Tut mir leid, Signore“, sage ich und hoffe, dass meine Stimme fester klingt, als sie sich anfühlt. „Wir haben heute keinen Tisch mehr frei.“
Er lässt meine Worte im Nichts verpuffen, wie der letzte Windhauch vor dem Sturm. Sein Blick bleibt auf mir haften und ich starre wie hypnotisiert in seine Augen. Um seine dunklen Pupillen zieht sich ein schmaler Ring aus Gold, ein Sonnenstrahl in der absoluten Finsternis – fehl am Platz, wie er selbst. Etwas in mir spannt sich an. Ich sollte mich abwenden. Warum tue ich es nicht?
„Georgia Carbone?“ Er wechselt in ein bedrohliches Flüstern, dass nur meine Ohren erreicht. „Ich bin hier wegen des Schutzzolls.“ Sein Wissen um meinen Namen lässt den Nebel dichter werden, aber ich klammere mich an die Gegenwart. Draußen erklingt die Kirchenglocke von Santa Maria della Catena, während von der Küche das rhythmische Hacken von Marias Messer auf dem Schneidebrett verstummt – als spürte selbst sie die Gefahr, die den Raum erfüllt. „Mein Onkel ist gestorben“, presse ich schließlich hervor.
Er tritt näher. Sein Duft – Pinien mit einer Spur von dunklem Moschus – sticht mir in die Nase. Mein Körper zuckt zurück, will fliehen – und zugleich friert er ein, als würde er ihn festhalten wollen. Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen.
„Tito Carbone hat die Zahlungen bereits letzten Monat eingestellt. Ungehorsam wird nicht geduldet!“
Seine Drohung schneidet durch meine Erstarrung wie eine Klinge. Meine Hand wandert instinktiv zur Hüfte, sucht die vertraute Kälte des Metalls. Doch die Kälte der Waffe ist nichts gegen die Eiseskälte in seinen Augen. Die Schatten scheinen sich in ihnen zu sammeln. Und ich … verliere mich darin. Ich will handeln, will reagieren – doch in seinem Bann verpufft jeder Gedanke, als hätte er mich ausgelöscht, bevor ich mich überhaupt wehren kann. Doch bevor die Starre in mir mich völlig verschlingen kann, zerreißt ein Knall die Stille. Die Tür fliegt auf, ein zweiter Mann stürmt herein, Mordlust in den Augen, eine Waffe in seiner geballten Faust.
„Stirb, Bastardo!“ Seine Worte peitschen durch die Luft wie Schüsse, während er die Pistole auf den Mann vor mir richtet.
Die Zeit scheint stillzustehen. Der Lauf der Waffe, das fatale Zucken seines Fingers – und plötzlich schmilzt jede Barriere in mir weg. Mein Körper handelt in kristallklarer Präzision, völlig losgelöst von meinem Verstand. Die Pistole liegt in meiner Hand, als wäre sie dort geboren worden. Der Schuss bricht aus ihr hervor wie ein Donnerschlag. Der Angreifer schreit auf, seine getroffene Hand öffnet sich reflexartig, die Waffe klirrt auf die Fliesen. Der graue Nebel droht mich zu verschlingen, aber ich kämpfe mich zurück in die Realität. Der Mann vor mir bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die nur jahrelange Übung erklären kann. Seine Waffe erscheint in seiner Hand. Eine Umdrehung, zwei Schüsse zerreißen die Luft.
Als der Angreifer leblos zu Boden sinkt, flackert für einen Sekundenbruchteil ein anderes Bild vor meinen Augen auf – winzige Kinderfinger, die nach mir tasten. „Georgia?“ Eine Kinderstimme, kaum mehr als ein Flüstern in meinem Kopf. Dann ist sie wieder weg.
Der Todesengel betrachtet mich mit einem seltsamen Ausdruck. Seine linke Augenbraue hebt sich langsam, als würde er ein Rätsel betrachten, das er nicht ganz entschlüsseln kann. Hat er etwas gesehen? Ein Zucken, einen Moment der Schwäche?
Ich schlucke hart und zwinge mich, seinen Blick zu erwidern, während ich die Geister der Vergangenheit zurück in ihre dunklen Ecken dränge.
„Du hast eine erstaunlich ruhige Hand“, sagt er, seine Stimme samtweich und bedrohlich zugleich. „Für jemanden, der vorgibt, nur eine Restaurantbesitzerin zu sein.“
Mein Atem ist flach, mein Herz rast – doch mein Körper ist wie eingefroren.
„Der Schutzzoll“, fährt er fort, sein Blick bohrt sich in mich wie eine Klinge, „wird ab morgen verdoppelt. Und du, Georgia, wirst pünktlich zahlen!“
„Verdoppelt?“ Mein Flüstern ist kaum hörbar. Der Schleier in meinem Kopf verdichtet sich.
„Das ist unmöglich! Das Restaurant … wir können nicht einmal die jetzigen Zahlungen stemmen.“
Er macht einen Schritt auf mich zu und ich spüre, wie mein Rücken gegen die Anrichte stößt. Seine Hand hebt sich und für einen Moment denke ich, er will nach mir greifen. Stattdessen streicht sein Zeigefinger wie in Trance über die silberne Strähne in seinem dunklen Haar. Für den Bruchteil einer Sekunde verändert sich sein Blick, wird abwesend, als wäre er plötzlich an einem anderen Ort. Dann kehrt die Kälte in seine Augen zurück.
„Unmöglich?“ Seine Stimme ist samtweich. „Du hast gerade bewiesen, dass du Talent hast, Georgia. Jemand mit solch einer ruhigen Hand findet sicher auch … kreative Lösungen für finanzielle Probleme.“
Die Implikation seiner Worte trifft mich wie ein Schlag. „Ich bin keine …“
„Keine was?“, unterbricht er mich, sein Blick bohrt sich in meinen. „Kriminelle? Mörderin? Du hast soeben auf einen Mann geschossen.“
„Ich habe Ihnen gerade das Leben gerettet, nur um dann zu sehen, wie Sie jemanden kaltblütig erschießen! Und jetzt soll ich einfach weitermachen wie zuvor?“ Die Worte kommen fast lautlos über die Lippen, während die Angst sich wie eine Schlinge um meinen Hals legt.
Der Mann zögert einen Moment, tritt dann einen Schritt auf mich zu. Seine Hand hebt sich und er streicht mit seinem rauen Daumen über meine Wange. Es ist eine seltsame, fast zärtliche Geste, die mich augenblicklich verstummen lässt. Nicht aus Vertrauen, sondern weil ich nicht weiß, wie ich das ertragen soll.
„Du hast geschossen.“ Seine Stimme ist sanft, beinahe beruhigend, doch die Worte tragen eine tödliche Wahrheit in sich.
„Ich bin Restaurantbesitzerin“, presse ich hervor, „nichts weiter.“
Er betrachtet mich mit einem Blick, der unter meine Haut zu dringen scheint. „Und doch hast du geschossen wie jemand, der weiß, was er tut.“ Seine Stimme senkt sich zu einem Flüstern. „Talent verschwendet man nicht, Georgia. Nicht in Sizilien.“
„Wer … wer sind Sie?“, flüstere ich, meine Stimme bricht fast.
Sein Blick bleibt unverändert, ungerührt, während er mich mustert. „Ich bin Luca Ombriani.“ Er spricht seinen Namen aus, als wäre er eine unausweichliche Wahrheit, eine dunkle Prophezeiung, die sich in diesem Moment erfüllt.
Ohne ein weiteres Wort wendet er sich dem leblosen Körper zu, packt ihn unter den Armen und schleift ihn mit erschreckender Gelassenheit zur Hintertür. Seine Bewegungen sind präzise, mechanisch, als hätte er dies schon unzählige Male getan. Er bleibt stehen, dreht sich langsam zu mir um, die Leiche immer noch unter den Armen geklemmt. „Es gibt Instinkte, die man nicht lernt“, sagt er unvermittelt, während er den Körper weiterhin hält. „Sie schlummern in uns, bis der richtige Moment kommt.“ Seine Augen verengen sich leicht, als versuchte er ein Rätsel zu lösen. „Du bist eine Überraschung, Georgia Carbone. Und ich mag keine Überraschungen.“ Er betrachtet meine zitternden Hände mit kühler Präzision. „Zumindest keine, die ich nicht vorhersehen kann.“ Dann ist er verschwunden wie ein Geist, verschluckt von den Schatten der Nacht.
Ich brauche einen Moment, um Luft zu holen. Einen Moment, in dem die Welt stillsteht. Die Ruhe im Restaurant ist voller unausgesprochener Worte und Blicke, die auf mich gerichtet sind. Die Gäste sind verstummt und selbst Giancarlo sagt nichts. Kein Lächeln, keine Gespräche, nur Schweigen, das auf mir lastet wie ein Stein. Sie alle wissen es. Das Blut. Der Schuss. Ich wische mir mit der Hand über die Stirn, spüre die kalte Feuchtigkeit meiner Haut. Ich bin verloren tief in mir – in der vertrauten Betäubung, an einem Ort, an dem ich nicht weiß, ob ich jemals wieder zurückfinde. Mein Blick huscht zur Küchentür. Maria. Sie ist die Einzige, die mir helfen kann. Die ehrlich mit mir spricht, mir vielleicht einen Rat geben kann, wie ich die Kraft finde, um weiterzumachen.
2. Blutsbande
Georgia
Ich drücke die schwere Tür zur Küche auf und sofort schlägt mir Wärme entgegen. Der Duft von geschmortem Knoblauch, Tomaten und frischen Kräutern füllt die Luft, doch selbst diese vertrauten Gerüche werden von dem grauen Nebel verschluckt, der sich wie ein Schleier über meine Sinne legt. Er verdichtet sich mit jedem Schritt, bis die Küche vor meinen Augen zu verschwimmen beginnt. Doch irgendwo dahinter ist Maria und mit ihr vielleicht ein Weg zurück.
Maria steht am Herd. Ihre schmalen Schultern sind wie immer leicht nach vorne gebeugt, ihr dunkles Haar zu einem festen Dutt gebunden. Ihre Hände sind ruhig und sicher, während sie den Holzlöffel durch die dickflüssige Sauce zieht. In ihrer Küche scheint die Welt da draußen nicht zu existieren.
Ich schließe die Tür hinter mir und der Raum scheint enger zu werden. Die Wärme, die ich sonst als tröstlich empfand, ist erdrückend.
„Maria.“ Meine Stimme bricht, obwohl ich versuche, sie festzuhalten.
Sie dreht sich nicht sofort um, rührt weiter in der Sauce, doch schließlich legt sie den Löffel beiseite und sieht mich an. In ihren dunklen Augen liegt eine Schärfe, die mich trifft. „Du kannst nicht zur Ruhe kommen?“ Ihre Stimme ist fast tonlos.
Ich schüttle den Kopf, unfähig, etwas zu sagen. Mein Herz schlägt schneller und meine Hände zittern, als ich sie in die Taschen meiner Jacke stecke. „Es fühlt sich an, als würde es immer noch passieren.“
Sie nickt langsam, als würde sie mich verstehen, aber ihre Augen bleiben ernst. „Natürlich fühlt es sich so an. Du hast geschossen, Georgia. Du hast einen Mann fast getötet. Das vergisst niemand so schnell – vor allem du selbst nicht.“
„Ich hatte keine Wahl.“ Die Worte kommen beinahe panisch und sie klingen hohl. Ich will sie glauben, aber ein Teil von mir fragt sich, ob das wirklich stimmt. „Er hätte diesen Luca umgebracht. Ich musste etwas tun.“
Maria tritt näher, ihre Hände ruhen jetzt auf der Arbeitsplatte. „Du hast das Richtige getan.“ Sie hält inne, als müsste sie die nächsten Worte sorgfältig wählen. „Aber das bedeutet nicht, dass es vorbei ist.“
Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren, während Maria spricht. Meine Fingernägel graben sich in die Handflächen und ich schmecke Blut, wo ich mir auf die Innenseite meiner Wange gebissen habe. „Was meinst du damit?“
„Es war Notwehr, ja. Aber du weißt, wie diese Leute sind, Georgia.“ Sie seufzt leise, als könnte sie die Worte nicht länger zurückhalten. „Sie vergessen nicht. Und sie vergeben nicht.“
Ich schlucke schwer und senke den Blick. Die Hitze in der Küche fühlt sich plötzlich stickig an, wie ein Mantel, der zu eng geworden ist. „Ich will einfach nur …“ Meine Stimme bricht und ich presse die Lippen zusammen. Ich weiß nicht einmal, was ich will. Ruhe? Frieden? Ein Leben, das nicht von dieser Dunkelheit überschattet wird?
Maria legt mir eine Hand auf den Arm, ihr Griff ist fest, fast beruhigend. „Hör zu, Georgia! Du kannst nicht einfach hoffen, dass alles wieder normal wird. Du musst wissen, worauf du dich einlässt.“
Ich sehe sie an, spüre die Panik, die sich in meinem Brustkorb ausbreitet. „Ich habe keine Wahl, oder?“ Die Worte klingen verzweifelt, fast wie eine Bitte um Bestätigung.
„Es gibt immer eine Wahl“, sagt Maria leise. Doch dann senkt sie den Blick und ich merke, dass sie sich selbst nicht sicher ist. „Aber manchmal sind alle Optionen schlecht.“
Ich schüttle den Kopf, versuche, die drohende Verzweiflung abzuschütteln. „So, wie für dich und Matteo?“ Die Worte rutschen mir heraus, bevor ich darüber nachdenken kann. Ich weiß, dass sie schmerzhaft sind, aber ich muss es wissen. „Er arbeitet doch jetzt für sie, oder?“
Marias Gesicht verändert sich, ihre Augen werden dunkler. Sie sieht für einen Moment älter aus, als hätte sie die Last der Jahre in einem einzigen Atemzug eingeholt. „Ja.“ Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. „Matteo ist einer von ihnen. Jetzt.“
„Könnte er …“ Ich halte inne, unsicher, ob ich den Gedanken zu Ende bringen will. „Könnte er helfen und dafür sorgen, dass sie mich in Ruhe lassen?“
Maria schüttelt heftig den Kopf, als hätte ich eine Grenze überschritten. „Nein, Georgia! Matteo ist nicht mehr derselbe. Wenn du ihn um Hilfe bittest, ziehst du dich nur noch tiefer rein.“
„Aber er war immer hier, Maria.“ Ich versuche, meine Stimme ruhig zu halten, doch sie zittert. „Er hat hier gearbeitet. Wir haben zusammen gelacht. Das Restaurant war wie eine Familie.“
„Jetzt gehört er zu ihnen!“ Ihre Stimme ist lauter, schneidet durch die warme Luft der Küche. Sie sieht mich an, und in ihren Augen liegt etwas, das ich nicht deuten kann – Trauer, vielleicht Wut. „Und wenn du nicht aufpasst, Georgia, wirst du auch ihnen gehören.“
Ihre Worte sind wie ein Schlag in die Magengrube. Ich nehme einen zittrigen Atemzug, spüre, wie die Realität mich einholt. Die Bilder kommen zurück: der Angreifer, die Pistole in meiner Hand, das Gewicht des Abzugs, der Rückstoß. Und Luca, wie er mich angesehen hat. Nicht mit Schock oder Entsetzen, sondern irgendwie anders. Seine linke Braue hob sich, als hätte er gesehen, dass ich zu etwas fähig bin, das er nicht erwartet hat.
„Ich will nicht, dass das mein Leben wird.“ Meine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern.
„Dann findest du einen Weg, dich zu schützen, ohne noch tiefer in ihre Welt zu geraten.“ Maria tritt zurück zum Herd, nimmt den Löffel wieder in die Hand und rührt die Sauce um, als wäre das Gespräch vorbei. „Aber sei vorsichtig, Georgia! Ein falscher Schritt und du bist verloren.“
Ich bleibe einen Moment lang stehen, spüre, wie die Worte in mir nachhallen. Dann drehe ich mich um und verlasse die Küche. Der Nebel kehrt zurück, dichter als zuvor. Ich spüre, wie er sich um meine Gedanken legt. Während ich die Küchentür hinter mir schließe, verfolgt mich Marias Blick. Ihre letzten Worte – „Ein falscher Schritt und du bist verloren.“ – hallen in meinem Kopf wider.
3. Blut und Verantwortung
Luca
Der Motor meines Wagens brummt durch die Nacht. Gerettet. Von einer verdammten Frau. Die Erinnerung brennt wie Säure in meinem Stolz.
Meine Fingerknöchel treten weiß hervor am Lenkrad. Die erste Lektion des Don: Schwäche ist tödlich. Die zweite: Nichts überleben lassen, was dich in Gefahr bringen könnte. Und jetzt existiert da draußen eine Kellnerin, die mich wie ein hilfloses Kind gerettet hat.
Trapani verschwimmt zu einem bedeutungslosen Lichtermeer, während die Dunkelheit in mir wächst. Ich sehe sie vor mir – wie sie zurückgewichen ist, wie ihr Puls an ihrem schlanken Hals geflattert hat. Wie ihre blauen Augen mich gesehen haben, in einem Moment, den es nie hätte geben dürfen. „Ich bin kein Straßenköter mehr!“, knurre ich in die Stille des Wagens. Die Worte sind ein Schwur, geschärft an meiner Wut. Ich bin der Erbe, der nächste Ombriani Don. Und sie? Sie ist ein Problem, eine Erinnerung, die ausgelöscht werden muss.
Das Anwesen der Ombrianis erhebt sich vor mir wie eine Festung. Die schweren Eisentore gleiten auf, erkennen den Zugangscode meines Fahrzeugs. Anders als die alten Ombrianis verlasse ich mich nicht nur auf Loyalität, sondern auch auf Technologie.
Als ich kurze Zeit später die Treppe hinaufsteige, höre ich das Echo vergangener Schritte. Ich war sieben, als der Don mich zum ersten Mal hierherbrachte. „Sieh dich gut um, Luca“, hatte er gesagt, seine Hand lag schwer auf meiner Schulter. „Dies alles wurde mit Blut und Entschlossenheit aufgebaut, nicht mit Gnade.“ Damals verstand ich nicht, dass es keine Einladung war, sondern ein Urteil. Jetzt, mit jedem Schritt, spüre ich das Gewicht der Erwartungen. Die Familie steht über allem. Sogar über mir selbst.
Die Wachen stehen stramm, als wäre dies ein Tag wie jeder andere. Wenn sie wüssten, welcher Sturm in mir tobt, würden sie angsterfüllt zurückweichen. Doch ich lasse nichts nach außen. Ich bin nicht hier, um Trost zu suchen. Ich gehe vorbei an den Ölgemälden der alten Ombrianis – Männer mit finsteren Gesichtern und Augen, die mich verfolgen, als könnten sie die Dunkelheit in mir erkennen. Sie haben ihr Imperium auf Blut aufgebaut, genau wie ich es tun werde.
Gleich werde ich mit Vincenzo sprechen. Er erwartet Ehrlichkeit – und ich werde sie ihm geben. Nicht aus Schuld. Sondern aus Pflicht. Raffaele ist tot. Ich habe ihn erschossen. Er hätte mich getötet. Vielleicht hätte er es geschafft – wäre da nicht Georgias Schuss gewesen. Sie verschaffte mir die Sekunden, die ich brauchte.
Und ich weiß nicht, was mich mehr wütend macht: dass ich beinahe gefallen wäre. Oder dass ich es nicht früher erkannt habe. Ich habe mit Falschgeld bezahlt. Ohne es zu wissen. Raffaele hat mir die Lieferung übergeben – ohne ein Wort. Vielleicht war genau das sein Plan: mich zum Risiko für mein eigenes Haus zu machen.
Ich habe nicht im Kampf versagt. Nicht mit der Waffe. Sondern da, wo es zählt: in der Verantwortung. Und doch – warum wollte er mich dann töten? Was, wenn es nicht nur um Schande ging? Was, wenn sie den Nachfolger der Ombrianis auslöschen wollten?
Heute Nacht bin ich beinahe gefallen – nicht, weil ich schwach war. Sondern weil ich zu spät erkannt habe, wer das Messer in der Hand hielt.
Die Tür zum Arbeitszimmer steht offen. Don Vincenzo thront hinter seinem massiven Schreibtisch, das Gesicht halb im Schatten der Tischlampe verborgen. Das silberne Haar ist akkurat zurückgekämmt und der maßgeschneiderte Anzug sitzt tadellos auf seinen breiten Schultern. Seine Hände, gezeichnet von feinen Altersflecken, ruhen ruhig auf der Tischplatte – Hände, die mühelos ein Todesurteil unterschreiben.
„Luca.“ Sein Tonfall ist ruhig, kontrolliert. Immer. Er ist ein Mann, der nie ein Wort zu viel sagt, jemand, der den Raum allein durch seine Anwesenheit beherrscht.
Ich trete ein, richte mich auf und halte seinem Blick stand. „Raffaele Zacchetti ist tot“, sage ich direkt, meine Stimme fest, fast herausfordernd. Keine Umschweife. Keine Erklärungen. Ich will sehen, wie er reagiert – ob sich ein Hauch von Zustimmung in seinem harten Gesicht zeigt oder ob der eiserne Blick bleibt.
Er schweigt für einen Moment, bevor er sich leicht nach vorne beugt, die Finger seiner Hände verschränkt. „Und warum, Luca?“ Seine Stimme bleibt ruhig, aber der Stahl darin ist unüberhörbar. „War das notwendig? Oder war es impulsiv?“
Das Wort „impulsiv“ trifft mich, wie er es beabsichtigt hat. Eine Erinnerung daran, was ich war, bevor er mich formte – ein wilder Köter, ein Niemand, den er aus der Gosse gezogen hat.
„Ich habe einen Gegner eliminiert, der bereit war, meinen Tod zu besiegeln.“
Sein Blick bleibt auf mir haften, durchdringt mich, als würde er nach einer Schwäche suchen, nach einem Fehler. Mein Kiefer spannt sich an, aber ich lasse nicht zu, dass meine Haltung nachlässt.
„Und jetzt? Was denkst du, wird passieren?“, fragt er schließlich.
Die Stille dehnt sich aus, unerbittlich und schwer. Ich spüre das Gewicht seines Urteils in meinem Nacken, wie ein Schatten, der nie ganz von mir abfällt. Ich mache einen Schritt vorwärts, meine Hände zu Fäusten geballt. „Er wollte unseren Namen beschmutzen. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen – wir sind keine Beute.“ Meine Worte hängen in der Luft und ich weiß, dass dies der Moment ist, der zählt. Es ist immer ein Test mit ihm. Alles.
Sein Gesicht bleibt undurchdringlich, doch ich sehe, wie seine Augen sich leicht verengen. Er lehnt sich langsam zurück und seine Finger lösen sich, während er mich weiter ansieht.
„Du hast getan, was getan werden musste.“ Seine Worte sind neutral, fast emotionslos. „Aber der Preis dafür wird hoch sein.“
Ich nicke knapp. „Ich bin bereit, ihn zu zahlen.“
Seine Augen bleiben auf mir, als wolle er mich erneut prüfen, mich wie eine Schachfigur analysieren, bevor er sie bewegt. Schließlich spricht er und seine Stimme hat einen scharfen Unterton: „Das hoffe ich, Luca. Denn jetzt gibt es keinen Raum für Fehler. Der Name Ombriani wird nur dann Respekt einflößen, wenn du die Kontrolle behältst. Keine Ausbrüche. Keine impulsiven Taten.“
Er lehnt sich vor und seine Augen werden dunkler, härter. „Du bist mein Nachfolger. Und die Welt muss das wissen – ob du es willst oder nicht.“
Ich höre die Worte und spüre dahinter das, was er nicht sagt. Er hat mich geformt, mich zu dem gemacht, was ich bin. Nicht aus Liebe. Nicht aus Fürsorge. Sondern, weil er einen Erben brauchte, der stark genug ist, sein Vermächtnis zu tragen.
„Ich werde das Erbe schützen!“, sage ich und meine Worte sind mehr eine Herausforderung als ein Versprechen.
„Gut.“ Er nickt knapp. „Es gibt noch etwas anderes. Das Falschgeld.“ Seine Stimme klingt müde, aber die Wut darunter ist unverkennbar. „Vito hat die Scheine extrahiert. Wir haben unwissentlich damit bezahlt.“
Ich verstehe sofort die Tragweite. In unserer Welt gibt es keine schwerere Beleidigung. Die Anschuldigungen gegen uns stimmen. Wir sind Verräter.
„Die anderen Familien distanzieren sich bereits. Sie denken, wir hätten sie betrogen.“ Sein Blick durchbohrt mich. „Finde den Fälscher, Luca, und bring ihn zu mir! Der Name Ombriani muss reingewaschen werden!“ Es ist kein Befehl mehr - es ist ein Vermächtnis, das er mir auferlegt.
Ich spüre das Gewicht der Verantwortung darin. „Ich werde ihn finden!“, verspreche ich. Nicht für Don Vincenzo. Für mich. Der Name Ombriani war das Erste, was mir je gehörte. Der Don gab mir nicht nur einen Platz zum Schlafen und eine Waffe in die Hand – Er gab mir eine Identität. Das vergisst man nicht, egal wie hoch der Preis dafür ist.
„Ruf Enzo und Vito zusammen. Wir müssen uns vorbereiten. Und Luca …!“
Ich bleibe stehen, drehe mich nicht um. Schwäche ist das Letzte, was ich zeigen darf – vor ihm, vor mir selbst.
Ein leises Geräusch unterbricht die Spannung im Raum. Die schwere Tür öffnet sich langsam und Isabella tritt ein – wie ein Lichtstrahl, der nicht fragt, ob er willkommen ist. Der einfach bricht, wo alles fest war.
Ihr weißes Nachthemd fällt locker um ihre zierliche Gestalt. Sie wirkt verletzlich. Zerbrechlich sogar. Aber in ihren Bewegungen liegt eine Ruhe, die gefährlicher ist als jede Waffe. Sie ist so fehl am Platz hier, ein leuchtender Fleck in einer Welt, die von Schatten verschlungen wurde. Ihr Blick sucht mich, ihre großen braunen Augen leuchten und ich sehe etwas darin, das mich trifft: Freude.
„Luca!“ Ihr Tonfall ist warm und bevor ich reagieren kann, überwindet sie die Distanz zwischen uns. Ihre Arme schlingen sich um meinen Nacken und sie drückt sich an mich, als wäre ich ihr einziger Halt in einer Welt, die sie nicht wirklich verstehen kann.
Für einen Moment zieht sie mich aus meinem Chaos. Die Dunkelheit, die sonst in mir brodelt, weicht für einen winzigen Augenblick zurück. Isabella ist das Herz dieses Hauses, der letzte reine Teil, den diese Welt noch nicht verschlungen hat. Sie ist das, was ich nie sein werde: unberührt, unschuldig. Und ich habe geschworen, sie zu beschützen – bedingungslos, ohne zu zögern.
Ich bin das Monster, das an ihrer Seite bleibt, um sicherzustellen, dass sie überleben wird.
Ich umarme sie kurz, schiebe sie dann sanft von mir weg, meine Hände auf ihren Schultern. „Isabella, du solltest nicht einfach so hereinkommen“, sage ich ruhig, doch ein Hauch von Strenge schwingt in meiner Stimme mit.
Sie tritt einen Schritt zurück, lässt sich jedoch nicht einschüchtern. Ihre Hände stützen sich in die Hüften und ein vertrauter Ausdruck des Trotzes liegt auf ihrem Gesicht. „Ach, sei still, Luca!“, sagt sie, ihre Stimme voller Entschlossenheit. „Ich ersticke noch in diesem goldenen Käfig! Wann darf ich endlich raus und die Welt sehen?“
Bevor ich antworten kann, unterbricht ihr Vater sie. Er hebt eine Hand – ein Akt, der sofort Stille einfordert.
Isabella hält inne, senkt die Arme und steht plötzlich wie erstarrt da. Ihre Augen weiten sich und ich sehe den Respekt – oder die Angst –, die er immer noch in ihr hervorruft.
„Morgen ist dein 18. Geburtstag, Isabella.“ Seine tiefe Stimme ist durchdringend.
Isabella senkt den Blick und ich beobachte, wie sich ihre Haltung verändert. Ihre selbstbewusste Fassade bröckelt nur ein wenig und das Funkeln in ihren Augen wird gedämpft von etwas, das wie Unsicherheit aussieht. Sie wirkt plötzlich jünger, verletzlicher, als sie leise murmelt: „Ja, Vater.“ Ein Seufzen entweicht ihren Lippen, doch dann hebt sie den Kopf wieder. Ihre Stimme ist ruhig, aber ein Zittern darin verrät sie. „Und du hast versprochen, mir die Wahrheit über meine Mutter zu erzählen.“
Ihre Worte hängen schwer im Raum und für einen Moment ist es viel zu still.
Vincenzo sieht sie lange an. Dann nickt er, langsam, bedächtig. Aber ich bemerke einen winzigen Bruch in seiner Fassade, kaum wahrnehmbar, doch für jemanden wie mich, der ihn sein ganzes Leben lang studiert hat, offensichtlich. Ein Schatten huscht über sein Gesicht, ein Schmerz, den er sonst verborgen hält. Der große Don hat also doch eine wunde Stelle. Interessant.
„Ja!“, sagt er schließlich, seine Stimme rau. „An deinem Geburtstag wirst du die Wahrheit erfahren.“
Isabella nickt, ihre Schultern sacken leicht nach unten, als würde sie eine Last ablegen – oder sich auf eine noch größere vorbereiten. Sie wirft mir einen kurzen Blick zu und ich sehe darin Unsicherheit. Sie sucht nach … was? Unterstützung? Bestätigung? Sie wird lernen müssen, dass in unserer Welt niemand solche Dinge anbietet. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Schutz zu geben ist meine Aufgabe, dafür wurde ich geformt. Als sie den Raum verlässt, erhasche ich einen flüchtigen Blick auf die Narbe an ihrem Handgelenk. Ein Unfall aus Kindertagen, als ich zu langsam war, um sie aufzufangen. Ich berühre unbewusst die Stelle an meiner Rippe, wo die Strafe dafür noch immer spürbar ist. Manche Fehler passieren nur einmal. Isabella wird überleben, nicht weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil ich genau weiß, was es bedeutet, in dieser Familie zu versagen.
Vincenzo wendet sich mir zu, seine Augen kalt und durchdringend. „Du warst nicht dabei“, sagt er leise, fast zu sich selbst. „Damals.“
Ich halte seinem Blick stand, regungslos. „Nein, Don!“
„Gut.“ Er greift nach seinem Glas, nimmt einen langen Schluck. „Manche Geschichten sollten besser begraben bleiben.“
Ich antworte nicht. In diesem Haus sprechen die Wände, und Schweigen ist oft die klügste Antwort. Was auch immer mit Isabellas Mutter geschehen ist – es ist ein Geheimnis, das selbst den Don verfolgt. Ich frage mich flüchtig, was diese Wahrheit mit Isabella machen wird. Ob sie stark genug ist. Ob es irgendetwas ändern wird. Nicht, dass es mich kümmern sollte. Gefühle sind Luxus, den ich mir nicht leiste. Und doch …
„Luca.“ Vincenzos Stimme reißt mich aus meinen Gedanken, seine Augen hart und kalt wie immer. „Jetzt geh, Luca!“, sagt er, ein klarer Befehl. „Vereinbare das Meeting noch für heute Nacht!“
Ich nicke knapp und verlasse ohne ein weiteres Wort den Raum.
Eine Stunde später sitze ich in Vincenzos massivem Stuhl. Er hat mir die Verantwortung übertragen – „Regle das! Finde die Wahrheit heraus und tue, was nötig ist!“ – und diese Aufforderung fühlt sich an wie eine Kette um meinen Hals.
Sein Thron ist zu groß, zu schwer, als gehöre er nicht mir. Doch ich sitze darin, als wäre er meiner, als würde ich den Raum beherrschen. Und das tue ich. Zumindest für jetzt. Vito sitzt mir gegenüber, in den Sessel gesunken wie eine lauernde Raubkatze. Seine Beine sind überkreuzt, eine scheinbar entspannte Pose, die seine Gefährlichkeit nur noch unterstreicht. Das schwarze, ölige Haar ist präzise zurückgekämmt – der perfekte Ombriani-Erbe, bis auf den leichten Zigarettengeruch, der an ihm haftet. Seine olivfarbene Haut hat einen ungesunden Grauton, als hätte er zu viele Nächte damit verbracht, in dunklen Hinterzimmern Deals auszuhandeln.
Seine Ombriani-Augen sezieren mich. Dunkelbraun, fast schwarz. Raubvogelaugen, die nach der kleinsten Schwäche suchen. Nach dem Straßenkind in mir, das ich nie ganz losgeworden bin. Der Siegelring an seiner Hand blitzt im Licht. Das Ombriani-Wappen – sein Geburtsrecht, das er mir bei jeder Gelegenheit unter die Nase reibt.
„Vito“, sage ich, meine Stimme kalt und schneidend wie ein Messer. „Was ist mit den Blüten?“
Er zuckt leicht zusammen, als hätte er nicht erwartet, dass ich so direkt bin. Dann lächelt er, ein Ausdruck, der mich reizen soll. „Geduld, Luca. Ich will sicherstellen, dass du bereit bist für das, was ich dir gleich zeige.“
Ich lehne mich vor, meine Ellbogen auf dem Schreibtisch, und fixiere ihn mit einem Blick, der keinen Raum für Spiele lässt. „Komm zur Sache oder ich muss dich dazu zwingen!“, knurre ich.
Vitos Lächeln verschwindet und für einen Moment sehe ich einen Funken von Unsicherheit in seinen Augen. Er hebt die Hände, als würde er sich ergeben, aber ich weiß, dass dies nur eine weitere Masche ist. „Wie du willst, Luca.“
Am Fenster steht Enzo, die Hände in den Taschen seines schwarzen Anzugs, sein Blick hinaus auf die reglose Nacht gerichtet. Er sagt nichts, aber ich fühle seine Präsenz – die unausgesprochene Unterstützung, die er mir seit dem Tag meiner Zwangsadoption gibt. Enzo war der erste Mensch in meinem neuen Leben, der mich nicht mit Misstrauen betrachtet hat. Der erste Freund, und bis heute der Einzige, den ich hatte.
„Wird‘s bald?“
Vito hebt eine Augenbraue, zieht ein Bündel Banknoten aus seiner Innentasche und wirft es auf den Schreibtisch. Sie landen mit einem dumpfen Laut vor mir. „Die waren in unserem Tresor. Gefälschte Noten.“ Vitos Ton ist glatt. Er lehnt sich zurück, seine Finger spielen mit dem goldenen Siegelring an seiner Hand. „Fast perfekt. Aber nur fast.“
Er deutet auf einen der Scheine und widerwillig hebe ich ihn auf. Das Papier fühlt sich echt an. Die Textur, die Farbe, sogar der Geruch. Doch nach einer Weile sehe ich seine Markierung. Das Wasserzeichen tanzt vor meinen Augen, verschoben um Millimeter. Perfekt gefälscht. Meine Finger streichen über das Papier, während sich meine Muskeln anspannen. Der Schweiß auf meiner Haut wird kalt.
„Woher?“, presse ich hervor. „Das ist unmöglich! Ich habe persönlich dafür gesorgt, dass alle Blüten aussortiert wurden.“
Das Adrenalin pumpt durch meine Adern, lässt mich jeden Herzschlag spüren.
Vito lehnt sich vor, seine dunklen Augen fixieren mich wie eine Schlange ihre Beute. Der Geruch seines teuren Aftershaves vermischt sich mit dem Zigarettenrauch, der an seiner Kleidung haftet. „Aus unserem Bargeld.“ Seine Stimme ist wie Samt über Stahl. „Raffaele hat nicht gelogen.“
Der Schein knistert in meiner Hand. Raffaeles letzter Atemzug hallt in meinen Ohren nach. Sein Blick war voller Wut, als er mich vor diesem Restaurant beschuldigte, ein Betrüger zu sein. „Ich weiß. Aber das hier sollte nicht mehr existieren!“ Meine Stimme ist ein tiefes Grollen.
Vitos Lippen verziehen sich zu diesem verdammten Lächeln, das mich seit Jahren verfolgt. Seine Zunge gleitet kurz über die schiefen Zähne. „Willkommen in der Realität.“
Ich schnelle hoch, der Sessel kracht nach hinten. Vitos Körper spannt sich an – pure Instinkte eines Raubtiers. Für einen Moment vibriert die Luft zwischen uns vor unterdrückter Gewalt.
„Luca.“ Enzos Hand auf meiner Schulter ist wie ein Anker. Seine Finger graben sich in meine verhärteten Muskeln.
In meinem Kopf spielen sich Bilder ab – meine Faust in Vitos Gesicht, das Geräusch brechender Knochen. Ich atme tief durch und zwinge mich zur Ruhe, bis meine Knöchel weiß hervortreten.
„Ich regle das!“, sage ich und selbst Vito scheint die tödliche Gewissheit in meiner Stimme zu spüren.
Er erhebt sich, viel zu schnell für seine unsportliche Statur. Seine Augen bohren sich in meine, als er näher kommt. Zu nah. „Vincenzo will Antworten.“ Sein Atem streift mein Gesicht. „Gib ihm gute!“
Er geht zur Tür, dreht sich noch einmal um. „Ich würde ja helfen …“ Seine Stimme trieft vor falscher Anteilnahme. „Aber das ist dein Grab, dass du dir geschaufelt hast.“
Die Tür fällt ins Schloss. Der Scotch, den Enzo mir reicht, brennt in meiner Kehle wie flüssiges Feuer.
„Du weißt, dass er dich testet?!“, sagt Enzo leise.
Das Glas landet hart auf dem Schreibtisch. Ich starre auf den gefälschten Schein, der wie eine Anklage vor mir liegt. Vito hat recht – das ist mein Grab. Aber ich werde nicht derjenige sein, der darin schmort.
„Ich werde jeden Stein in dieser verdammten Stadt umdrehen“, sage ich, meine Stimme ist viel zu ruhig für den Sturm, der in mir tobt. „Und wenn ich herausfinde, wer unsere Familie verrät …“
Ich lasse den Satz unvollendet. Die Dunkelheit in mir verlangt nach Gewissheit. Nach Kontrolle. Und ich werde beides bekommen.