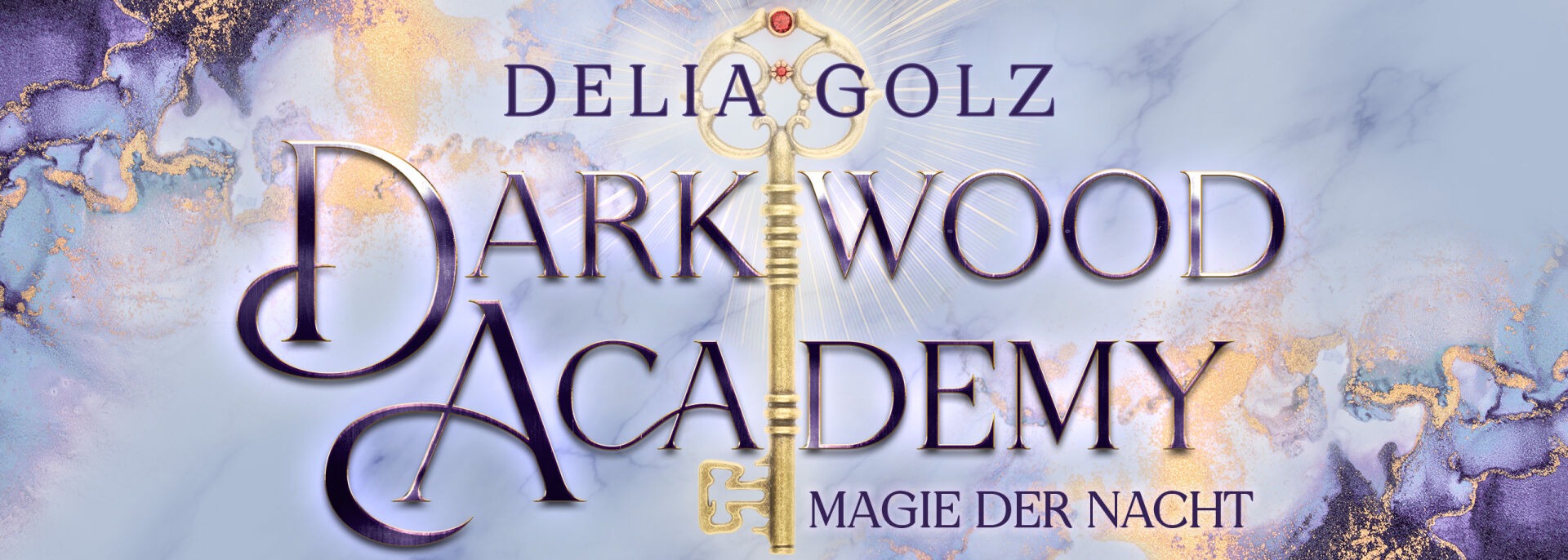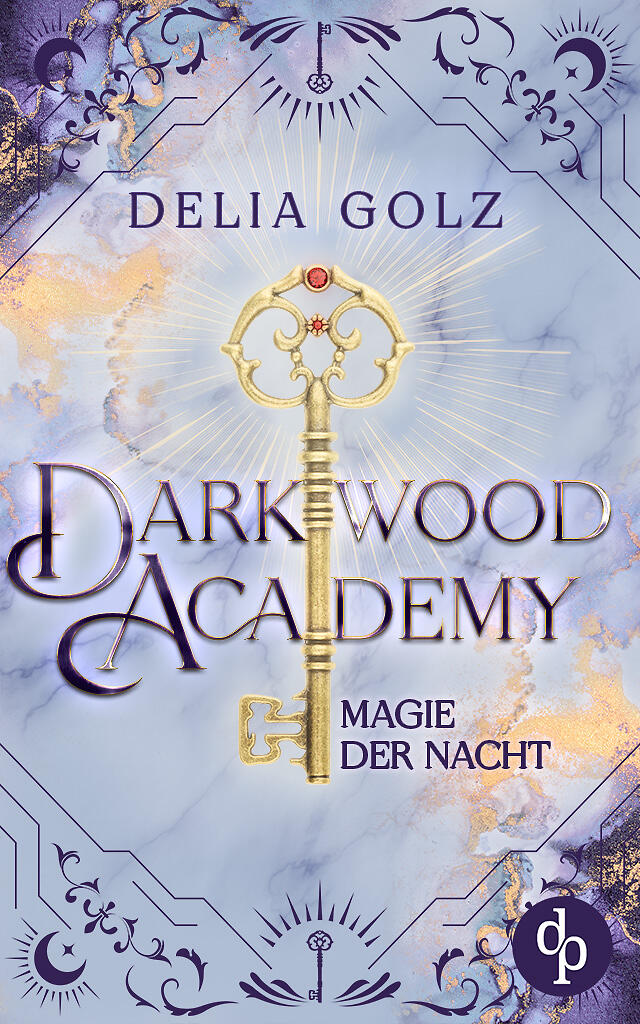Prolog
Nervös laufe ich in meinem Zimmer auf und ab und werfe immer wieder einen prüfenden Blick in den Spiegel. Heute gehe ich auf die erste richtige Party meines sechzehnjährigen Lebens – wenn man von den langweiligen Monopoly-Abenden mit dem Literatur-Club absieht, bei denen stets eine Flasche billiger Whisky rumgereicht wurde.
Ich streiche den karierten Faltenrock sowie die schwarze Bluse glatt und frage mich zum wiederholten Mal, ob ich zu prüde angezogen bin für ein Lagerfeuer am See, zu dem meine halbe Schule erscheinen wird.
Doch noch ehe ich mich für ein anderes Outfit entscheiden kann, ertönt die Stimme meines Zwillingsbruders Jules, dessen Überredungskünste der einzige Grund sind, weshalb ich überhaupt auf diese Party gehe.
„Sharon, wir fahren jetzt los! Kommst du endlich?“
Resigniert seufzend wende ich mich von meinem Spiegelbild ab und gehe mir noch mal mit der Bürste durch mein kinnlanges schwarzes Haar, das wie immer etwas widerspenstig wirkt. Ich poltere die geschwungene Holztreppe hinunter und fahre dabei wie jedes Mal mit der Hand über die kunstvollen Schnitzereien im Geländer.
„Da bist du ja endlich“, murrt Jules, der bereits an der Haustür wartet und in seiner figurbetonten dunklen Kleidung mal wieder umwerfend aussieht.
Wie so oft lässt sein Anblick ein leichtes Gefühl von Eifersucht in mir aufkochen und ich frage mich, wie wir beide Zwillinge sein können. Während er zu den Beliebten unserer Schule zählt und als Frauenschwarm gilt, gehöre ich zu den Außenseitern, die am liebsten unsichtbar bleiben. Obwohl wir uns die grünen Augen, das schwarze Haar und die blasse Haut teilen, könnten wir darüber hinaus kaum unterschiedlicher sein. Vermutlich hat Jules im Bauch unserer Mutter die gute Genetik für sich allein beansprucht, während ich mich mit dem Rest begnügen musste.
„Dad wartet schon im Auto“, drängt mein Bruder und schlüpft in seine Sneaker, ehe er die schwere Eichentür aufreißt und in die laue Luft eines verheißungsvollen Augustabends tritt.
Ich schlüpfe in meine neuen Dr. Martens und möchte ihm gerade folgen, als meine Mutter wie aus dem Nichts hinter mir erscheint und mir beinahe schon anklagend meine Tablettendose hinhält.
„Du hast deine Medikamente nicht genommen. Denkst du, mir fällt das nicht auf?“
Mein Herz wird schwer, als ich die Dose an mich nehme. Laut meinem Arzt werden mir die Tabletten wegen einer angeborenen Stoffwechselerkrankung verschrieben. Auch Jules musste sie nehmen, bis er vor vier Jahren plötzlich damit aufhören durfte, ohne dass mir jemals der Grund dafür genannt wurde.
Mit einem gespielten Lächeln nehme ich eine Tablette, stecke sie mir in den Mund und tue so, als würde ich sie schlucken. Allerdings behalte ich sie in meiner Wange versteckt. Seit Jules die Tabletten absetzen durfte und nichts passiert ist, habe ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, es selbst heimlich auszuprobieren. Meine Mutter nickt zufrieden und gibt mir einen Abschiedskuss auf die Wange.
„Viel Spaß, Schatz. Und vergiss nicht: kein Alkohol! Der verträgt sich nicht mit deinem Medikament.“
Ich kann nur schwer ein Augenverdrehen unterdrücken. Stattdessen winke ich zum Abschied und verschwinde dann so schnell ich kann durch die Tür. Erst als ich sie hinter mir ins Schloss fallen höre, spucke ich die Tablette, durch die sich mittlerweile ein furchtbar bitterer Geschmack in meinem Mund ausgebreitet hat, unauffällig in meine Hand. Ich weiß nicht, ob mein Vater mich vom Auto aus beobachtet, also gebe ich vor, mit der Hand über die sorgfältig gestutzten Büsche zu streichen, um das mittlerweile klebrig gewordene Dragee zwischen die Zweige fallen zu lassen. Dann laufe ich zu dem protzigen tiefschwarzen Rolls Royce meines Vaters und lasse mich auf den Rücksitz aus hellem Leder fallen. Jules neben mir schenkt mir keine Beachtung, sondern tippt auf seinem iPhone herum.
Während das Auto langsam über den knirschenden Kies fährt, werfe ich einen Blick zurück auf unser riesiges Anwesen. Als Kind fand ich es wunderbar, gemeinsam mit Jules in den unzähligen verwinkelten Gängen und Zimmern Fangen oder Verstecken zu spielen. Doch mittlerweile ist es mir eher unangenehm, wenn ich mal wieder gefragt werde, ob ich wirklich im Wingrave-Anwesen lebe und ob es dort tatsächlich spukt. Der einzige Geist, den ich je dort gesehen habe, war Jules, als er sich mit acht Jahren ein Laken übergeworfen hat und mich damit erschrecken wollte. Schade eigentlich, denn ich bin schon seit ich denken kann von allem fasziniert, was mit Horror zu tun hat – vielleicht wäre es genau mein Ding, in einem Spukhaus zu leben.
Mein Vater fängt an, über seine Jugendzeit zu reden, wobei aus dem Radio ein alter Song der Beatles schallt. Ich spiele Interesse vor, während sich meine Finger in meinen Rock krallen und ich die Bäume in der Dämmerung vorbeiziehen sehe.
Dann erscheint der See in meinem Sichtfeld und kurz darauf erkenne ich auch schon das Flackern des Lagerfeuers in der Ferne. Unwillkürlich halte ich die Luft an und versuche, mein wild pochendes Herz zu beruhigen. Vielleicht war es doch ein Fehler, die Tablette nicht zu nehmen, und das sind nun die ersten Entzugserscheinungen. Zumindest wäre mir das lieber, als mir einzugestehen, dass ich blanke Panik davor verspüre, mich auf dieser Party vor meiner halben Schule lächerlich zu machen.
Schau mal, da ist diese seltsame Sharon. Was hat sie da eigentlich an? Sie sieht aus wie eine alte Frau!
Die Stimme meines Vaters reißt mich aus meinen düsteren Gedanken: „So, hier lasse ich euch raus. Viel Spaß euch beiden.“
„Danke, Dad“, erwidert Jules, ehe er die Wagentür öffnet. „Ich rufe dich an, wenn du uns abholen kannst.“
Ich bringe bloß ein heiseres „Bis dann“ zustande, ehe ich aus dem Auto stolpere und froh bin, dass wir uns noch nicht in Sichtweite der Partygäste befinden. Jules seufzt und tritt neben mich, während der Rolls Royce langsam in der Dunkelheit verschwindet.
„Entspann dich, okay? Du kannst nicht viel falsch machen. Und ein paar deiner Freunde aus dem Literatur-Club sind auch da.“ Er schafft es tatsächlich, dass seine Worte ermutigend klingen. Also nicke ich mit einem gezwungenen Lächeln und gehe neben ihm her durch ein kleines Waldstück, das uns vom Strand trennt. Schon jetzt dringen dröhnende Bässe und das übermütige Lachen der Jugendlichen zu uns – ohne Zweifel ist bereits eine große Menge Alkohol geflossen.
Meine Nervosität steigert sich mit jedem Schritt, und als wir schließlich aus dem Waldstück heraustreten, würde ich am liebsten auf dem Absatz kehrtmachen. Doch da haben uns bereits die ersten Partygäste entdeckt.
„Da ist Jules!“, ruft ein breitschultriger und hochgewachsener Junge, den ich vom Sehen kenne. Er stürmt auf uns zu und nimmt meinen Bruder überschwänglich in den Arm. Ich kann seinen Alkoholatem bis zu mir riechen.
„Und du bist …?“, wendet er sich an mich und betrachtet mich von oben bis unten. Fassungslos starre ich ihn an, denn er scheint nicht mal zu wissen, dass ich Jules’ Zwillingsschwester bin. Sein Blick bleibt an meiner Bluse kleben und er prustet los. „Hast du deine Oma dabei, Jules?“
Das reicht mir und so stapfe ich allein zum Strand. Ich halte nach vertrauten Gesichtern Ausschau und habe dabei das Gefühl, von allen angestarrt zu werden. Mit einem unwohlen Kribbeln in der Magengrube registriere ich, dass die meisten Mädchen luftige Tops und Jeansshorts tragen.
Dann endlich entdecke ich Miles, Liza und Mara aus dem Literatur-Club. Sie sitzen an dem riesigen Lagerfeuer. Erleichtert schließe ich mich ihnen an. Sie wirken, als würden sie sich beinahe so unwohl fühlen wie ich.
„Hey Sharon“, begrüßt Miles mich und reicht mir eine Bierflasche. „Damit lässt es sich besser ertragen, dass wir für unsere Mitschüler unsichtbar sind.“
Ich nehme den Alkohol entgegen und leere die Flasche mit wenigen Schlucken beinahe vollständig.
„Was machen wir hier eigentlich?“, seufze ich, als ein Paar neben uns anfängt wild herumzuknutschen.
„Spaß haben?“, schlägt Liza mit einem gequälten Lächeln vor und greift nach einer halb leeren Rumflasche.
Schweigend reichen wir sie von einem zum anderen und nach einer Weile macht sich endlich eine angenehme Wärme in mir breit. Das Wummern der Bässe kommt mir sanfter vor und das laute Knistern des Feuers vermischt sich mit dem ausgelassenen Lachen und Kreischen der Partygäste. Verträumt blicke ich in die Flammen und strecke unwillkürlich die Hand danach aus.
„Pass auf!“, ruft Miles und packt mein Handgelenk.
Ruckartig erwache ich aus meiner Trance und werfe ihm einen bösen Blick zu. „Kein Sorge, ich habe nicht vor, mich zu verbrennen.“
Miles rückt seine Hornbrille zurecht und errötet leicht, als sein Blick zu meinen Beinen wandert. Erst jetzt merke ich, dass mein eigentlich knielanger Rock bis zur Mitte meiner Oberschenkel hochgerutscht ist. Schnell ziehe ich ihn wieder runter und erhebe mich ruckartig.
„Ich gehe ein bisschen spazieren“, nuschele ich.
Meine Freunde zucken mit den Schultern und so entferne ich mich leicht schwankend vom Feuer. Mir ist heiß, meine Wangen glühen regelrecht. Ich gehe an den tanzenden Teenagern vorbei, bis meine Beine mich zum Seeufer tragen.
Als ich jedoch ein eng umschlungenes Paar entdecke, das auf einem umgekippten Baumstamm direkt am Wasser sitzt, halte ich inne. Mehrmals blinzle ich, bis ich mir sicher bin, dass meine Augen mich nicht täuschen. Es sind Jules und Jenny – das wohl furchtbarste Mädchen unseres Jahrgangs. Sie wechselt beinahe wöchentlich ihren Freund und lässt keine Gelegenheit aus, mich runterzumachen. Dabei ist sie sogar schon handgreiflich geworden – am liebsten würde ich dieses demütigende Erlebnis aus meinem Gedächtnis streichen. Und nun hat mein Bruder nichts Besseres zu tun, als mit ihr rumzumachen. Meine Kehle wird eng und ich möchte gerade herumwirbeln, als sich Jennys Kopf zu mir dreht. Sie streicht sich eine Strähne ihres blonden Haares hinters Ohr und ihre vollen Lippen verziehen sich zu einem triumphierenden Lächeln. Sie zieht Jules, der mich noch immer nicht bemerkt hat, auf die Beine, deutet in Richtung des Waldes und flüstert ihm etwas ins Ohr. Er nickt und geht auf die Bäume zu.
Nachdem Jenny ihm kurz hinterhergeschaut hat, kommt sie mit schwingenden Hüften in meine Richtung. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie bloß knappe Hotpants und ein Bikinioberteil trägt. Ich möchte weglaufen, doch meine Füße sind wie festgewachsen.
„Hallo, kleine Sharon“, säuselt Jenny und betrachtet mich mit schiefgelegtem Kopf und geschürzten Lippen. „Hast du dich etwa am Kleiderschrank deiner Mutter bedient?“
„Lass mich in Ruhe“, presse ich hervor, schaffe es aber noch immer nicht, mich von der Stelle zu rühren.
Jenny lächelt herablassend und beugt sich vor, bis ich ihren Atem an meinem Ohr spüren kann. „Dein Bruder kann gut küssen. Mal sehen, was er noch so draufhat.“ Mit diesen Worten dreht sie sich um und folgt Jules, der mittlerweile zwischen den Bäumen verschwunden ist.
Fassungslos blicke ich ihr hinterher.
Dann steigt blanke Wut in mir hoch – eine Wut, die ich nicht von mir kenne und die das Blut in meinen Ohren rauschen lässt. Mein Gesicht wird heiß und ich schließe die Augen, um mich zu beruhigen. Ich atme mehrmals tief durch, während meine Finger unkontrolliert zucken und sich dann zu einer Faust ballen. Erst als sich mein Herzschlag ein wenig beruhigt hat, schlage ich meine Lider wieder auf. Ich blicke mich benommen um, atme einmal tief durch und versuche mir einzureden, dass das eben eine völlig harmlose Situation war. Mein Bruder gibt sich ständig mit irgendwelchen Mädchen ab und verliert dann das Interesse. Schon morgen wird Jenny wieder Geschichte sein, was ist schon dabei?
Nachdem ich ein weiteres Mal tief durchgeatmet habe, zwinge ich mich zu einem Lächeln und mache mich dann auf den Weg zurück zum Lagerfeuer. Doch als ich an den ersten Partygästen vorbeigehe, werde ich plötzlich hart von der Seite angerempelt. Ich stolpere und falle mit einem Ächzen der Länge nach hin. Ich schmecke Erde und meine Finger haben sich in den Schmutz gegraben. Mein Knie schmerzt, ich muss es mir auf dem dreckigen Boden aufgeschürft haben. Als ich mich keuchend wieder aufzurappeln versuche, ist da niemand, der sich entschuldigt und mir auf die Beine hilft. Stattdessen etwa ein Dutzend Teenager, die sich um mich geschart haben und lachend auf mich zeigen. Ich blicke von einem hämischen Gesicht zum nächsten, ehe sich ein Schluchzen meine Kehle hochkämpft.
Und dann ist da mit einem Mal wieder dieser tiefe, alles andere verdrängende Zorn. Mein Atem wird schneller und unkontrollierter, das schallende Gelächter um mich herum immer lauter. Oder bin ich es, die es nur immer deutlicher wahrnimmt?
„Hört auf!“, schreie ich und presse mir die Hände auf die Ohren.
Doch die Geräusche werden immer lauter, dringen erbarmungslos in meinen Kopf. Ich springe auf die Füße, öffne meinen Mund zu einem Schrei … und dann löst sich die Welt plötzlich in ein einziges, glühendes Chaos auf. Meine Stimme wird immer lauter. Schriller. Bis sie mir selbst in den Ohren wehtut. Bis mir bewusst wird, dass es nicht nur mein eigener Schrei ist, der die laue Nacht durchschneidet. Ich reiße die Augen auf und blicke mich wie ein gehetztes Tier um, doch das Einzige, was ich sehe, ist ein Flammenmeer.
Das Letzte, was ich wahrnehme, ist eine überwältigende Kälte, die mich in eine tiefe Dunkelheit zieht.
Kapitel 1
Ich lehne meine Stirn an die Scheibe des Rolls Royce, während die Landschaft der schottischen Highlands an mir vorbeizieht. Ich fühle mich völlig leer – nicht einmal Nervosität aufgrund des neuen Lebens, das vor mir liegt, regt sich in mir.
Irgendwann werden die Bäume lichter, bis sich die Straße schließlich am Meer entlangschlängelt. Ich setze mich das erste Mal seit Beginn der zweistündigen Fahrt auf und erlaube mir, diesen Anblick zu genießen. Ich war in meinem Leben selten am Meer und der Gedanke, für eine lange Zeit in unmittelbarer Nähe zu wohnen, kommt mir nun doch verlockend vor.
Seit der verhängnisvollen Nacht habe ich mich die meiste Zeit mit meinen Büchern in mein Zimmer zurückgezogen und keinen Gedanken an mein bevorstehendes neues Leben verschwendet. Ich habe die vielen Berichte über den verheerenden Brand und die unzähligen Toten ignoriert und auch die Fragen der Polizisten bloß wie in Trance beantwortet. Zum Glück konnten mir meine Eltern die meiste Zeit den Rücken freihalten. Außerdem war da noch Jules, der außer mir der einzige Überlebende war.
Ein Frösteln durchfährt meinen Körper und ich beschließe, meine Gedanken auf das zu richten, was vor mir liegt: die Darkwood Academy. Schon eine Woche nach jener Nacht habe ich diesen Namen zum ersten Mal gehört, dem Ganzen jedoch zunächst nicht viel Bedeutung beigemessen. Bis mir meine Eltern vor einem Monat mitgeteilt haben, was längst feststand: Ich soll gemeinsam mit Jules mein bekanntes Leben verlassen und auf diese Schule gehen, von der ich noch nie zuvor etwas gehört habe. Selbst im Internet konnte ich kaum Informationen über sie finden. Angeblich sind schon meine Eltern auf die Darkwood Academy gegangen und haben sich dort kennengelernt. Es schockiert mich noch immer, wie wenig ich über ihr Leben weiß. Jules hingegen hat kein bisschen überrascht gewirkt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er zufrieden gelächelt hat, als unsere Eltern uns alles erzählt haben: wie gut der Unterricht ist, wie komfortabel die Schlafräume sind und so weiter. Kein Wort darüber, weshalb wir plötzlich auf diese Schule wechseln sollen und was das alles mit dieser furchtbaren Nacht zu tun hat.
„Wir sind gleich da“, sagt meine Mutter freudig lächelnd und streicht sich durch ihr blondes Haar.
Wie immer sieht sie makellos aus in ihrem maßgeschneiderten Etuikleid und mit dem dezent geschminkten Gesicht. Ebenso wie mein Vater in seinem Nadelstreifenanzug strahlt sie puren Reichtum aus, was mir schon jetzt Unbehagen bereitet. Ohne Zweifel werden mir unsere Mitschüler direkt bei unserer Ankunft einen Stempel aufdrücken, obwohl ich selbst kein bisschen wie ein Rich Kid aussehe.
Doch noch ehe ich mir weiter den Kopf darüber zerbrechen kann, biegen wir um eine Kurve und die Darkwood Academy erscheint in unserem Sichtfeld. Trotz meiner schlechten Laune bin ich sofort fasziniert von dem Anblick. Anders als das protzige Herrenhaus meiner Familie sieht dieses Anwesen völlig unsymmetrisch aus und irgendwie, als wäre es aus vielen unterschiedlichen Teilen, die nicht so recht zueinanderpassen, zusammengesetzt. Da gibt es Türmchen mit Spitzdächern, Erkern und Giebeln. Bei der mit Efeu bewachsene Fassade wechseln sich Stein, Fachwerk und dunkles Holz ab. Ohne Zweifel ist das Haus riesig, doch es wirkt trotzdem einladend, lebendig und auch ein bisschen chaotisch.
„Ich liebe es“, platzt es aus mir heraus, woraufhin meine Eltern befreit auflachen.
„Du wirst es noch mehr mögen, wenn du es erst mal von innen siehst“, sagt meine Mutter und verliert sich ihrer Miene nach zu urteilen in Erinnerungen.
Ich werfe einen Blick zu Jules. Er betrachtet das Anwesen mit nachdenklichem Gesichtsausdruck. Während wir über die lange Kieseinfahrt rollen und ein verschnörkeltes schmiedeeisernes Tor passieren, sagt er kein Wort.
Schließlich bleiben wir direkt vor dem Gebäude stehen, sodass ich es in seiner gesamten Pracht bewundern kann. Von Nahem sieht es sogar noch schöner aus. Überall gibt es wundervolle Details: Einige Balken sind mit kunstvollen Schnitzereien verziert und das Geländer der Veranda ist in einem satten Grün gestrichen.
Als ich das Auto verlasse und mich um die eigene Achse drehe, fällt mir allerdings auf, dass überhaupt keine Schüler draußen unterwegs sind oder es sich zum Lernen auf der Wiese neben dem kleinen See gemütlich gemacht haben. Genaugenommen wirkt das gesamte Gelände wie ausgestorben.
„Im Moment müsste noch Unterricht sein“, erklärt mein Vater, als er mein verwirrtes Gesicht bemerkt. „Auf die Darkwood Academy gehen nur etwa fünfzig Schüler, dadurch wirkt sie nicht so belebt wie die Schulen, die du kennst.“
„Nur fünfzig Schüler?“, frage ich verwundert.
Wieder wird mir bewusst, wie wenig ich über diesen Ort weiß. Meine Mutter nickt bekräftigend, während sie etwas unbeholfen über den Kies auf mich zu stöckelt.
„Hier gibt es nur drei Jahrgänge. Hatten wir dir das nicht erzählt?“
Ich seufze und halte einen bissigen Kommentar zurück. Stattdessen wende ich mich wieder dem Haus zu und blicke daran hoch. Ich bewundere die Bleiverglasungen, die teilweise aus Buntglas bestehen, und bin mir sicher, dass es herrlich aussieht, wenn die Sonne hindurchfällt. Schade, dass heute so ein bedeckter Oktobertag ist.
Meine Aufmerksamkeit wird abgelenkt, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnehme. Überrascht wende ich mich um: Eine grau getigerte Katze blinzelt mich träge an.
„Die Rektorin, Mrs McArren, hat eine Schwäche für Katzen“, erklärt meine Mutter, als auch sie das Tier entdeckt. „Hier auf dem Gelände laufen sicherlich um die zwanzig von ihnen herum.“
Ich kann nur schwer ein begeistertes Quietschen unterdrücken und gehe vorsichtig auf die Katze zu, um sie zu streicheln. Als ich mich hinhocke und meine Hand nach ihr ausstrecke, schnuppert sie mit halb geschlossenen Augen daran. Dann wendet sie sich jedoch um und verschwindet hinter dem Gebäude. Neugierig, was sich dort befinden könnte, folge ich ihr.
Als ich um eine Ecke biege, bleibe ich jedoch ruckartig stehen. Dort, an die Hauswand gelehnt, steht ein großer blonder Junge, der nur wenig älter als ich zu sein scheint, und raucht eine Zigarette. Sicherlich tut er das heimlich, und da ich mich nicht einmischen möchte, wende ich mich schnell wieder ab.
Noch ehe ich aus seiner Sichtweite verschwinden kann, ertönt jedoch seine Stimme: „Hey, kenne ich dich?“
Ich schließe für einen Moment die Augen, ehe ich mich wieder zu ihm umdrehe und ihn angespannt anlächle.
„Ich bin neu hier, mein Zwillingsbruder Jules und ich sind eben erst angekommen.“
Der Junge nickt langsam und ich beiße mir nervös auf die Lippe. Erst jetzt bemerke ich wieder die getigerte Katze, die sich schnurrend an den Beinen des Fremden reibt. Seine graue Wollhose ist ein kleines Stück zu kurz und betont dadurch seinen leicht schlaksigen Körperbau. Da ich nicht beim Starren erwischt werden will, wende ich mich schnell wieder ab.
„Ich muss zurück“, sage ich unbeholfen. „Meine Eltern warten bestimmt schon auf mich.“
Der Junge nickt abermals wortlos und nimmt unbeeindruckt einen Zug von seiner Zigarette.
„Ich nehme an, man sieht sich“, erwidert er dann und bückt sich, um die Katze zu streicheln.
Ein wenig zu hastig eile ich um das Gebäude herum, bis ich meine Eltern und Jules wieder sehen kann. Neben ihnen steht eine Frau, die ich auf um die sechzig schätze und bei der es sich vermutlich um die Rektorin handelt. Sie ist dürr und hochgewachsen und ihr graues Haar ist zu einem strengen Dutt zurückgebunden. Schon auf den ersten Blick bin ich mir sicher, dass mit ihr nicht zu spaßen ist.
„Ah, und da ist auch unsere Tochter Sharon“, dröhnt die Stimme meines Vaters zu mir und er winkt mich ungeduldig zu sich.
Widerwillig laufe ich zu ihnen und reiche der Frau höflich die Hand.
„Ich bin Mrs McArren, die Rektorin der Darkwood Academy“, stellt sie sich in herablassendem Ton vor.
Sie mustert mich von oben durch ihre kleine runde Brille, die ihr die Hakennase ein Stück heruntergerutscht ist. Sie wirkt wie das absolute Klischee einer strengen Rektorin – das macht auch ihre Liebe zu Katzen nicht wieder wett.
„Ich bringe euch nun zu euren Zimmern, und während ihr euch einrichtet, bespreche ich alles Wichtige mit euren Eltern“, teilt sie uns mit und schenkt Jules dabei tatsächlich ein Lächeln. Also hat er es schon jetzt geschafft, der Liebling zu werden.
Unbeholfen ziehe ich meinen Lederkoffer über den Kies, als Mrs McArren uns bedeutet, ihr zu folgen.
Sobald ich in der Eingangshalle stehe, verfalle ich wieder in begeistertes Staunen. Der Boden besteht aus knarzenden Dielen und das Geländer der doppelten Holztreppe wirkt sogar noch aufwendiger als das in meinem Zuhause. Die Decke ragt weit über uns empor und wird von einem gigantischen Kronleuchter aus Kristallglas geschmückt.
„Die meisten Klassenzimmer befinden sich hier im Erdgeschoss, ebenso der Speisesaal“, erklärt Mrs McArren und deutet auf die schweren doppelflügeligen Türen, die von der Eingangshalle wegführen.
„Oben befinden sich die Schlaf- und Aufenthaltsräume. Folgt mir.“
Als ich ächzend meinen Koffer die Treppe hochhieve, kommt diese mir plötzlich nicht mehr ganz so prächtig vor wie gerade noch. Innerlich verfluche ich jede einzelne Stufe, während meine Eltern fröhlich plaudernd vor mir hergehen und gar nicht daran denken, mir zu helfen. Jules ist bereits mühelos oben angekommen. Als auch ich schnaufend die letzte Stufe bewältige, lächelt er mir neckisch zu.
„Vielleicht solltest du dich hier in einem Sport-Club anmelden.“
„Haha“, erwidere ich trocken und verpasse ihm einen spielerischen Fausthieb gegen den Oberarm.
„Zuerst führe ich euch zu dem Flügel mit den Mädchenschlafräumen“, verkündet Mrs McArren und biegt nach rechts ab.
Allmählich breitet sich Nervosität in mir aus, denn mir wird zunehmend bewusst, dass ich mir mein Zimmer wohl mit einer oder mehreren Mitschülerinnen teilen muss. Je länger wir dem langen dunklen Gang folgen, desto mehr sehne ich mich in mein eigenes Zimmer zurück. Dort konnte ich mich jederzeit verkriechen, wenn ich wieder einmal genug von der Welt hatte.
An einer Tür am Ende des Ganges bleibt Mrs McArren schließlich stehen. Sie öffnet sie und bedeutet mir dann mit einer ungeduldigen Handbewegung einzutreten.
„Das ist von nun an dein Zimmer. Richte dich gerne so ein, wie du es magst.“
Zögerlich gehe ich an meinen Eltern vorbei, die mich aufmunternd anlächeln, und betrete dann das Zimmer, das von nun an mein Zuhause sein wird.
„Wir sehen uns nach dem Abendessen noch mal, um uns richtig zu verabschieden“, sagt meine Mutter fröhlich.
„Bis dahin“, murmle ich abwesend und blicke mich dann neugierig um.
Innerhalb weniger Sekunden habe ich den ganzen Raum erfasst und seufze erleichtert, da ich zumindest im Moment noch allein bin. Allerdings gibt es drei Betten. Zum Glück handelt es sich um einen recht großen Raum, dessen Wand mit einer Holzvertäfelung verkleidet ist. Die Decke wird von schweren Holzbalken gestützt und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Erker mit drei bleiverglasten Fenstern. Doch das Beste sind die breiten gepolsterten Fensterbänke, auf denen man sicherlich wunderbar lesen kann. Trotz der vielen Veränderungen, die mir tiefes Unbehagen bereiten, breitet sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus.
Ich ziehe meinen Koffer zu dem einzigen Bett, das noch frei zu sein scheint, und lasse mich darauf sinken. Nach kurzem Kramen finde ich meine abgegriffene Ausgabe von Stephen Kings Es, die ich sicherlich schon fünfmal verschlungen habe. Viele finden dieses Buch langatmig, doch ich liebe es. Kurz muss ich darüber schmunzeln, dass das Erste, was ich an diesem völlig neuen Ort mache, das Lesen dieses Buches ist. Doch vielleicht ist es genau das, was ich brauche: etwas Vertrautes, in das ich mich flüchten kann, um mich hier heimisch zu fühlen.
Es dauert nicht lange, bis ich völlig in der Welt des Horrors versunken bin und ich dabei die Zeit vergesse. Die Sonne wandert und allmählich bricht die Dämmerung an. Ich blinzle, als mir klar wird, dass ich mindestens zwei Stunden gelesen haben muss und es mittlerweile später Nachmittag ist.
Ich beschließe, nach Jules zu suchen, um mit ihm zusammen die Schule zu erkunden. Doch gerade, als ich meine Beine von der Bettkante schwinge, wird die Tür mit Wucht aufgestoßen. Sofort versteift sich mein ganzer Körper und ich wage es nicht, mich zu bewegen, fühle mich wie ein Kaninchen in der Falle. Ein komplett in Schwarz gekleidetes Mädchen betritt mit energischen Schritten den Raum und dreht sich dann mit verschränkten Armen zu mir um.
„Du bist also Sharon, die Neue“, sagt sie finster und bestätigt damit meinen ersten Eindruck.
Sie hat lange, lila gefärbte Haare und ihre vollen Lippen sind mit einem dunkelroten Lippenstift geschminkt, was einen starken Kontrast zu ihrer blassen Haut bildet. Sie trägt eine derbe Lederjacke mit Nieten, eine schwarze Röhrenjeans und klobige Boots mit dicker Sohle. Alles in allem wirkt sie wie eine typische Schlägerbraut und es graut mir schon jetzt vor der Zeit, die wir zusammen verbringen müssen.
„Du scheinst nicht sehr gesprächig zu sein“, murrt sie und kommt dann bedrohlich auf mich zu.
Meine Kehle wird eng und ich schlucke schwer. Gerade als ich über Flucht nachdenke, verzieht sich ihr Mund jedoch zu einem Lächeln und sie kichert überraschend mädchenhaft. Dann reicht sie mir ihre Hand, die ich zögerlich ergreife, und zieht mich auf die Beine.
„Ich bin Aideen“, stellt sie sich vor und schließt mich dann überschwänglich in die Arme. Mein Körper ist noch immer völlig steif und ich begreife nicht, was hier gerade geschieht.
„Mach dir nichts draus, diesen Scherz erlaube ich mir mit allen, die ich neu kennenlerne“, erklärt sie. „Die meisten reagieren so wie du. Aber ich bin mir sicher, dass wir gute Freundinnen werden.“
Ich nicke schwach und sehe zu, wie sie sich lässig auf ihr Bett setzt. Erst jetzt wird mir klar, weshalb mir ihr Bett nicht sonderlich aufgefallen ist: Statt mit düsterer Deko und Death-Metal-Postern ist ihre Ecke mit Pflanzen und niedlichen Stofftieren geschmückt. Schon mal eine Sache, für die wir uns beide zu interessieren scheinen, denn ich habe eine Schwäche für Kakteen und Sukkulenten.
„Der Unterricht war heute so öde“, plappert Aideen drauf los. „Sei froh, dass du noch nicht teilnehmen musstest. Aber morgen bleibst du sicherlich nicht mehr verschont.“
Sie schält sich aus ihren Boots und zum Vorschein kommen zwei verschiedenfarbige, bunt geblümte Socken. Ich muss mir ein Lachen verkneifen und allmählich löst sich der Knoten in meiner Brust.
„Wer wohnt noch hier im Zimmer?“, frage ich und blicke zu dem Bett, das noch viel nichtssagender aussieht als Aideens.
Es ist völlig makellos gemacht und nur an dem sauber gefalteten Schlafanzug sowie dem schlichten schwarzen Koffer kann man überhaupt erkennen, dass sich dort jemand niedergelassen hat.
„Oh, bloß Sabrina“, antwortet Aideen und verdreht die Augen. „Bei ihr trügt der Schein im Gegensatz zu mir nicht: Sie ist genauso langweilig, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Ich bin so froh, dass ich mir nicht mehr allein mit ihr das Zimmer teilen muss.“
„Vielleicht bin ich ja auch nerviger, als du denkst“, sage ich und grinse sie an.
Seltsamerweise fällt es mir auf einmal total leicht, ein Gespräch mit ihr zu führen, obwohl ich sie doch gar nicht kenne.
Aideen lacht auf und mustert meine Kleidung. Sofort erröte ich und weiche ihrem Blick aus.
„Manche Menschen würden deine Klamotten wohl als altmodisch bezeichnen“, stellt sie fest. „Aber ich finde sie unglaublich cool. Irgendwie Vintage mit einer Prise Grunge. Du hast eindeutig Stil und das ist schon mal der erste Grund, weshalb ich dich nicht langweilig finde.“
Ich blicke sie sprachlos und überwältigt an. So etwas Nettes hat noch nie jemand über meine Kleidung gesagt.
„Oh … danke“, stammle ich und überlege, ob ich ihr auch ein Kompliment machen sollte.
Da öffnet sich jedoch erneut die Tür und Mrs McArren steht im Rahmen.
„Wie ich sehe, habt ihr euch schon angefreundet“, sagt sie und presst die Lippen seltsam zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit ein Lächeln andeuten möchte.
„Sharon, ich informiere dich nun über die ersten Regeln, die an dieser Schule gelten. Den Rest wirst du ein anderes Mal erfahren.“
Aideen seufzt kaum hörbar und setzt sich demonstrativ Kopfhörer auf, die an einen alten Discman gestöpselt sind. Ich blicke Mrs McArren erwartungsvoll an und gebe mir Mühe, interessiert auszusehen.
„Zunächst: Wir tragen hier keine Uniformen und haben auch keine allzu strenge Kleiderordnung. Allerdings sind grelle Farben untersagt, denn die stören das Auge.“
Von Aideens Bettseite ertönt ein Prusten, das sie schnell durch ein Husten zu übertönen versucht.
„Wie ich sehe, ist deine Musik nicht laut genug“, stellt Mrs McArren trocken fest, ehe sie sich wieder an mich wendet. „Die zweite Regel lautet: keine Handys. Wenn du jemanden kontaktieren möchtest, kannst du die Telefone auf den Fluren benutzen.“
Ich sehe sie verdutzt an, denn damit habe ich nicht gerechnet. Die Darkwood Academy kommt mir zwar ein wenig vor wie aus einer anderen Zeit, doch ein Handy-Verbot finde ich übertrieben. Dennoch verkneife ich mir jeden Protest und ziehe mein Smartphone hervor, um es auszuschalten.
„Nein, ich muss dich bitten, es mir zu geben“, unterbricht die Rektorin mich kühl und streckt die Hand aus.
Nun kann ich mich doch nicht mehr zurückhalten. „Aber ich …“
„Nein!“ Ihre schneidende Stimme lässt mich zusammenzucken und schnell lege ich ihr das Handy in die ausgestreckte Hand. Sehnsuchtsvoll schaue ich dabei zu, wie sie es sich in die Tasche ihres Blazers steckt.
„Abendessen gibt es um 18 Uhr“, sagt sie, als sei nichts passiert. „Aideen wird dich in den Speisesaal führen. Seid pünktlich.“ Mit diesen Worten rauscht sie davon.
Ich reibe mir mit der Hand übers Gesicht. „Ist sie immer so schrecklich?“
„Du hast ja keine Ahnung“, antwortet Aideen trocken und nimmt die Kopfhörer ab. „Aber ich hab schon eine Idee, wie ich dich aufmuntern kann“, fügt sie hinzu und ihre dunklen Augen glitzern freudig auf.
Sie zieht sich flauschige rosa Hausschuhe an, während ich noch immer meine schwarz-weißen Oxfordschuhe trage.
Neugierig folge ich ihr dann aus unserem Zimmer und lasse mich durch mehrere verwinkelte Gänge führen. Innerhalb kürzester Zeit habe ich bereits die Orientierung verloren. Ständig bücke ich mich voller Entzückung, denn immer häufiger läuft uns eine Katze über den Weg.
„Stimmt es, dass Mrs McArren um die zwanzig Katzen besitzt?“, frage ich begeistert.
Aideen lacht auf, als hätte ich einen Witz gemacht, den ich selbst nicht verstehe.
„Die Zahl hat vielleicht vor vielen Jahren gestimmt. Mittlerweile sind es bestimmt mindestens dreißig. Mrs McArren rettet sie aus Tierheimen, was ich eigentlich gut finde, aber mittlerweile übertreibt sie wirklich.“
Mein Herz beginnt vor Glück zu hüpfen.
„Natürlich müssen wir Schüler die Katzen versorgen“, fährt Aideen fort und wirkt dabei alles andere als glücklich. „Du hast keine Ahnung, wie viele Klos täglich gesäubert werden müssen. Ich bin für jede Katze dankbar, die ihr Geschäft draußen verrichtet.“
Schließlich bleibt sie vor einer Tür stehen, in die zu meiner Verwunderung eine Katzenklappe eingelassen ist. Aideen stößt die Tür auf und deutet mit einer präsentierenden Handbewegung in den Gang dahinter.
„Das“, sagt sie mit dramatischer Stimme, „ist der Katzenflügel.“
Ich spüre, wie meine Augen sich weiten und trete ehrfurchtsvoll ein. Die Türen zu den Zimmern sind alle offen, und was ich erblicke, gleicht für mich einem Paradies auf Erden.
„Das ist … traumhaft“, hauche ich und betrete einen Raum, dessen Wände mit unzähligen Klettermöglichkeiten bedeckt sind.
Ich streichle eine schwarze Katze, die träge gähnt und dann schnurrend die Augen schließt. Mir treten Tränen in die Augen, so überwältigt bin ich. So habe ich mir den ersten Tag auf der Darkwood Academy definitiv nicht vorgestellt. Geduldig begleitet mich Aideen bei meinem Rundgang, was ich ihr hoch anrechne. Ich sehe ihr an, dass sie meine Liebe zu Katzen nicht gerade teilt.
„Es wird Zeit, zum Abendessen zu gehen“, sagt sie jedoch irgendwann bei einem Blick auf ihre schwarze Armbanduhr. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich mein Handy nicht mehr habe, das mir normalerweise die Uhrzeit anzeigt.
„Wird die gesamte Schule dort sein?“, frage ich nervös, obwohl die Antwort auf der Hand liegt.
„Mach dir keine Sorgen“, sagt Aideen fröhlich und hakt sich bei mir ein. „Die Schüler hier sind wirklich nett. Die meisten jedenfalls.“
„Na wunderbar“, murmle ich und lasse mich widerstrebend mitziehen.
Wenigstens werde ich Jules wieder treffen und mich mit ihm austauschen können. Er hat vermutlich bereits das gesamte Gelände erkundet, was ich von mir nicht gerade behaupten kann.
Auf dem Weg in den Speisesaal begegnen wir vielen Mitschülern, die mich freundlich grüßen. Ich schenke allen ein Lächeln und entspanne mich allmählich wieder. Wir scheinen eine bunt gemischte Gruppe zu sein, was mich unendlich erleichtert. Ich entdecke ein Pärchen mit türkis gefärbten Haaren, das sicherlich regelmäßig Ärger wegen der Kleiderordnung bekommt, drei Freundinnen im Gothic-Stil und einen Jungen mit kunstvoll geschminkten Augen. Allerdings begegne ich auch ein paar Jugendlichen, die eher der Norm meiner alten Schule entsprechen: Markenkleidung, überheblicher Blick und perfekt gestylt. Immerhin schenken die mir keine Aufmerksamkeit. Vermutlich bin ich hier nicht mehr so auffällig wie in meinem alten Leben. Unsichtbar zu sein ist mir eindeutig lieber, als verspottet zu werden.
Als wir den Speisesaal betreten, merke ich sofort, dass das Wort „Saal“ übertrieben ist. Vielmehr handelt es sich um mehrere zusammenhängende, aber verwinkelte Räume mit vertäfelten Wänden und dicken roten Teppichböden. Überall verteilt stehen Vierertische, die ebenso antik wirken wie die meisten Möbel in diesem Gebäude. Es gibt sogar einen großen Kamin mit einem knisternden Feuer.
„Jeder hat hier seinen zugewiesenen Platz“, erklärt Aideen und führt mich zu einem Tisch, der zu meiner Freude in der Nähe des Kamins steht. „Da Mrs McArren mir schon vor deiner Ankunft aufgetragen hat, mich um dich zu kümmern, sitzt du natürlich neben mir. Oh, und Sabrina wirst du auch gleich kennenlernen.“ Den letzten Satz sagt sie mit deutlich weniger Begeisterung.
Ich betrachte neugierig die beiden anderen Mädchen, die an unserem Tisch sitzen, und weiß sofort, wer von ihnen Sabrina sein muss. Während die eine tiefschwarze Haare mit schneeweißen Strähnen hat und unzählige Piercings trägt, scheint die andere das genaue Gegenteil von ihr zu sein. Sie hat gelocktes braunes Haar und ihr pausbäckiges Gesicht wirkt so brav, dass wohl selbst ich neben ihr wie eine Rebellin aussehe. Ein hochgeschlossenes graues Wollkleid und graue Schnürschuhe vervollständigen ihr Gesamtbild. Ich weiß am besten, dass man Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen sollte, und beschließe darum zu versuchen, mich mit ihr anzufreunden.
„Hallo, ich bin Sharon“, stelle ich mich vor, während ich mich zu den beiden setze.
„Hi“, erwidert das schwarz-weiß-haarige Mädchen freudig und reicht mir die Hand. „Mein Name ist Madeline. Ich bin Aideens Freundin. Feste Freundin.“
Um ihre Worte zu unterstreichen, beugt sie sich über den Tisch und gibt meiner Zimmergenossin einen zärtlichen Kuss. „Freut mich, dich kennenzulernen“, sage ich. „Und du musst Sabrina sein.“
Das Mädchen nickt knapp und lächelt verkniffen. „So ist es. Wir teilen uns ein Zimmer.“
Ich lächle ebenfalls, weil ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Madeline beginnt ein Gespräch über den Kunstunterricht, in dem wohl gerade die Zeit des Barock durchgenommen wird.
„Diese Epoche ist so aufregend“, sagt sie und ihre klaren blauen Augen leuchten aufgeregt. „Ich wünschte, ich hätte in dieser Zeit gelebt.“
Aideen rümpft die Nase und tätschelt ihrer Freundin die Hand. „Wusstest du, dass die Menschen im Barock unheimlich gestunken haben und immer Döschen mit Blut bei sich trugen, damit die Flöhe da rein krabbeln?“
„Iiiih!“, ruft Madeline entsetzt und schüttelt sich.
Ich kann ein Lachen nicht zurückhalten und ernte dafür tatsächlich einen bösen Blick von Sabrina. Als Aideen es bemerkt, zieht sie vielsagend die Augenbrauen hoch, doch verkneift sich einen weiteren Kommentar.
Plötzlich verspüre ich ein Kribbeln im Nacken, und als ich mich instinktiv umdrehe, kann ich es nicht fassen. Dort, im Eingang zum Speisesaal, steht Jules. Und er ist nicht allein. Er wird von vier Jungs flankiert – und einer von ihnen ist der Blonde, dem ich bei unserer Ankunft begegnet bin.