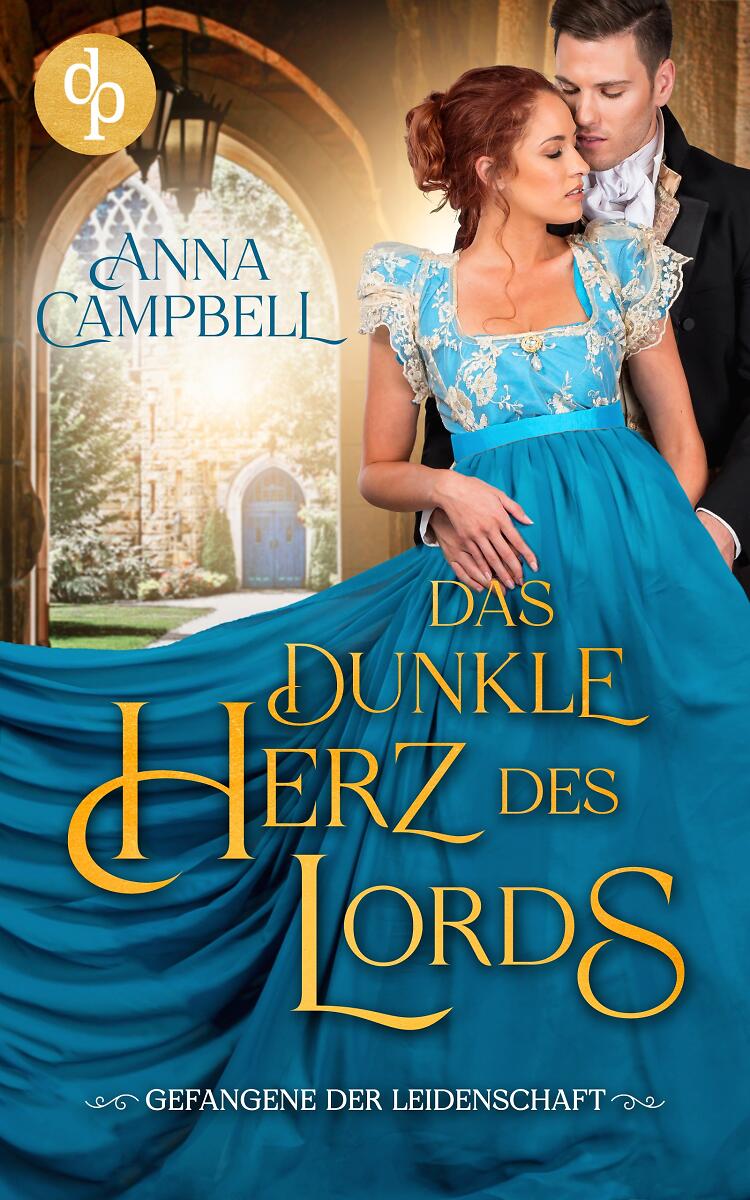1
Winchester, Anfang Februar 1821
»Ja, wen haben wir denn da?«
Die tiefe Stimme eines Mannes riss Charis aus ihrem kurzen, vom Schmerz durchdrungenen Halbschlaf. Sie zuckte zusammen und löste sich aus ihrer verkrampften Haltung. Verwirrt versuchte sie sich darüber klar zu werden, warum sie zitternd auf diesem stinkenden Stroh lag, anstatt sich in ihrem Bett auf Holcombe zu räkeln.
Von rasenden Schmerzen geschüttelt, unterdrückte sie ein unwillkürliches Stöhnen. Und einen Fluch, der ihrer ausgesprochenen Dummheit galt.
Wie hatte sie bloß die Gefahr vergessen und dann auch noch einschlafen können?
Doch als sie in den Pferdestall hinter dem großen Gasthof gestolpert war, unfähig, auch nur einen weiteren Schritt zu gehen, waren ihr die Augen vor Erschöpfung fast zugefallen. Und dabei war sie längst nicht weit genug entfernt, um sich in Sicherheit wähnen zu können.
Nein, das war sie ganz und gar nicht.
Der Schein der Laterne blendete ihre verschlafenen Augen und ließ sie kaum mehr als eine große Gestalt erkennen, die sich vor der Pferdebox abzeichnete. Sie unterdrückte die aufsteigende Panik und mühte sich hoch, bis sie sich gegen die rauen Holzbretter kauern konnte.
Sie bewegte ihren verletzten linken Arm und erstickte ein Wimmern. Charis verschränkte ihre zitternden Hände vor ihrem zerrissenen Oberteil. Das große fuchsfarbene Pferd, das den größten Teil der Box einnahm, spürte ihre Angst und bewegte sich unruhig.
Als der Mann die Laterne hob, um die Ecke zu beleuchten, in die Charis sich duckte, schreckte sie zurück. Hinter dem gelben Lichtschein sah sie bedrohliche Schatten, die immer dichter wurden und sich hinauf bis zu der abgeschrägten Decke vervielfachten.
»Bitte, haben Sie keine Angst.« Der Fremde machte mit einer schwarz behandschuhten Hand eine eigenartig abgehackt wirkende Geste. »Ich tue Ihnen nichts.«
In seinem prächtigen Bariton schwang ehrliche Besorgnis mit. Obwohl er keinen Schritt auf sie zumachte, ließ Charis’ lähmende Angst nicht nach. Ihre eigenen grausamen Erfahrungen hatten sie gelehrt, dass Männer logen, auch wenn sie samtweiche, gebildete Stimmen hatten.
Ein stechender Schmerz in ihrer Brust erinnerte sie daran, dass sie keinen Atemzug mehr gemacht hatte, seit er sie gefunden hatte. Die Luft, die sie in ihre leeren Lungenflügel einsog, war schwer von Pferdedung, Heustaub und dem beißenden Gestank ihrer eigenen Angst.
Sie drehte den Kopf und schaute sich den Mann richtig an. Ihr stockte vor Erstaunen der Atem.
Er sah ausgesprochen schön aus.
Schön. Das war ein Wort, das ihr vorher noch nie im Zusammenhang mit einem Mann in den Sinn gekommen war. In diesem Fall aber fiel ihrem aufgewühlten Verstand keine andere Bezeichnung ein.
Schönheit aber, so rein und vollkommen wie die dieses Mannes, erschreckte sie, verkörperte sie doch genau jene elegante Welt, die sie aufgeben musste, um zu überleben.
Trotz ihrer Angst widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit seiner gut geschnittenen Stirn, den Wangenknochen und der Kieferpartie und dann auch seiner geraden, vornehm geformten Nase. Er war von der Sonne gebräunt, was für Februar ungewöhnlich war.
Mit seinen ausgeprägten, unwiderstehlichen Gesichtszügen und dem zerzausten Haar, das so schwarz wie das eines Zigeuners war, sah er aus wie der Prinz aus einem Märchen.
Doch an Märchen glaubte Charis nicht mehr.
Hastig schaute sie sich in der engen Box um, doch der Mann blockierte den einzigen Ausgang. Noch einmal verfluchte sie im Stillen ihre eigene Dummheit. Mit ihrer unverletzten Hand tastete sie den Boden nach einem Stein oder verrosteten Nagel ab, irgendetwas, mit dem sie sich verteidigen konnte. Ihre zitternden Finger fanden jedoch nichts als stechendes Stroh.
Starren Blickes beobachtete sie, wie er die Laterne auf dem Boden absetzte. Seine Bewegungen waren langsam und bedächtig, offensichtlich sollten sie beruhigend wirken. Doch wenn er nach ihr greifen wollte, hätte er nun beide Hände frei. Sie straffte sich, bereit, sich ihren Weg hinaus kratzend und um sich schlagend zu erkämpfen.
In der angespannten Stille hörte sie nichts außer ihrem rasselnden Atmen. Noch nicht einmal das unablässige Heulen des Windes. Der kräftige Fuchs bewegte sich wieder, wieherte ängstlich und warf den Kopf gegen das Seil, mit dem er zum Gang hin angebunden war.
Was nur, wenn das nervöse Tier in diesem beengten Raum anfangen würde zu treten oder zu bocken? Die Hufe des Pferdes waren riesig, ja, tödlich. Die Angst lag wie ein Stein in ihrem Magen. Ihr Zufluchtsort erwies sich von Minute zu Minute mehr als eine schlechte Wahl.
Warum, o Gott, hatte sie ihre Müdigkeit und die Schmerzen nicht einfach ignoriert und war weitergegangen? Selbst eine Hecke hätte ihr sichereren Schutz geboten als dieser Stall hier.
Der Mann betrat die Box, sein langer, bis zu den Knöcheln reichender schwarzer Mantel umspielte seine Stiefel. Charis wich zurück, bereit sich loszureißen, sollte er nach ihr greifen. Noch einmal brach ihr der kalte Schweiß aus. Er war so viel größer und stärker als sie.
Doch er griff nur beherzt nach dem Halfter des Tieres, das dies, ohne sich zu widersetzen, geschehen ließ. »Ruhig, Khan.« Er streichelte die Nase des Wallachs, während seine Stimme eine weiche, verführerische Melodie annahm. Der Mann strahlte ein fast spürbares Selbstvertrauen aus. »Sie müssen sich vor nichts fürchten.«
Die ausgewogene Mischung aus Autorität und Fürsorge in seinem Ton hätte Charis beruhigen sollen. Stattdessen lief es ihr jedoch vor Angst eiskalt den Rücken hinunter. Sie wusste alles über Männer, die dachten, sie regierten die Welt. Sie wusste, wie sie reagierten, wenn ihren Wünschen nicht entsprochen wurde. Verstohlen suchte sie immer fieberhafter nach einer Waffe.
Khan, dieses dumme, gutgläubige Geschöpf, beruhigte sich unter den gemurmelten, fürsorglichen Worten seines Herrn. Wenn er schon den Namen des Tieres kannte, musste der Mann wohl dessen Besitzer sein. Dass er kein Stallbursche sein konnte, war selbst für einen Fremden offensichtlich. Dafür zeugte sein Auftreten von einer viel zu großen, selbstverständlichen Vornehmheit, und auch seine Kleidung war zu gut.
Sie fand keine Waffe.
Sie müsste also ihren Weg zurück in die Freiheit im Laufschritt erobern und hoffen, ihre steifen, müden Beine würden sie tragen. Verstohlen schob sie sich hoch. Selbst diese kleine Bewegung verursachte ihr höllische Schmerzen. Jeder einzelne Muskel tat ihr weh, und der Arm brannte wie Feuer. Sie biss sich auf die Zähne, um nicht laut zu wimmern.
»Es gibt keinen Grund zu fliehen.« Sein Blick wich nicht von dem inzwischen lammfrommen Pferd.
»Doch, gibt es«, hörte sie sich selbst sagen, obwohl sie beschlossen hatte, nichts zu erwidern. Durch ihr geschwollenes Gesicht klang ihre Stimme ungewohnt rauchig, doch ihre vornehme Sprache und Ausdrucksweise machten aus ihr ein Objekt des Interesses. Ein bemerkenswertes, unvergessliches Objekt.
Ein Ziel.
Unbeholfen bemühte sie sich, aufzustehen, um sich nicht ganz so ausgeliefert zu fühlen. Dabei stieß sie gegen die Bretterwand und unterdrückte einen gellenden Schrei. Sie kämpfte gegen den schwindelerregenden Schmerz an und hielt den pochenden Arm wiegend vor sich.
Ihre ungelenke, ruckartige Bewegung versetzte den Fuchswallach in Angst. Er begann wieder zu tänzeln und zu schnauben. Ihr Vater hatte sich mit Pferden gut ausgekannt, und so war Charis sofort aufgefallen, dass Khan aus bester Zucht stammte und edles Blut in seinen Adern floss.
Ganz wie der Mann, der noch immer den Kopf des Tieres hielt.
»Ich weiß, dass Sie Angst haben.« Zuerst dachte sie, er spräche zu Khan. Er widmete seine Aufmerksamkeit weiterhin dem Pferd. »Ich weiß, dass Sie Hilfe brauchen.«
Hilfe, um sie dem Gesetz zu übergeben, dachte sie bitter. »Warum sollte das Ihre Sorge sein? Sie sind ein Fremder.«
»Das stimmt. Doch wenn Sie sich die Box meines Pferdes aussuchen, dann wählen Sie damit auch mich.«
»Das war reiner Zufall.«
Endlich schaute er sie direkt an. Es war sicherlich nur dem heimtückischen Licht der Laterne zuzuschreiben, dass seine Augen über diesen ausgeprägten Wangenknochen so dunkel und glänzend leuchteten. »Das ganze Leben ist ein Zufall.«
Charis erschauerte unter seinem taxierenden, tiefschwarzen Blick. Irgendwie schien dieser Moment bedeutungsvoll zu sein, obwohl er es eigentlich gar nicht sein konnte. Sie schüttelte das eigenartige, unheimliche Gefühl ab und reckte das Kinn vor. Ihr reichten schon die Probleme im Hier und Jetzt, sie musste sich nicht auch noch mit dem Metaphysischen auseinandersetzen.
»Bitte treten Sie beiseite, mein Herr. Ich muss mich auf den Weg machen.«
»Für eine Dame ist das Reisen ohne Begleitung eine äußerst unsichere Angelegenheit.« Er rührte sich nicht von der Stelle, und seine Stimme klang ruhig, doch blieb sie unerbittlich.
Als ob seinen mahnenden Worten Nachdruck verliehen werden sollte, drang auf einmal das laute Gejohle eines Gelages vom Gasthaus über den Hof. Die Schenke musste in einer solch kalten Nacht voller Menschen sein. Das eiskalte Wetter war einer der wenigen Glücksfälle für Charis, hatten deshalb doch die Stallburschen ihre Posten verlassen und sich ans wärmende Feuer begeben. Andernfalls hätten sie ihr Versteck sofort entdeckt. Warum war dieser Fremde nicht wie jeder andere Mensch mit Sinn und Verstand im Warmen geblieben, anstatt in diesem riesigen Stall herumzuwandern?
»Das lassen Sie mal meine Sorge sein.« Wie in aller Welt sollte sie bloß entkommen? Noch einmal schalt sie sich im Stillen, nicht weitergegangen zu sein.
»Wollen Sie mir Ihre Geschichte nicht anvertrauen?« Er sprach besänftigend auf sie ein. Seine Stimme klang fast so wie in den Momenten, als er Khan beruhigt hatte. Und so wie Khan spürte auch sie die heimtückische Verlockung dieses wohlklingenden Baritons. »Sie sind offensichtlich in Schwierigkeiten. Ich schwöre …«
Er unterbrach seinen Satz abrupt und drehte den Kopf in Richtung Haupteingang, der am Ende des langen Ganges lag. Erst dann vernahm auch Charis das schlurfende Geräusch herannahender Schritte. Was für ein unmenschlich scharfes Gehör musste der Mann haben, diese über das knarrende Dach und den pfeifenden Wind hinweg zu hören.
»Etwas nicht in Ordnung, Mylord?«, erklang aus ein paar Metern Entfernung eine raue, männliche Stimme, von der sie vermutete, sie gehörte einem Stallburschen.
Mylord? Sie hatte mit ihrer Vermutung hinsichtlich seines gesellschaftlichen Ranges richtig gelegen. Mit einem verängstigten Wimmern schlich Charis zurück in den Schatten, während der Mann die Laterne so hielt, dass Dunkelheit sie einhüllte. Dabei hörte sich das Rascheln des Strohes so laut wie ein Gewehrschuss an.
»Guter Mann, ich schaue nur nach meinem Pferd.« Lässig schlenderte er aus ihrem Blickfeld zu dem Neuankömmling.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?« Die Stimme des Stallburschen wurde deutlicher, während er herantrat.
Charis hielt den Atem an und kauerte sich, soweit wie möglich vom Licht entfernt, in eine Ecke. Der Arm tat ihr bei der Bewegung weh, doch achtete sie nicht weiter auf den stechenden Schmerz.
»Nein. Es ist alles in Ordnung.«
Charis vergrub ihre feuchten Hände in den zerrissenen, fleckigen Röcken ihres einstmals eleganten Tageskleides und betete leise darum, unentdeckt zu bleiben. Ihr Herz schlug wild gegen ihre Rippen. Sie wunderte sich, dass der Stallbursche es nicht hörte und hereinkam, um der Sache nachzugehen.
»Auf jeden Fall ist es eine kalte Nacht für Mensch und Tier.«
»Zu kalt, um draußen unterwegs zu sein.« Trotz des resoluten Tonfalles seiner Stimme klang der Mann entspannt und sorglos. »Such dir ein Plätzchen am Feuer und trink einen Krug auf mich.«
Charis schob sich so weit wie möglich hinter Khans Kruppe, behielt dabei aber seine todbringenden Hinterläufe immer im Auge.
»Zu gütig von Ihnen, Mylord. Das mache ich sehr gerne.« In der Antwort des Stallburschen schwang überraschte Dankbarkeit mit. »Und Sie sind sich sicher, dass ich nicht helfen kann?«
»Vollkommen sicher.« Die Stimme des Fremden ließ erkennen, dass der Stallbursche entlassen war. Welche Münze daraufhin auch immer ihren Besitzer wechselte, sie bewirkte, dass seinem Wunsch sofort entsprochen wurde.
»N'abend, Mylord.«
Der Stallbursche trottete mit einer schier unerträglichen Langsamkeit davon. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis der Fremde wieder am Eingang der Box erschien. Er hob die Laterne an und sah Charis zitternd an der Rückwand lehnen.
»Er ist weg.«
»Dem Himmel sei Dank.« Erleichtert stieß Charis den Atem aus, den sie ihrem Gefühl nach für eine Stunde angehalten hatte. Sie wusste nicht, warum der Mann ihr geholfen hatte, sich zu verstecken. Es zählte allein, dass er es getan hatte.
Mit einem besorgten Ausdruck in seinen bemerkenswerten Gesichtszügen betrachtete er sie eingehend. »Sie können hier nicht bleiben. Im Gasthof wimmelt es nur so von Menschen. Sie können sich glücklich schätzen, so lange unbehelligt geblieben zu sein. Kommen Sie wenigstens so weit heraus, dass ich Sie sehen kann.«
»Ich will nicht …«, begann sie unsicher. Obwohl der Mann keinen Versuch unternahm, sie aus der Box herauszuziehen, presste sie sich gegen die Bretter. Die Bewegung rief bei ihren verkrampften Muskeln erneut Schmerzen hervor.
Der Mann trat beiseite, um ihr zu zeigen, dass er keine Gefahr bedeutete. Endlich war der Weg frei für sie, um die Beine in die Hand nehmen zu können.
Sie zögerte.
Sie biss sich auf ihre Unterlippe, wünschte sich dann aber sofort, es nicht getan zu haben, als das aufgesprungene Fleisch anfing zu stechen. Der Fremde hatte recht. Wie groß waren ihre Chancen, weiter als über den Hof des Gasthauses zu kommen? So nah an ihrem Zuhause würde sie sicherlich erkannt werden.
Als ob er ihre Gedanken lesen könnte, verschwand die Wachsamkeit aus seinen Augen. »Ich heiße Gideon.«
Selbst als Charis an Khan vorbei in den Gang humpelte, blieb sie weiterhin auf Flucht eingestellt, sollte dieser Mann – Gideon – sich ihr nähern. Seine Haltung jedoch wirkte entspannt, und er ließ ihr genügend Raum. Zitternd atmete sie ein und prüfte so ihre geprellten Rippen. Mit jeder Sekunde, in der er sie nicht anfasste, fühlte sie sich sicherer.
»Sie sind verletzt.« Er klang ruhig, doch in seinen Augen flammte ein dunkles Zornesfeuer auf, während er sie mit einem kurzen, schweifenden Blick von Kopf bis Fuß betrachtete.
Sie war sich bewusst, wie eine heruntergekommene Schlampe aussehen zu müssen. Die Schamesröte kroch ihr den Hals hoch, und sie hob die rechte Hand, um ihr zerfetztes Oberteil zu umklammern. Hubert, ihr Stiefbruder, hatte es zerrissen, als er sie festgehalten hatte. Nun klaffte der Ausschnitt auseinander und gab den Blick auf den Spitzenrand ihres Unterkleides frei.
Ihr Gesicht fühlte sich an, als wäre es von tausend Wespen gestochen worden. Ihr blaues Kleid war zerrissen und schmutzig und für diese eisige Nacht vollkommen ungeeignet. Ihre Arme, die unter den Flügelärmeln hervorragten, waren übersät von Kratzern und Blutergüssen. Zeugnisse der erlittenen Schläge und ihrer wilden Flucht durch die Felder und Wälder. Ihr Haar sah wie ein verfilztes Vogelnest aus. Die meisten Haarnadeln hatten sich gelöst, als sie sich den Weg durch die Hecken um Holcombe herum erkämpft hatte.
Bevor Gideon ihr Fragen stellen oder, noch schlimmer, sein Mitleid zum Ausdruck bringen konnte, das unter seiner Empörung wie ein Geist lauerte, setzte sie zu der von ihr vorbereiteten Geschichte an. »Ich war auf dem Weg zu meiner Tante nach Portsmouth … als mich Wegelagerer überfielen.«
Dieses verfluchte, verräterische Stocken. Lügen waren ihr noch nie leicht über die Lippen gekommen. Er würde ihr kein Wort glauben. Was bedeutete, dass das Spiel für sie aus und vorbei war.
Gespannt und atemlos wartete sie darauf, von ihm als Heuchlerin und Ausreißerin beschimpft zu werden, doch er riss sich lediglich den Mantel von den Schultern und trat näher.
Voller Angst wich sie mit schnellen, stolpernden Schritten zurück, bis sie gegen einen dicken Pfosten stieß. Der Aufprall fuhr wie ein gezackter Blitz durch ihren Arm, und sie erstickte einen Schrei. Sie beugte sich unwillkürlich etwas vor, und er ergriff die Gelegenheit, ihr den Mantel über die zitternden Schultern zu legen.
»Hier.« Er trat wieder zurück.
Langsam ließ ihre panische Angst nach, und sie richtete sich unter der Last des Mantels auf, durch dessen Wärme sie sich wieder mehr wie ein Mensch fühlte. Sie ging in dem riesigen Kleidungsstück, das auf dem Boden schleifte, fast unter. Der Stoff roch angenehm nach frischer Luft, aber auch sauber und leicht nach Moschus, was auf seinen Besitzer zurückzuführen sein musste.
Er war klug genug, sie nicht zu bedrängen. Dennoch blieb sie weiterhin nervös und war sich seiner stattlichen Größe und des muskulösen, schlanken Körpers, der nun in einem schwarzen Jackett, einem weißen Hemd und braunen Kniehosen steckte, unter denen sich wunderbar lange, starke Beine abzeichneten, bewusst. Von den blank polierten Stiefeln bis hin zu dem einfachen, weißen Halstuch zeugte seine Kleidung von höchster Qualität.
»Da…danke«, sagte sie durch ihre klappernden Zähne.
Sie unterdrückte stechende Tränen und hielt die herrlich mollig warmen Falten des Wollmantels wie einen Schild umklammert. Komisch, doch sein freundliches Verhalten erwies sich als die größte Bedrohung ihrer angeschlagenen Nerven.
»Wie heißen Sie?«
Ihr den Mantel gegeben zu haben schien im Gegenzug irgendeine Geste des Vertrauens zu verlangen.
»Sarah Watson«, antwortete sie widerwillig und bediente sich des Namens der mürrischen Gesellschafterin ihrer Großtante in Bath. Sie erinnerte sich an ihre guten Manieren und machte einen steifen Knicks.
Er kam ihr mit einer weiteren dieser eigenartigen, angedeuteten Gesten zuvor. Der Blick seiner dunklen Augen blieb auf sie gerichtet. »Darf ich Sie zu einer Freundin oder Verwandten nach Winchester begleiten, Miss Watson? Dieser Stall ist kein sicherer Ort.«
Sie war, verdammt noch mal, nirgendwo sicher. Tief in ihrem Bauch stieg die Angst wieder hoch, als sie daran dachte, was passieren würde, wenn ihre Stiefbrüder sie wieder einfingen.
»Ich bin … ich komme nicht aus diesem Teil des Landes, Sir. Ich stamme aus Carlisle.« Sie nannte den Namen der am weitest entfernt liegenden Stadt, die ihr einfiel, ohne dabei die Grenze nach Schottland zu überschreiten. Sie straffte ihre wackligen Beine, die unter ihr nachzugeben drohten, und schaute ihn mit einem Blick an, der ihm zu verstehen gab, ihre Geschichte bloß nicht anzuzweifeln.
Seine Miene war ausdruckslos, aber sie wusste, er würde ihre Antworten auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen. »Das ist für eine Dame, so ganz allein auf sich gestellt, eine lange Reise. Haben Sie nicht wenigstens ein Dienstmädchen als Begleitung dabei?«
Sie verstrickte sich mit jedem Moment tiefer in ein Netz von Lügen. Aber was für eine andere Wahl hatte sie? Gäbe sie ihre Identität preis, würde jeder gesetzestreue Bürger sie den Behörden übergeben.
Trotzdem ging ihr die Antwort schwer über die Lippen. »Mir ist mein Dienstmädchen davongelaufen, als wir in London in eine andere Kutsche stiegen.«
»Sie sind wahrlich vom Pech verfolgt, Miss Watson.«
Lag in seiner Antwort ein Hauch von Ironie? Sein Gesichtsausdruck zeugte weiterhin von höflichem Interesse. Sie entschloss sich, seine Bemerkung für bare Münze zu nehmen. »Das war ein furchtbarer Tag, in der Tat.« Zumindest das war wahr. »Alles, was ich mir jetzt wünsche, ist so bald wie möglich das Haus meiner Tante zu erreichen.«
»Sie sind weit weg von Portsmouth.«
Wusste sie das nicht? Sie hatte kaum mehr als ein paar Meilen geschafft, und schon wurde ihr Durchhaltevermögen derart auf die Probe gestellt. Sie hatte kein Geld, um in einer Kutsche mitzufahren, und selbst wenn, könnte sie die Fahrt aus Furcht, erkannt zu werden, nicht wagen. Einmal mehr holte sie die schier unüberwindbare Aufgabe ein, die sie sich gestellt hatte. Doch dann erinnerte sie sich an das, was sie auf Holcombe erwartete. »Ich werde es schon schaffen.«
»Wie denn?«, fragte er sie mit einer ersten Spur an Strenge in der Stimme. »Sie sind zum Umfallen müde.«
Als sie ihre eigenen Zweifel mit einem solchen Nachdruck formuliert hörte, wurde die Verzweiflung in ihr noch größer. »Was sein muss, muss sein.«
Sie presste die Lippen zusammen. Ihre mürrische Antwort beeindruckte ihn genauso wenig wie sie selbst. »Wenn Sie mir gestatten, biete ich Ihnen an, Sie mitzunehmen.«
Charis wich zurück, als er versuchte, sie zu berühren. Es schien zu schön, um wahr zu sein. Die Möglichkeit, nach Portsmouth zu gelangen, war ein Geschenk des Himmels. Ihre Stiefbrüder würden ihr bestimmt schon auf den Fersen sein. Wenn sie mit diesem Fremden mitginge, könnte sie Boden gutmachen. Und nicht nur das; ihre Stiefbrüder würden darüber hinaus nur nach einer jungen Frau fragen, die alleine reiste.
»Ich möchte Ihnen keine Umstände machen.« Ihre Worte sollten endgültig klingen, doch ihre Verletzungen ließen sie schleppend und undeutlich sprechen.
»Meine Reise geht ohnehin in Richtung Süden.« Sein Gesichtsausdruck wurde düster. »Das Gebot der Ritterlichkeit verbietet mir, eine Frau dem Wohlwollen der Schurken zu überlassen, denen sie auf der Straße begegnen könnte.«
Trotz schlechter körperlicher Verfassung und aufkeimender Angst musste Charis grimmig lachen. Sie machte eine abweisende Geste mit ihrer unverletzten Hand.
»Ritterlichkeit ist selbst in den allerbesten Zeiten eine Eigenschaft, auf die man sich nicht verlassen sollte.«
»Sie haben mein Wort als Ehrenmann, dass Ihnen bei mir nichts passiert, Miss Watson«, erwiderte er, ohne zu lächeln.
Sie hatte in letzter Zeit so viele Lügen gehört, dass sie einfach davon ausgehen musste, dass alles, was aus dem Mund eines Mannes kam, gelogen war. Doch eigenartigerweise glaubte sie ihm, als er ihr sein Wort gab.
Mein Gott, wenn dieser Mann sie vergewaltigen wollte, hätte er es bestimmt inzwischen schon getan. Alle ihre Sinne hielten ihn für dieses Hirngespinst.
Einen wahren Ehrenmann.
Oder war sie einfach nur von seinem bemerkenswerten Aussehen geblendet? Sie war schutzlos und erschöpft. Unaufhörlicher Schmerz vernebelte ihre Sinne. Sie fürchtete um ihr Leben.
Die Pause zog sich und ging über in eine angespannte Stille. Hätte er versucht, sie zu überreden, sie wäre ohne wenn und aber gegangen. Doch er ließ ihr Zeit, sich zu entscheiden. Nur an seinen gestrafften Schultern unter der hervorragend geschnittenen Jacke war zu erkennen, dass ihre Antwort ihm nicht gleichgültig war und er sie mit Spannung erwartete.
Schließlich seufzte sie. Es klang nach Einverständnis. Angst schnürte ihr die Kehle zu, aber ihre Verzweiflung war stärker. Während sie sich fragte, ob sie sich gerade auf die Seite des Teufels geschlagen hatte, nickte sie kurz. »Dann nehme ich Ihre Hilfe dankend an.«
»Zuallererst aber bringen wir Sie zu einem Arzt.«
Einen kurzen Moment lang hatte sich ihre laut pochende Furcht in ein entfernt klingendes Trommeln verwandelt. Die Möglichkeit zur Flucht hatte ihr zugewinkt wie das rettende Boot einem ertrinkenden Menschen. Nun erinnerten seine Worte sie daran, dass das rettende Ufer noch nicht erreicht war. Und vielleicht würde sie es auch nicht erreichen, außer mit viel Glück und Verstand.
Jeder Arzt in Winchester würde sie sofort erkennen. Sie schüttelte abweisend den Kopf. »Ich brauche keinen Arzt. Meine Verletzungen sind nicht so schlimm, wie sie aussehen.«
Sie wartete auf einen Einwand, doch es kam keiner. »In Ordnung. Kein Arzt.«
Erleichtert sackte sie zusammen, obwohl sie versuchte, ihre heftige Reaktion zu verbergen. Anscheinend war sie auf den unglaublichsten Ehrenmann des Landes gestoßen. Bisher nahm er ihre Geschichte für bare Münze, ohne einen Moment daran zu zweifeln.
Eigenartig, sie hatte ihn nicht für einen Dummkopf gehalten. Aus diesen wachsamen, dunklen Augen sprach Intelligenz.
Vielleicht war er einfach nur naiv. Noch ein Grund mehr, mit ihm zu gehen. So würde sie ihm ohne Schwierigkeiten in Portsmouth entwischen können.
Was sie danach machen würde, lag noch völlig im Dunkeln. Sie besaß weder Geld noch hatte sie Freunde. Zumindest nicht solche, die sie der Gefahr einer Verfolgung aussetzen könnte. Ihre Stiefbrüder hatten bereits ihre einzige nahe Verwandte, ihre Großtante, so sehr in Angst und Schrecken versetzt, dass sie sie ihnen ausgehändigt hatte. Sie trug ein goldenes Medaillon und den Perlenring ihrer Mutter, nichts davon war sehr wertvoll. Irgendwo musste sie sich in den nächsten drei Wochen verstecken. Das erdrückende Dilemma, in dem sie sich befand, ließ sie erschauern.
Eins nach dem anderen. Sie vertrieb ihre Verzagtheit. Zuerst musste sie unerkannt aus Winchester herauskommen.
»Gideon.«
Es war die Stimme eines Mannes, die da aus Richtung der Stalltür kam. Charis schreckte auf, sah noch einmal nach ihren Verletzungen und spürte, wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich. Ihr Retter streckte die Hände aus, hielt dann aber mitten in der Bewegung inne, um sie nicht zu berühren. »Seien Sie unbesorgt. Er ist ein Freund.«
Da war sie wieder, diese ihm angeborene Autorität. Charis blieb dort stehen, wo sie war, obwohl ihr das Herz bis zum Hals schlug und der kalte Schweiß ausbrach.
»Ich bin hier«, rief Gideon, ohne seinen Blick von ihr abzuwenden.
Ein weiterer Mann, so groß wie ihr Retter, schlank, dunkel und offensichtlich ausländischer Herkunft, obwohl er vornehme, maßgeschneiderte Kleidung aus London trug, spazierte ins Blickfeld. »Wen hast du denn da?«
»Miss Watson, das ist Akash. Akash, darf ich dir Miss Sarah Watson vorstellen. Sie ist überfallen worden und braucht Hilfe.«
Akashs glänzende braune Augen ruhten auf Charis. Sie wartete darauf, dass er sie nach ihrer fadenscheinigen Geschichte fragte. Doch nach einer Pause zog er nur eine fein geschwungene, schwarze Augenbraue in Richtung Gideon hoch.
»Ich gehe davon aus, wir bleiben hier nicht über Nacht?« Seine Stimme klang durch und durch englisch, obwohl er aussah, als sei er einem arabischen Märchen entsprungen.
»Du weißt, dass ich eilig nach Penrhyn muss.«
»In der Tat«, sagte er mit neutralem Ton.
»Ja, über Portsmouth.«
»Es war mir schon immer ein dringender Wunsch, Portsmouth kennenzulernen.« Die Aussicht, der Kälte trotzen zu müssen, um einer Fremden zu helfen, ließ Akash vollkommen ungerührt. Zu ungerührt.
Plötzlich fühlte sich Charis ganz und gar nicht mehr sicher. Sich in die Hände zweier ihr unbekannter Männer zu begeben war die Krönung an Dummheit. Dass sie ihrer dünnen Geschichte so schnell Glauben geschenkt hatten, schien eher verdächtig als beruhigend zu sein.
Mit zittrigen Beinen ging sie zurück zu Khan, der sanft in ihr Ohr wieherte. »Ich darf mich Ihnen und Ihrer Gutmütigkeit nicht aufdrängen. Ich werde mich alleine auf den Weg zu meiner Tante machen.«
»Kein Ehrenmann würde einen solchen Plan gutheißen, Miss Watson.« Gideon hörte sich unnachgiebig an.
So konnte sie auch klingen. »Trotzdem werde ich gehen.«
Gideon lächelte kurz zu seinem Begleiter hinüber. Einen kurzen Moment lang erstrahlte sein Gesicht vor Vergnügen. Seine dunklen Augen funkelten, kleine Falten bildeten sich auf seinen Wangen und um die Augen, und gerade, weiße Zähne blitzten auf.
Charis’ Herz hörte mit einem Ruck auf zu schlagen, um dann unberechenbar zu rasen. Trotz der Angst, der Schmerzen und des Misstrauens sehnte sie sich törichterweise nach nichts anderem, als ihn wieder lächeln zu sehen.
Sie anlächeln zu sehen.
»Ich glaube, Akash, du hast dem jungen Ding Angst eingejagt.«
Sie überging Akashs leises Lachen und schaute Gideon mit finsterem Blick an. »Ich muss doch sehr bitten, Sir. Ich bin kein junges Ding.«
»Würden Sie sich besser fühlen, wenn ich Ihnen das hier gäbe?«
Sie schaute nach unten und sah, dass er ihr eine kleine Duellpistole reichte. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass er in seine Jacke gegriffen hatte. Die Müdigkeit machte sie benommen. Die Müdigkeit und die Auswirkungen brutaler Schläge.
Und das sorglose Lächeln eines Mannes, was zuzugeben am schlimmsten war.
Sie starrte auf die Waffe, als würde sie nicht erkennen, worum es sich dabei handelte. Der Raum versank in Wellen der Dunkelheit. Das Rauschen in ihren Ohren schwoll an, bis es alle anderen Geräusche übertönte.
»Akash!«
Gideons Schrei klang weit entfernt, und während die Welt anfing sich zu drehen, fingen starke Arme sie auf.
Doch sie lag nicht in den starken Armen, die sie sich wünschte. Selbst durch ihre Beinahe-Ohnmacht erkannte sie diese betrübliche und beschämende Tatsache.
Gideon starrte das halb bewusstlose Mädchen an, das Akash in seinen Armen hielt. Sie war ein Bündel aus schlanken Armen und Beinen und aufgebauschten, blauen Röcken. Ihr leuchtendes, bronzefarbenes Haar ergoss sich wie ein Wasserfall über Akashs schwarzen Ärmel. Der Saum ihrer Röcke war zerrissen und nass, und ihre blassblauen Halbstiefel waren völlig verdreckt.
Er ballte seine herunterhängenden Hände zu Fäusten. Zorn stieg in ihm hoch. Wer zum Teufel hatte sie so misshandelt? Gewalt war ihm auch schon vor dem vergangenen Jahr ein Gräuel gewesen. Und nun hatte irgendein Dreckskerl dieses Mädchen fast totgeschlagen.
Gideon kannte sich zu gut mit Gewalt aus, um nicht sofort zu erkennen, dass sie schwer verletzt war. Verflucht, er wollte, dass ein Arzt nach ihr sah.
Aber das junge Ding war so verängstigt. Er wusste ebenfalls, wie Angst und Verzweiflung aussahen, die er trotz ihres zerschundenen Gesichtes unmissverständlich in den wunderschönen, haselnussbraunen Augen des Mädchens las. Wenn er sie zu sehr bedrängte, würde sie Reißaus nehmen und Gott weiß auf welche Gefahren treffen.
Was zur Hölle war ihr zugestoßen? Er hatte sofort ihre armseligen Lügen durchschaut. Er könnte darauf wetten, dass es keine Wegelagerer gewesen waren, die sie überfallen hatten, doch verdammt noch mal, jemand hatte es getan.
Sinnlose Wut, die er bestens kannte, stieg in ihm hoch und hinterließ einen üblen, bitteren Geschmack in seinem Mund. Er trat zurück und atmete schwer durch die Nase, als kämpfte er um seine Beherrschung. Er musste ruhig blieben, anderenfalls würde er sie zu sehr ängstigen.
Das Mädchen rührte sich in Akashs festem Griff, und ihre blasse Hand umklammerte seinen Mantel. Gideons Aufmerksamkeit wurde auf einen wertvollen, wenn auch altmodischen Perlenring gelenkt, der an einem ihrer schlanken Finger steckte. Ihm war auch nicht das hübsche goldene Medaillon entgangen, das unter ihrem zerrissenen Oberteil hervorlugte. Wer immer sie auch war und in welcher akuten Not sie sich befand, sie musste aus einer wohlhabenden Familie stammen.
Ihre belegte Stimme war voller Kummer. »Bitte … bitte lassen Sie mich los. Ich kann gehen. Wirklich.«
Gideons Zorn verrauchte und wurde durch allergrößtes Mitgefühl ersetzt. Seine Wut würde ihr keine Hilfe sein. Sie war klein, wehrlos und herzzerreißend tapfer. Und jung. Es war vollkommen unmöglich, bei all den Prellungen und Blutergüssen ihr genaues Alter zu bestimmen, doch ging er davon aus, dass sie kaum älter als Anfang zwanzig war.
Außer ihrem Mut kam auch noch Stolz hinzu, der Gideons Herz rührte. O ja, er verstand, wie sie sich fühlte. Wahrscheinlich war ihr außer ihrem Stolz nichts geblieben.
Ihr Stolz und zwei Fremde, die sie in Sicherheit bringen würden, egal ob sie ihnen vertraute oder nicht.
Er konnte sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Zu schmerzlich war seine Erinnerung daran, wie es war, sich ohne die geringste Hoffnung auf Sieg gegen mächtige Feinde zur Wehr zu setzen.
»Mylord, gibt es ein Problem mit dem Gaul?«
Mit einem Anflug von Verärgerung drehte sich Gideon zur Tür. Akash war in den Stall gekommen, um nach ihm zu sehen, obwohl er das, darauf angesprochen, nie zugeben würde. Nun stand Tulliver in der Tür, um sich wie ein ruppiges, grauhaariges Kindermädchen nach dem Befinden seines Schützlings zu erkundigen.
Die Sehnsucht nach Freiheit erfüllte ihn wie eine tosende Welle. Was würde er nicht alles geben, um nur für einen kurzen Moment einmal allein und unbeobachtet zu sein. Frische Luft in seinem Gesicht. Ein gutes Pferd. Und nichts als weites, offenes Land.
Und im Umkreis von hundert Meilen keine Menschenseele.
»Sir Gideon?«
Der kühne, herrliche Traum verblasste. Dabei konnte er seinen Freunden nicht einmal einen Vorwurf machen. Sie waren zuverlässige Männer, beide. Er war so lange allein gewesen, dass ihre treue Ergebenheit ihm immer noch außergewöhnlich erschien.
Sie hatten inzwischen bestimmt erkannt, dass er diese Ehre überhaupt nicht verdiente.
»Wir brechen auf, Tulliver«, sagte er zu dem stämmigen ehemaligen Soldaten, den er nach dessen unermüdlichem Dienst auf dem Schiff von Indien als seinen Diener eingestellt hatte. »Wir brauchen eine Kutsche und Proviant für die Reise. Und einen Fahrer, denke ich.«
»Das ist nicht notwendig, Mylord. Ich kann mit einem Gespann umgehen.«
Gideon hatte im Laufe der Zeit herausgefunden, dass Tulliver mit so ziemlich allem umgehen konnte, angefangen bei einem außer Rand und Band geratenen Mannsbild bis hin zu einer verwöhnten Herzogin. Die Ostindien-Kompanie hatte mit seinem Ausscheiden einen wahren Schatz verloren.
Tullivers Augen zuckten zwar gelassen beim Anblick der Frau in Akashs Armen, doch stellte er keine Fragen. Das tat er nie. Und dennoch schaffte er es, über alles Bescheid zu wissen. Er verbeugte sich und begab sich wieder nach draußen.
»Bitte, Sir«, sagte das Mädchen mit zittriger Stimme.
Schweigend setzte Akash sie ab. Sie taumelte, und Gideon streckte die Hand nach ihr aus, besann sich dann aber und zog sie wieder zurück. Das Mädchen hob das Kinn und fixierte ihn, als hätte er eine unanständige Bemerkung auf einem Debütantinnenball gemacht.
Wieder berührte ihr Stolz etwas tief in seinem Innern. Etwas, das so rein und frisch war, so zart und grün wie ein junger Trieb nach der ersten Schneeschmelze. Er war erstaunt, dass er nach all seinen Erlebnissen überhaupt noch zu einem solch unverdorbenen Gefühl fähig war.
»Ich bereite Ihnen Unannehmlichkeiten.« Während sie einen Schritt von Akash weg machte, richtete sich ihre Aufmerksamkeit immer noch auf Gideon. Ungelenk hielt sie ihren Arm vor sich. »Obwohl ich Ihnen durchaus dankbar bin, kann ich nicht zulassen, dass Sie meinetwegen Unannehmlichkeiten haben.«
Sie sprach wie eine verdammte achtzigjährige Herzogin. Dazu noch wie eine verflixt überhebliche. Trotz der ernsten Situation spürte Gideon, wie seine Mundwinkel zuckten.
Was ihr natürlich nicht entging. »Sie machen sich über mich lustig.«
Er stritt es nicht ab. Stattdessen wurde sein Ton schärfer. »Miss Watson, Sie brauchen unsere Hilfe. Ich kann Sie nicht wie ein Paket zusammenschnüren und dazu zwingen, mit uns in der Kutsche mitzufahren.«
Eine glatte Lüge. Das könnte er wohl. Und würde es auch tun, falls er müsste.
»Sollten Sie es dennoch versuchen, schreie ich«, erwiderte sie trotzig, während ihre Schultern unter der Last des Mantels nach unten sackten. Und unter der Last ihrer Verzweiflung und ihrer Angst, vermutete er.
Warum war er so wild entschlossen, dieses kratzbürstige, verwahrloste Ding zu retten? Zitternd vor Schmerzen, Angst und Müdigkeit stand sie vor ihm. Ihr dunkelbronzenes Haar hing wirr um ihr Gesicht. Ihr Kleid war zerrissen und fleckig. Die Prellungen ließen von ihrer Schönheit nichts erkennen.
Er verkniff sich ein bissiges Lachen.
Selbst wenn sie eine Schönheit war, was hätte er davon?
Er verwarf die bittere Frage und schaute sie geradewegs an. »Wir haben Februar. Es ist kalt. Und Sie sind zu angeschlagen, um Ihre Reise alleine fortsetzen zu können.«
Tulliver erschien im Eingang. »Ich habe die Kutsche organisiert. Der Wirt ruft gerade die Stallburschen zusammen.«
Gideon sah, wie Angst in die Augen des Mädchens stieg. Sie wollte eindeutig von niemandem gesehen werden. Er musste wissen, warum das so war. »Gehen Sie zurück in die Pferdebox, Miss Watson. Khan wird Ihnen nichts tun.«
»Ich habe keine Angst vor Ihrem Pferd«, entgegnete sie trotzig, zog den Mantel fest um ihren schlanken Körper und entschwand in die Dunkelheit.
Die Bediensteten des größten Gasthauses in Winchester waren es gewohnt, sich um den Transport von Gästen zu kümmern. Die kleine, geschlossene Kutsche war innerhalb von Minuten fertig für die Abreise.
Gideon betrat die Pferdebox. Das Mädchen kauerte hinter Khan. Er versuchte, seine instinktive Reaktion auf den beengten Raum und die Dunkelheit zu unterdrücken. Doch die behandschuhte Hand, die er auf die grobe Holztrennwand legte, bebte.
Gott sei Dank verbarg das düstere Licht seine Reaktion. Wie sollte sie Vertrauen zu einem Retter haben, wenn dieser schon beim kleinsten Schatten zitterte wie Espenlaub?
»Wir sind bereit.«
Sie richtete sich auf und schlug den Mantel um sich wie einen Umhang. Er vermutete, dass sie zu große Schmerzen hatte, um ihren Arm in den Ärmel zu zwängen. Als sie zu ihm aufschaute, nahm er den Glanz in ihren Augen wahr. »Warum tun Sie das?«
Er zuckte mit den Schultern und versuchte sich den Anschein zu geben, als gehörte es zu seinen täglichen Aufgaben, umherirrenden Mädchen zu helfen. »Sie brauchen Hilfe.«
»Das trifft es wohl nicht ganz. Ich sehe doch, welche Umstände ich Ihnen bereite.«
»So verdiene ich mir Pluspunkte für den Himmel«, antwortete er mit einer Leichtigkeit, die er nicht verspürte. Er reichte ihr das Knäuel aus seiner Hand. »Ich dachte, Sie könnten dies vielleicht gebrauchen.«
Sie zögerte. »Was ist das?«
»Ein Schultertuch. Es ist kalt heute Nacht.« Außerdem musste sie ihr auffallendes Haar bedecken, wenn sie die Kutsche bestieg. Doch wenn er ihr das sagte, wüsste sie, dass er ihre Geschichte für einen Haufen Lügen hielt.
»Woher haben Sie das?« Ihre Stimme klang misstrauisch.
Er unterdrückte ein Lächeln. Sie war so argwöhnisch, so abwehrend. Dennoch, wenn er wollte, könnte er sie von einem Augenblick zum anderen bewusstlos machen. Die Möglichkeit war ihm in den Sinn gekommen, doch er hatte sie verworfen. Ihr war bereits genug Gewalt angetan worden.
»Tulliver hat es einer Dame im Gasthof abgekauft.«
Gute, dicke Wolle – einen Augenblick lang dachte er mit Bedauern an die glänzenden, herrlichen Stoffe, die er in Indien gesehen hatte. Er hielt das braune Tuch kurz an seine Nase und schnupperte daran. »Es riecht zwar nach Hund, aber es wird Sie warm halten.«
Sie brach zu seiner Überraschung in kurzes, schallendes Gelächter aus. »Ich habe in einem Stall geschlafen. Ein Hauch von Eau de chien wird mich nicht im Geringsten stören.«
Das junge Ding hatte Rückgrat. Er hatte schon immer Mut bewundert, und dieses Mädchen hier hatte mehr davon, als ihr guttat. Ein müdes, eingerostetes und lange verschollenes Gefühl rührte sich in seinem Herzen. Er unterdrückte die unerwünschte Empfindung und bot ihr noch einmal das Tuch an. »Miss Watson?«
»Danke.«
Wie er vermutet hatte, schlug sie es um ihren Kopf und ihre Schultern. Sie war in seinem langen Mantel und ihrer Kopfbedeckung nicht zu erkennen. Er konnte nicht umhin zu bemerken, wie sie ihren rechten Arm schützend vor sich hielt. War er gebrochen? Abermals wünschte er sich, sie würde ihm erlauben, sie zu einem Arzt zu bringen.
»Und nehmen Sie auch das, nur für den Fall.« Er reichte ihr eine Pistole und beobachtete, wie sie sie in einer der großen Manteltaschen verstaute. »Wissen Sie, wie man sie benutzt?«
Er wusste bereits die Antwort. Sie ging so selbstverständlich mit ihr um, dass ihr Waffen offensichtlich vertraut sein mussten.
»Ja. Mein Vater war Jäger. Er hat mir das Schießen beigebracht.«
Gideon bot ihr Deckung, als sie den Hof zur Kutsche überquerten. Akash saß bereits auf seinem temperamentvollen Schimmel.
Als Gideon den Wagenschlag für Miss Watson öffnete, traf ihn der Blick seines Freundes. Was Akash wohl von den nächtlichen Ereignissen und dem zusätzlichen Mitglied ihrer Reisegesellschaft hielt? Er wusste, er würde es bald herausfinden. Nur weil Akash dazu noch nichts gesagt hatte, bedeutete das nicht, dass er nichts zu sagen hätte.
Das Mädchen blieb stehen, als erwartete sie von Gideon, dass er ihr die Hand zum Einsteigen reichte. Was abermals auf ein privilegiertes Leben schließen ließ. Als Gideon darauf nicht reagierte, stieg sie allein in die Kutsche.
Tulliver folgte ihnen mit seinem kräftigen Pferd und mit Khan und band beide hinten an der Kutsche an. Gideon warf einen letzten Blick auf den Hof, über den der Wind fegte. Anscheinend schenkte ihnen niemand Beachtung.
In einer eisigen Nacht wie dieser war jeder, der nicht draußen sein musste, bemüht, ein warmes Plätzchen zu finden. Die wenigen Bediensteten, die sich im Freien aufhielten, schienen sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Dennoch, die alten Gewohnheiten waren Gideon in Fleisch und Blut übergegangen, und so nahm er jedes Detail der Szenerie in sich auf.
Tulliver stellte sich neben ihn. »Sind Sie bereit, Mylord?«
»Ja.« Ein letzter, vergewissernder Blick, doch niemand schien an ihrer kleinen Reisegesellschaft besonders interessiert zu sein. »Machen wir uns auf den Weg.«
»Sehr gut.«
Tulliver nahm auf dem Kutschbock Platz, und Gideon bestieg die Kutsche, wo ihn die geheimnisvolle, scharfzüngige Miss Watson mit ihren verängstigten Augen erwartete.
Während er ihre zerzauste Gestalt musterte und sie steif auf der mit Leder bezogenen Bank hockte, wurde ihm plötzlich zum ersten Mal bewusst, dass er seit langem wieder etwas anderes verspürte als gelangweilte Abscheu vor sich selbst. Sie löste bei ihm Neugierde aus, Besorgnis, Fürsorge.
Miss Watson vollbrachte auf sehr merkwürdige Weise Wunder. Lange schon lebte er ein solch erbärmliches Leben, dass selbst ein Gefühl wie dieses sich wie die Eisschmelze im Frühjahr nach einem schier endlosen Winter anfühlte.
Er sank in den gegenüberliegenden Sitz und schloss die Augen zu einem vorgeblichen Schlummer, wobei er sich fragte, welch unerwartete Folgen seine impulsiven Handlungen noch nach sich ziehen würden. Tulliver trieb die Pferde mit einem lauten Ruf und einem Peitschenhieb an, und die Kutsche setzte sich ruckartig in Bewegung. Holpernd fuhren sie vom Hof des Gasthauses hinaus in die eisige Winternacht.
2
Schreckliche Bilder verfolgten Charis in ihren Träumen. Immer und immer wieder schlugen die Fäuste von Hubert auf sie ein, während Felix hämisch grinsend zuschaute. Ihr wurde der Arm verrenkt. Der abschließende Schlag gegen den Kopf ließ sie ins Vergessen taumeln.
Als sie ihre geschundenen Augen öffnete und die von der Laterne beschienenen Umrisse der schäbigen Kutsche erkannte, erwartete sie, das Echo ihrer Schreie zu hören. Die einzigen Geräusche jedoch waren das Knarren der Kutsche und das Heulen des Windes. Sir Gideon lag ausgestreckt ihr gegenüber und schien zu schlafen.
Angenehm wohltuende Erleichterung durchströmte sie, und zitternd holte sie tief Luft, was einen stechenden Schmerz ihrer geprellten Rippen auslöste. Im Augenblick war sie vor Felix und Hubert sicher.
Zittrig und den Tränen nahe, kauerte sie sich in die Ecke, als wollte sie noch immer den Schlägen ausweichen. Das Schaukeln des Gefährts ließ ihren Kiefer qualvoll pochen. Ihr verletzter Arm war starr vor Schmerz, und sie unterdrückte ein Stöhnen, als sie ihn gegen ihre bebende Brust hielt.
Lange Minuten vergingen, in denen sie gegen die schwindelerregende Pein ankämpfte, doch allmählich wurde ihr Kopf klarer und ihre Atmung gleichmäßiger. Mit ihrem unverletzten Arm schlang sie den Mantel um sich wie eine Decke und richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihren Begleiter. Er hatte seinen schlanken Körper mit einer solch eleganten Hingabe ihr gegenüber ausgestreckt, dass ihr albernes Herz anfing zu rasen.
Und das nicht aus Angst, wie sie beschämt feststellen musste.
Als sie losfuhren, hatte sie sich auf ein Verhör eingestellt, doch Sir Gideon hatte es sich auf der Bank bequem gemacht, die Arme auf der Rückenlehne ausgebreitet, die Beine in die Ecke gestreckt und die Augen geschlossen. Es sah so aus, als hätte er sich seitdem kaum bewegt.
Ihn so zu beobachten schürte eine ungeziemende Vertrautheit, obwohl sein Gesichtsausdruck selbst jetzt noch Zurückhaltung und Verschlossenheit verriet. Eine Locke seines schwarzen Haares fiel über seine Augenbraue, was ihn hätte verletzlich wirken lassen können. Tat es aber nicht.
Als ihr Blick über seine gemeißelten Gesichtzüge wanderte, bemerkte sie schockiert, dass er ungefähr in ihrem Alter war. Sein entschlossenes Auftreten hatte sie glauben lassen, er wäre in seinen Dreißigern. Doch jetzt, wie er mit geschlossenen Augen so da lag, sah er nicht älter aus als fünfundzwanzig. Beschämt über ihre ungeziemende Neugierde, starrte sie auf die lockeren Falten, die der Mantel über ihrem Schoß warf.
»Sind wir bald in Portsmouth?«, fragte sie mit krächzender Stimme und blickte hoch.
Er öffnete die Augen und sah sie prüfend an. »Nein. Wir sind noch nicht weit weg von Winchester.«
Die Kutsche kam ruckartig zum Stehen. Charis beugte sich vor, um die Vorhänge beiseite zu schieben. Sie befanden sich auf einem riesigen Feld. Der Wechsel von befestigter Straße zu Wiese unter den Rädern musste ihre Albträume gestört haben.
Auf dem Gelände war außer Gras nichts zu sehen. Auch kein Licht in der Ferne. Sie könnten gut und gerne tausend Meilen von wo auch immer entfernt sein.
Das, was in Winchester wie ein vertretbares Risiko ausgesehen hatte, entpuppte sich urplötzlich als entsetzliche Bedrohung. Sie war alleine und schutzlos an einem einsamen, verlassenen Ort mit drei Männern, die sie nicht kannte. Ihre Nackenhaare stellten sich auf, und Angst schnürte ihr die Kehle zu.
Wie konnte sie nur so naiv gewesen sein? Wie nur so schrecklich dumm? Sie tastete aufgeregt nach dem Türriegel. Vielleicht hatte sie eine Chance, in der Dunkelheit zu entkommen.
»Was haben Sie vor?«, fragte Sir Gideon mit beiläufigem Interesse in der Stimme.
War Gideon überhaupt sein richtiger Name?
»Aussteigen«, murmelte sie.
Sie spannte die Muskeln an und erwartete, dass er nach ihr griff, doch er richtete sich nur gegen das verschlissene Polster auf. Zittrig atmete sie durch die Zähne und fuhr mit ihrer panischen Suche nach dem Riegel fort.
»Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen nichts tun«, sagte er ruhig.
»Ich weiß, was das Wort eines Mannes wert ist.«
Ah, endlich.
Die Tür sprang auf, und sie fiel nach vorne – aber nur um direkt in den Armen des Komplizen ihres Entführers zu landen. Sie schrie auf, während sich kräftige Hände durch den üppigen Mantel um ihre Oberarme legten.
»Lassen Sie mich los!« Sie widersetzte sich seinem festen Griff. Ihr geschundener Körper wehrte sich gegen die ungestümen Bewegungen, doch sie kämpfte weiter.
»Verzeihen Sie, Miss Watson.«
Zu ihrem Erstaunen setzte Akash sie behutsam auf dem Boden ab und trat zurück. Sie hörte, wie die Kutsche hinter ihr knarrte und Sir Gideon in die Nacht sprang. Er stellte sich neben sie, groß, höflich, und mit einem im hellen Mondlicht zu sehenden fragenden Gesichtsausdruck.
Tulliver kam dazu, in seiner Hand eine Laterne. »Was hat dieses ganze Theater hier zu bedeuten?«
Er starrte sie an, als wäre sie dem Irrenhaus entflohen. Ihre Hysterie ebbte ab, und ihr wurde mit einem Mal schmählich bewusst, dass sie sich zum Narren gemacht hatte.
»Miss Watson hatte den Eindruck, wir hätten sie hierher gebracht, um sie uns auf niederträchtige Weise gefügig zu machen.«
Sowohl die Ironie in Sir Gideons Stimme als auch der irritierte Blick, mit dem Tulliver sie bedachte, zeigten ihr, welchem Trugschluss sie bei ihrem Sprung aus der Kutsche unterlegen gewesen war. Die Panik, die sie erfasst hatte, ließ nach. Sie zog den dicken Wintermantel um ihren zitternden Körper und bemerkte plötzlich, dass ihr Retter nur eine Jacke über seinem Hemd trug.
»Sie müssen frieren.« Sie nestelte mit ihrer gesunden Hand an dem Mantel.
»Nein«, erwiderte er scharf und ließ sie durch eine Geste wissen, sie sollte damit aufhören, berührte sie dabei aber nicht. »Mir ist nicht kalt«, sagte er dann in einem sanfteren Ton.
»Miss Watson, wir haben angehalten, damit ich Ihre Verletzungen untersuchen kann«, sagte Akash.
Ihr Blick wanderte automatisch zu Sir Gideon. »Sie kennen sich mit so etwas aus?«
Die Laternen der Kutsche tauchten sein glänzendes Haar in einen Schimmer von Gold, während er den Kopf schüttelte. »Akash und Tulliver zusammen ergeben einen ganz guten Arzt. Außerdem haben wir Verbände, Salben und Laudanum zum Lindern der Schmerzen.«
»Ich werde kein Schlafmittel nehmen.« Sie ging auf wackligen Beinen einige Schritte zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Kutsche stieß.
So schlimm die Schläge auch gewesen waren, es war Felix’ Drohung gewesen, ihr ein Schlafmittel zu geben und sie Lord Desaye auszuliefern, damit er sie vergewaltigen könnte, was sie schließlich zur Flucht von Holcombe Hall bewogen hatte. Als ihr Martyrium begann, hatte sie erwogen zu fliehen, sich dann aber für das vermeintlich sichere Leben auf Holcombe entschieden. Das ging nur wenige Wochen gut. Sie hatte alle Untaten ihrer Stiefbrüder ertragen können, solange sie letztendlich noch das Versprechen auf Freiheit hatte. Auf der Straße, schutzlos, mittellos und hilflos, wäre sie auf die Gnade all jener angewiesen gewesen, die ihr begegnet wären.
Doch als ihre Stiefbrüder ihr mit der unaussprechlichen Erniedrigung drohten, verblassten die Gefahren der Straße im Vergleich dazu.
Wie sehr sie die Farrells verabscheute. Ihre beiden Stiefbrüder bildeten in ihrer Bedrohung einen krassen Gegensatz. Hubert war durch und durch ein Tyrann, bei dem rohe Gewalt vorherrschte, während Felix einen scharfen Verstand gepaart mit ungeheurer Boshaftigkeit besaß. Egal was Hubert ihr auch angetan hatte, es war Felix, vor dem sie sich wirklich fürchtete.
Als Antwort auf ihr heftiges Weigern zuckte Akash mit den Schultern, was leicht befremdlich aussah. »Wenn Sie erlauben, möchte ich wenigstens nachsehen, was Sie haben.«
»Sei vorsichtig. Sie hat sich den Arm verletzt«, sagte Sir Gideon eindringlich.
»Mein Freund, du weißt, sie ist bei mir in guten Händen.«
Zögerlich trat Charis vor. Akash nahm vorsichtig den Mantel von ihren Schultern und legte ihn in die Kutsche.
Sie stand in ihrem zerschlissenen Kleid vor ihnen. Die Nacht war eiskalt, der schneidende Wind ein Vorbote von Schnee. Zitternd hob sie die Hand, um ihr Oberteil festzuhalten, wobei sie in einem mitleiderregenden Versuch, ihren Stolz zu wahren, das Kinn hob.
Sie machte gerade noch so einen tugendhaften Eindruck, doch sie wusste, wie schmutzig, verletzt und hilflos sie war. Im Mondlicht und im Schein der Kutschenlampen mussten ihre Blutergüsse und Schürfwunden in beschämender Deutlichkeit zu sehen sein.
»Setzen Sie sich bitte, Miss Watson.« Sir Gideon nahm einen Klapphocker von hinten aus der Kutsche und stellte ihn hinter sie. Er reichte ihr auch das nach Hund riechende Tuch.
Dankbar setzte sie sich hin – ihre Knie waren weich wie Butter – und legte sich das Tuch um die Schultern. Zögernd streckte sie ihren Arm zu Akash aus. Er runzelte die Stirn, als er ihr Handgelenk vorsichtig bewegte. Obwohl sein Griff geübt und sicher war, zuckte sie zusammen.
»Es ist verstaucht, aber nicht gebrochen«, sagte er endlich.
Erleichterung durchströmte sie. Das Leben würde, selbst wenn sie unversehrt war, schwierig werden. Ein gebrochenes Handgelenk hingegen wäre ihr Untergang gewesen. Gott sei Dank hatte Hubert aufgehört, auf sie einzuprügeln, als sie das Bewusstsein verloren hatte.
Akash untersuchte ihre Hände, Arme, den Nacken und fuhr dann vorsichtig mit den Fingern über ihr Gesicht. Er berührte sie so sachlich, dass sie sich langsam entspannte und wahrnahm, was um sie herum geschah. Während Tulliver nach den Pferden schaute, holte Gideon eine Ledertasche, die mit Bändern an der Rückseite der Kutsche befestigt war. Er stellte sie wortlos neben Akash, wandte sich ab und begann ein Feuer zu machen.
Um sich sowohl von der Kälte als auch der schmerzhaften Untersuchung abzulenken, beobachtete sie, wie Gideon mit seinen geschickten Händen diese alltägliche Arbeit verrichtete. Es verschlug ihr den Atem, als die knisternden Flammen sein außergewöhnliches Gesicht erstrahlen ließen und seine sanften Wangenknochen und sein kantiges Kinn in goldenes Licht tauchten.
Wunderschön. Das Wort glitt wie das Glissando einer Harfe durch sie hindurch.
Ihn zu betrachten machte sie unruhig und nervös. Sie rutschte auf dem Stuhl hin und her, damit der eigenartige Druck in ihrer Magengegend nachließe.
»Es tut mir leid, Miss Watson.« Akash hob die Hände von ihren Schultern.
Sie schüttelte den Kopf. »Es ist nichts.«
Sie errötete, als sie bemerkte, dass er mitbekommen hatte, wohin ihre Aufmerksamkeit gewandert war. Sie rückte sich auf dem wackligen Stuhl gerade, bemüht, ihren wilden Herzschlag unter Kontrolle zu bringen.
Als sie in Akashs Gesicht hochschaute, ließ das Mitgefühl in seinen Augen sie erschaudern. Er war ein gut aussehender Mann, doch diese Erkenntnis war mit der gleichen Leidenschaftslosigkeit verbunden, als betrachtete sie ein schönes Porträt. Im Gegensatz zu der von Sir Gideon bewegte seine Attraktivität nichts in ihrem Innern.
Sir Gideon verschwand in der dunklen Nacht und kehrte mit einem Zinnkessel in der Hand zurück, den er auf das Feuer stellte. Sie hatte sich so darauf konzentriert, ihn zu beobachten, dass sie den Bach, der weiter weg plätscherte, nicht bemerkt hatte. Hinter ihr murmelte Tulliver leise vor sich hin, während er sich um die Pferde kümmerte.
Als das Wasser heiß geworden war, nahm Akash ein feuchtes Tuch, um ihr das Blut und den Schmutz von dem geschwollenen Gesicht zu waschen. Die geringste Berührung schmerzte, und sie spannte all ihre Muskeln an, um still sitzen zu bleiben. Bemüht darum, nicht nach Sir Gideon zu schauen, schmiegte sie sich in ihr Tuch.
Doch am Schluss konnte sie nicht anders. Schweigend ertrug sie, wie Akash ihre Wunden versorgte, und schaute hinüber auf die andere Seite des Feuers, wo Gideon stand.
Der Blick seiner glühenden, dunklen Augen ruhte auf ihr. Tiefe Aufruhr, die sie nicht verstand, lag darin. Seine behandschuhten Hände waren zu Fäusten geballt. Sie las Zorn in seinem Gesichtsausdruck, den gleichen Zorn, den er beim ersten Anblick ihres zerschundenen Gesichtes gezeigt hatte. Sie zitterte, obwohl sie wusste, dass dieses Gefühl nicht ihr, sondern ihren Peinigern galt.
Als er bemerkte, dass sie ihn beobachtete, nahm er eine steife Haltung an und drehte sich weg, um weitere Feldstühle zu holen, die er um das Feuer gruppierte. Sie neigte ihren Kopf, obwohl sie wusste, dass es sich für eine Dame nicht geziemte, ihr Interesse unverhohlen zu zeigen.
Akash öffnete die Tasche und griff nach einem kleinen Gefäß aus Keramik. Als er es öffnete, drang ein stechender Geruch nach Kräutern durch die Luft. Ruckartig wich sie zurück, doch sie zwang sich, still sitzen zu bleiben, als er ihr die Salbe auf die Wangen strich. Ihr Gesicht fühlte sich an, als wäre es mit Brennnesseln gepeitscht worden. Sie konnte die Schmerzen nicht unterdrücken und rang laut nach Luft.
»Verdammt noch mal. Du tust ihr weh!« Gideon ermahnte Akash und machte einen Schritt in Richtung der beiden. »Sei vorsichtig.«
Akash ging nicht weiter auf seinen Freund ein und sprach zu Charis. »Haben Sie noch weitere Verletzungen?«
Ihre Rippen schmerzten, und sie hatte sich bei ihrem Sturz im Dunkeln die Knie aufgeschlagen. Doch ihr Arm und ihr Gesicht waren bei Weitem das Schlimmste. »Nein, keine.«
Fragend blickte Akash sie starr an, während er den Deckel wieder auf den Tiegel legte. »Sind Sie sich sicher?«
»Ja, ganz sicher.« Sie wollte, dass er aufhörte. Sie konnte einfach nicht mehr. Ihr verschwamm schon die Sicht, und sie hatte die Grenze der Belastbarkeit erreicht.
»Ich verbinde noch Ihren Arm, damit die Schwellung zurückgeht.« Akash öffnete ein anderes Gefäß und verstrich den Inhalt auf ihrem Arm. Er roch so stark wie die erste Salbe, doch als er in Kontakt mit ihrer Haut kam, spürte sie die Wärme, die davon ausging.
Sicherlich würde diese Tortur bald vorüber sein. Das Tuch und ihr dünnes Kleid boten wenig Schutz gegen den scharfen Wind. Als Akash ihr den Arm verband, ließ sie den Kopf vor Erschöpfung hängen.
Gideon kniete sich hin und zog ein weiteres Leinentuch aus der Tasche, in der sich die Medikamente befanden. »Vielleicht ist eine Schlinge eine gute Idee für ihren Arm.«
»Ja.« Akash band das Tuch um ihren Hals. Der schmerzhafte Druck in ihrem Arm ließ sofort nach. »Geht es Ihnen so besser?«
»Ja, danke.« Mit einem zittrigen Lächeln schaute sie hoch zu ihm. »Sehr freundlich von Ihnen.«
Er zuckte wieder so seltsam mit den Schultern. »Keine Ursache. Ich weiß, Ihnen tut alles weh und Sie sind traurig, aber ich kann keine bleibenden Schäden feststellen. Ich werde Sie noch einmal bei Tageslicht untersuchen, doch so weit ich sehen kann, sind Ihre Verletzungen oberflächlicher Natur. Sie werden im Nu wieder auf dem Damm sein.«
Sie war zu müde, um etwas anderes als ein weiteres, geflüstertes Danke herauszubekommen. Gideon nahm den Wintermantel aus der Kutsche und legte ihn ihr um die Schultern. Als dessen schwere Falten sie einhüllten, kitzelte sein vertrauter Geruch sie wieder in der Nase. Sie spürte sofort seine angenehme Wärme. »Kommen Sie, setzen Sie sich ans Feuer.«
Und damit entschwand er sogleich aus ihrer Reichweite. Gedankenverloren sah sie ihm nach, wie er davonschritt. Dann überfiel sie Müdigkeit, und sie taumelte zum Feuer, wo sie erschöpft auf einen Stuhl sank. Ihre eiskalten Glieder kribbelten, als die wohltuende Wärme sie langsam durchdrang.
Sir Gideon hob einen schweren Weidenkorb voller Lebensmittel hinten aus der Kutsche. Ihr Magen knurrte, wie sie beschämt feststellte. Ihre Stiefbrüder hatten sie in der Hoffnung, Hunger würde ihren Widerstand untergraben, nur mit dem Notwendigsten versorgt.
Sie aßen schweigend. Während sie alle vier um das fröhlich vor sich hinknisternde, kleine Feuer saßen, machte Charis sich auf weitere Fragen gefasst. Welche auch immer. Doch ihre Begleiter schienen ihre Lügen erstaunlicherweise für bare Münze zu nehmen. Die Schuld aber lag wie ein Stein in ihrem gefüllten Magen, und sie schob die Schweinefleischpastete weg, von der sie kaum gegessen hatte.
»Geht es Ihnen besser?«, fragte Sir Gideon sie, dem ihre plötzliche Stille aufgefallen war. Natürlich war es ihm aufgefallen. Er hatte sie ja auch während des Essens die ganze Zeit durch die Flammen hinweg beobachtet. Er saß ihr genau gegenüber, rechts und links von ihm Tulliver und Akash.
»Ja, danke.«
Überrascht stellte sie fest, dass es stimmte. Ihr Gesicht brannte nicht mehr so schlimm, und der Schmerz in ihrem Arm hatte sich von einem durchdringenden, quälenden Stechen in ein entferntes Pochen verwandelt. Sie nippte an dem Rotwein aus dem Becher, den Sir Gideon ihr gegeben hatte. Die Männer mussten sich mit der Flasche begnügen. Es fühlte sich eigenartig intim an, ihre Lippen an etwas zu führen, an dem die von Gideon schon einmal gewesen waren. Fast wie ein Kuss. Der Gedanke ließ sie erröten, auch kribbelten ihre Lippen, als ob sie tatsächlich die seinen streiften.
Tulliver ging nach dem Abendessen zurück zu den Pferden, während Akash und Sir Gideon aufräumten. Charis runzelte die Stirn. Konnte Gideon wirklich ein Mann ihres eigenen Standes sein, wenn er solch profane Aufgaben verrichtete? Er schien sich eigenartigerweise in diesem primitiven Umfeld wohlzufühlen. Ihre Stiefbrüder würden nicht im Traum daran denken, sich durch das Abwaschen eines Tellers oder das Anzünden eines Feuers die Hände schmutzig zu machen. Die Dienerschaft war da, um zu dienen. Die feine Gesellschaft war dazu da, bedient zu werden.
Die Beziehung zwischen den beiden Männern war genauso rätselhaft. Tulliver schien ein freundschaftliches Verhältnis mit seinen beiden Herren zu pflegen. Akash stand bestimmt ebenfalls in Gideons Diensten, auch wenn er und Sir Gideon sich gegenseitig wie ihresgleichen behandelten.
Gideon hielt ihr die Tür zur Kutsche auf, half ihr aber wieder nicht hinein, wie es sich für einen Gentleman gehört hätte. Aber nicht für ihn. Stattdessen trat Akash vor und half ihr in die Kutsche. Mit dem Mantel, der locker um ihre Schultern hing, und der Schlinge um ihren Arm wäre sie ansonsten nicht hineingekommen.
»Miss Watson.«
»Danke, Akash«, murmelte sie und bekam fast nicht mit, als er sich wieder entfernte.
Denn ihr Blick lag gebannt auf Sir Gideon, der draußen wartete. Eine Wolke hatte sich vor den Mond geschoben und tauchte sein bemerkenswertes Gesicht abwechselnd in Licht und Schatten. Immer noch schön, aber finster.
Sie zitterte. »Wer sind Sie?«, fragte sie flüsternd und sank auf ihren Sitz.
»Wer sind Sie?« Sein dunkler Blick blieb auf sie gerichtet, während er den Platz ihr gegenüber einnahm, mit dem Rücken zu den Pferden, so wie es sich für einen Gentleman gehörte.
Um sich gegen die beißende Kälte des frühen Morgens zu schützen, schlug Charis den Mantel um sich und brachte ihren verletzten Arm in eine bequemere Position. »Ich habe zuerst gefragt.«
Das war eine kindische Antwort, und als seine Mundwinkel zuckten, wusste sie, dass er sie als solche aufgefasst hatte. Wie der Rest seines Gesichtes war auch sein Mund perfekt. Eine gerade, gut geschnittene Oberlippe, die Charakter und Integrität verriet. Eine vollere Unterlippe, die …
In ihr rumorte und schwelte etwas, während sie ihn in der aufgeladenen Stille anstarrte. Was für ein Zeitpunkt, jetzt zu realisieren, noch nie zuvor mit einem Mann alleine gewesen zu sein, außer mit einem Verwandten. Der Moment barg eine Gefahr, die mit ihrem Bestreben, Felix und Hubert zu entkommen, nichts zu tun hatte.
»Ich heiße Gideon Trevithick.« Er hielt kurz inne, als ob er eine Antwort erwartete, doch der Name sagte ihr nichts. »Von Penrhyn in Cornwall.«
»Ist der Familiensitz berühmt?« Vielleicht erklärte das seine Reaktion.
Wieder lächelte er ironisch. »Nein. Das sind zwei Fragen. Ich bin an der Reihe.«
Sie erstarrte, doch damit hatte sie rechnen müssen. Schon seit langem.
»Ich bin müde.« Das stimmte, wenngleich sich ihre niedergeschlagene Stimmung durch die gute Mahlzeit und die geschickten Hände Akashs um einiges aufgehellt hatte.
»Unsere Reise nach Portsmouth dauert noch lange. Sicherlich können Sie noch ein paar Augenblicke wach bleiben, um Ihren Mitreisenden zu unterhalten.«
Sie seufzte. Sie fühlte sich durch ihre Verlogenheit ganz schlecht. Doch was blieb ihr anderes übrig? Wenn sie die Wahrheit sagte, übergäbe er sie dem nächsten Richter.
»Ich habe Ihnen gesagt, wie ich heiße und wo ich lebe. Ich habe Ihnen erzählt, welches Unglück mir heute widerfahren ist. Ich bin auf dem Weg zu meiner Tante in Portsmouth.« Mit ihrer unverletzten Hand zupfte sie an der Schlinge und verriet so ihre Nervosität. Zitternd holte sie Luft und drückte die Hand flach auf ihren Schoß. »Wir sind Reisende, die sich rein zufällig begegnet sind. Was sonst müssten Sie noch wissen?« Sie wusste, wie ungehobelt sie sich anhörte, doch sie verabscheute Lügen.
In dem düsteren Licht glich sein Gesicht einer wunderschönen Maske. Sie hatte keine Ahnung, ob er ihr glaubte oder nicht. Er hielt inne, als ginge er ihre Antworten noch einmal durch, und sprach dann mit düsterer Stimme. »Ich muss wissen, warum Sie sich so fürchten.«
»Die Wegelagerer …«
Eine abweisende Geste mit seiner behandschuhten Hand brachte sie zum Schweigen. »Wären Sie tatsächlich von Dieben überfallen worden, hätten Sie sich nicht in einem Stall versteckt. Wollen Sie mir nicht Ihr Vertrauen schenken, Sarah?« Seine sanfte Bitte brachte ganz tief in ihr etwas zum Schwingen, und einen sehnsuchtsvollen Moment lang wollte sie ihm die Wahrheit sagen. Bis sie sich daran erinnerte, was auf dem Spiel stand.
»Ich … ich habe Ihnen vertraut«, sagte sie heiser. Sie schluckte nervös. Sie beim Vornamen zu nennen, auch wenn er falsch war, machte die Situation noch intimer. Und ihre Lügen noch verabscheuungswürdiger.
Ein Schatten der Enttäuschung zog über sein Gesicht, als er sich an das abgewetzte Leder zurücklehnte. »Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn ich nicht weiß, wovor Sie davonlaufen.«
»Aber das tun Sie doch schon.« Charis kämpfte mit den Tränen. Seine Großzügigkeit hatte etwas Besseres verdient als ihre Lügen.
Sie versuchte sich einzureden, dass er nur ein Mann war und diese Tatsache allein bereits Grund genug wäre, ihm nicht zu vertrauen. Die Behauptung klang hohl. Ihr Vater war ein guter Mann gewesen. Alles an Sir Gideon Trevithick ließ darauf schließen, dass auch er ein guter Mann war.
Sie zwang sich zu einem festeren Ton. »Ich bin an der Reihe mit Fragen.«
Er verschränkte die Arme vor seiner kräftigen Brust und musterte sie unter gesenkten, schwarzen Augenbrauen. »Schießen Sie los.«
Es machte ihr Angst, wie sehr sie sich danach sehnte, mehr über ihn zu erfahren. Die Neugierde wütete in ihr wie ein hohes Fieber. Doch zu ihrem eigenen großen Entsetzen war die erste Frage, die sie stellte: »Sind Sie verheiratet?«
In seinem Lachen schwang ein barscher Unterton mit. »Gütiger Gott, nein.«
Der Schock über seine entschiedene Antwort überwog ihre Verlegenheit. »Sie klingen gerade so, als wäre es unmöglich.«
»Glauben Sie mir, das ist es.« Er schaute durch das Fenster hinaus in die dunkle Landschaft.
Sie konnte nicht anders, als auf sein Profil zu starren, das so perfekt wie eine Kamee oder das Gesicht auf einer Münze war. Dickes, dunkles Haar fiel von einer hohen Stirn nach hinten. Die Nase gerade und gebieterisch. Das Kinn stolz und der Kiefer kantig. Seine physische Ausstrahlungskraft traf sie wie ein Schlag.
Er drehte sich um und erwischte sie dabei, wie sie ihn beobachtete. Ihre Gesichtsfarbe änderte sich. Sie wurde rot, was Gott sei Dank durch das gedämpfte Licht und ihre Blutergüsse nicht zu erkennen war.
Sie blickte lange in seine ungestümen, dunklen Augen. Er war offensichtlich aufgewühlt, doch sie war nicht eingebildet genug, um sich vorstellen zu können, sie wäre der Grund dafür. Nein, ihre Wege würden so schnell, wie sie sich gekreuzt hatten, auch wieder auseinandergehen. Sie erstickte den Schmerz sinnlosen Bedauerns, als sie sich dessen bewusst wurde. Die dichten, dunklen Wimpern seiner Augen stellten das einzige entfernt weibliche Merkmal an ihm dar. Ja, er war schön, aber genauso eindeutig männlich.
»Jetzt bin ich an der Reihe. Wo sind Ihre Eltern?«
»Tot«, sagte sie schonungslos, bevor ihr in den Sinn gekommen war zu lügen.
»Das tut mir leid.«
Sie senkte den Blick auf ihren Schoß, wo ihre unverletzte Hand sich zu einer Faust geballt hatte. »Mein Vater ist gestorben, als ich sechzehn war. Meine Mutter starb vor drei Jahren.«
»Wie alt sind Sie jetzt?« Sie war dankbar, dass er nicht weiter auf das Thema einging. Selbst nach all den Jahren war es für sie immer noch schmerzvoll, über ihre Eltern zu sprechen.
»Zwanzig. Fast einundzwanzig.« Die Worte erinnerten sie an ihren Geburtstag am ersten März, mit dem sie ihre Volljährigkeit erlangen würde. Und Sicherheit. Sollte sie in den nächsten drei Wochen unentdeckt bleiben, könnten ihre Stiefbrüder ihr nichts mehr anhaben. Oder ihrem Vermögen. »Das waren zwei Fragen.«
Die Unterhaltung war eigenartig, prickelnd. Wie ein gefährliches Spiel. »Sie dürfen jetzt auch zwei stellen.«
»Tulliver nennt Sie Sir Gideon. Sind Sie vom König zum Ritter geschlagen worden?«
»Ja.«
Sie wartete auf weitere Ausführungen oder Geschichten über seine Heldentaten, die ihm diese Ehrung hatten zuteil werden lassen, doch er blieb stumm.
»Der Titel ist also nicht alt?«
»Doch, das auch. Und zu allem Übel bin ich auch noch Baron. Obwohl ich nicht damit gerechnet habe, den Titel zu erben.«
»Penrhyn ist also der Familiensitz?«
»Ja.«
»Warum sind Sie jetzt nicht dort?«
»Ich war in London.« Er hielt kurz inne. »Jetzt bin ich aber wieder an der Reihe. Die Reise von Carlisle nach Portsmouth dauert lange, besonders für eine Frau ohne Begleitung. Was ist der Grund dafür?«
»Eine Änderung meiner Lebensumstände.« Zumindest das war die Wahrheit.
»Ihre Tante erwartet Sie also?«
»Tante … Tante Mary sehnt sich nach Gesellschaft. Sie ist … sie ist eine reiche, unverheiratete ältere Dame.« Das kam der Wahrheit über ihre Tante in Bath ziemlich nahe, außer dass diese Georgiana hieß. Ach, wie sehr wünschte sie sich, sich an diese wundervolle Frau wenden zu können und sie um Hilfe zu bitten. Doch ihre Großtante war trotz ihres beachtlichen Vermögens gegen das Gesetz und die Schikanen der Farrells machtlos.
»Miss Mary Watson aus Portsmouth.« Lag in den Worten aus seiner tiefen Stimme, die so vollmundig klang wie ein guter Wein, etwa Skepsis?
»Ja, das stimmt.«
»Sie können uns also zu ihrem Haus führen?«
O Gott, nein. An dieses Problem hätte sie besser einmal vorher gedacht. Sie hatte Portsmouth gewählt, weil sie geglaubt hatte, einfach zu jenen Menschen gehören zu können, die sich auf der Durchreise befanden, und dadurch nicht weiter aufzufallen, so wie ein Sandkorn in einem Sturm. Doch sie war noch nie in dieser Stadt gewesen, wusste nichts über sie.
»Selbstverständlich.« Sie sprach schnell, bevor er sie weiter nach ihrer Tante ausfragen konnte. »Warum waren Sie in London?«
Täuschte sie sich, oder lag tatsächlich ein gequälter Ausdruck in seinen Augen und verfinsterte seinen Blick? »Cornwall liegt sehr abgeschieden, besonders im Winter.«
Wie kam es dann nur, dass er sonnengebräunt war? Seine Antworten verwirrten sie. Gut möglich, dass er nicht log, aber auch er war nicht ganz ehrlich. »Arbeitet Akash für Sie?«
Er lachte überrascht. Es war das erste Mal, dass sie ihn richtig lachen hörte. Sein Gesicht leuchtete auf vor Vergnügen, ihr Herz bebte und blieb zitternd in ihrer Brust stehen. Er war der atemberaubendste, bestaussehende Mann, den sie je gesehen hatte.
»Natürlich nicht. Er ist ein Freund von mir.«
»Aber …« Sie sprach nicht weiter, aus Angst, beleidigend zu werden.
»Sie sollten keine vorschnellen Urteile fällen, Miss Watson.« Er griff in seine Jackentasche und zog eine kleine, flache, silberne Flasche hervor. Sie wartete ab, dass er daraus trank, doch er reichte sie ihr. »Hier, nehmen Sie einen Schluck Brandy.«
»Ich trinke keine harten Sachen.«
»Er wird Ihnen beim Einschlafen helfen und Ihre Schmerzen lindern.«
»Das hat Akashs Behandlung schon bewirkt.«
»Wenn wir erst einmal einige Stunden unterwegs sind, wird sein Zauber nachlassen.« Während Sir Gideon ihr gut zuredete, wurde seine Stimme tief und samtig. »Trink, Sarah. Ich verspreche, es wird dir nicht schaden.«
Unwillkürlich streckte sie die Hand aus, nahm die Flasche entgegen und trank. Was alles im Bann seiner unergründlichen dunklen Augen geschah. Als der Alkohol ihr die Kehle hinunterrann, musste sie husten. Durch den abrupten Druck machten sich ihre geprellten Rippen wieder schmerzhaft bemerkbar, selbst als wohltuende Wärme durch ihre Adern zog.
Sie gab die Flasche zurück. Ihre kurz aufgeflammte Energie ließ nach. Erschöpfung übermannte sie und machte ihre schmerzenden Glieder schwer. Ihr angeschwollener Kiefer tat ihr weh, als sie ein Gähnen unterdrückte.
Nein, sie würde nicht einschlafen. Sie vertraute ihren Begleitern nicht genug, um sich derart fallen zu lassen. Außerdem musste sie wach bleiben, um ihre Chance zur Flucht zu ergreifen.
Nein, sie würde nicht einschlafen. Sie würde nicht …
Am nächsten Morgen rollte die Kutsche in Portsmouth ein. Gideon hatte immer mal wieder vor sich hingedöst. Mehr als das war ihm an Schlaf nicht vergönnt, egal ob er in einer schnell fahrenden Kutsche saß oder im schönsten Federbett schlief. An manchen Tagen dachte er daran, für einen ungestörten Schlaf seine Seele verkaufen zu können, nur um am nächsten Tag festzustellen, dass er keine Seele mehr zum Verkaufen hatte.
Wenigstens war seine Angst vor geschlossenen Räumen nicht mehr ganz so erdrückend wie damals, als er gerade Indien verlassen hatte. In der Kutsche eingesperrt zu sein war zwar unangenehm, doch kam er Gott sei Dank damit zurecht.
Akash beobachtete ihn von der Bank gegenüber. Es hatte vor der Morgendämmerung angefangen zu schneien, und sein Freund hatte Zuflucht in der Kutsche gesucht. Sie hatten Tulliver vorgeschlagen, an einem Gasthaus auf dem Weg zu halten, doch Tulliver hatte sich der englischen Kälte gegenüber genauso unempfindlich gezeigt wie der glühenden Hitze auf dem Schiff auf der Rückreise von Indien.
Gideons Blick fiel auf das schlummernde Bündel neben Akash. Sarah hatte sich in der Ecke eingerollt und presste sich in das Polster, so als bliebe sie selbst im Schlaf wachsam.
Bei dem Gedanken, wer sie so zugerichtet haben könnte, drehte sich Gideons Magen um. Der Feigling verdiente es, in der Hölle zu schmoren.
Er schob den Vorhang zurück und erhaschte zum ersten Mal einen Blick auf Miss Sarah Watson bei Tageslicht. Die Blutergüsse in ihrem Gesicht sahen trotz Akashs geheimnisvoller Fertigkeiten an diesem Morgen schlimmer aus. Ihre Frisur glich einem Krähennest. Mit einer ihrer zerkratzten Hände umklammerte sie seinen dicken Wintermantel, unter dem sich die Rundungen ihres schlanken Körpers verbargen, an die er sich, auch wenn er nicht wollte, nur zu gut von letzter Nacht erinnerte. Die andere Hand, die aus der von Akash notdürftig hergestellten Schlinge heraushing, baumelte locker gegen ihre Brust.
»Soll ich sie wecken?«, murmelte Akash.
Gideon nickte. Akash berührte ihre Hand dort, wo sie den dicken schwarzen Wollstoff des Mantels umfasste. Gideon beneidete seinen Freund darum, sie so beiläufig berühren zu können.
Er blieb ruhig sitzen und beobachtete, wie sich das Mädchen rührte. Ihre Augen – ein rauchiges Haselnussbraun, in dem sich der helle Schein des Schnees von draußen spiegelte – öffneten sich und nahmen ihn langsam wahr. Anklagend.
»Sie haben mir ein Schlafmittel gegeben.« Sie sprach undeutlich. Wegen ihrer Schlaftrunkenheit oder ihres geschwollenen Gesichtes. Oder wegen des Opiums.
»Sie brauchten Ruhe. Es war lediglich ein Tropfen Laudanum.« Es war mehr als das gewesen. Aber wie hätte er ihr sonst zu ihrem so nötigen Schlaf verhelfen können?
»Tun Sie das ja nicht noch mal«, stieß sie aus und hörte sich mit einem Mal wach an. Ihre bemerkenswerten Augen hellten sich zu einem Tiefgrün mit vereinzelten goldenen Sprenkeln auf, die wie gebrochenes Sonnenlicht funkelten. Nur diese Augen ließen auf ihre eigentliche Schönheit schließen.
Er nickte. »Das werde ich nicht.« Er hielt inne. »Wie geht es Ihnen?«
Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, dann zuckte sie zusammen, da ihre aufgesprungene Lippe ihr dabei wehtat. Dennoch schwang trockener Humor in ihrer Stimme mit. »Als wäre ich von einem Esel getreten worden. Einem riesigen, wütenden Esel.«
Sie stellte sich ihrem Schicksal hoch erhobenen Hauptes. Ohne zu jammern oder ihm auszuweichen. Ihre Einstellung verschlug ihm die Sprache. Und ließ ihn mehr über sie wissen wollen, als ihm zu fragen erlaubt war.
Wie sie bereits gesagt hatte: Sie waren Fremde, deren Wege sich rein zufällig gekreuzt hatten. Und so war es vollkommen sinnlos, sich gegen das unausweichliche Schicksal zu stellen. Sie war nicht für ihn bestimmt. Und könnte es auch nie. Keine Frau könnte das.
Dieser niederschmetternden Einsicht hatte er sich bereits vor Monaten gestellt.
Er hoffte, sie würde nicht den verräterischen rauen Ton in seiner Stimme bemerken, als er sich zu einer trockenen Antwort zwang. »Dann fühlen Sie sich also um einiges besser?«
Sie kicherte bei seinem Versuch zu scherzen in sich hinein und hielt eine Hand an ihre geprellte Wange. »Mir tut das Lachen weh.«
»Das tut es bestimmt.« Nur eine äußerst tapfere Frau würde unter diesen Umständen lachen.
»Wo lebt Ihre Tante, Miss Watson?«, fragte Akash.
Sein Freund hatte ihm einen prüfenden Blick zugeworfen und konzentrierte sich nun auf das Mädchen. Hitze kroch Gideon den Nacken hoch, als er realisierte, dass Akash seine Bewunderung für Miss Watson erahnte. Und ihn deshalb bedauerte, was wiederum Gideons Stolz verletzte.
Der singende Tonfall in der Stimme des Mädchens erstarb, und sie hörte sich so hölzern wie immer an, als sie ihn anlog. »Nicht weit weg. Wenn Sie mich in der Stadtmitte absetzen, werde ich meinen Weg schon finden. Ich bin Ihnen bereits genug zur Last gefallen.«
Gideons Lippen verzogen sich vor grimmigem Vergnügen zu einem schiefen Grinsen, während sie vermied, ihm in die Augen zu schauen. »Wir können eine Dame unmöglich sich selbst überlassen.«
Sie schaute hinunter auf die geballte Hand in ihrem Schoß. Ihr Unbehagen war spürbar. »Meine … meine Tante ist eine unverheiratete Dame, die sehr zurückgezogen lebt. Ich würde sie in Angst und Schrecken versetzen, wenn ich in Gesellschaft zweier unbekannter Herren vor ihrer Haustür stünde.«
»Und wenn sie bei ihr verletzt, zerlumpt und alleine ankämen, das würde ihr nichts ausmachen?«
Sie warf ihm einen verärgerten Blick durch ihre dichten Wimpern mit den goldfarbenen Spitzen zu. »Wenn ich es ihr erkläre, wird sie es verstehen.«
Die Kutsche fuhr vor dem besten Gasthaus von Portsmouth vor, das am Abend zuvor von ihrem Besuch unterrichtet worden war. Die Hände des Mädchens verkrampften sich, bis die Knöchel weiß wurden. »Wo sind wir?«
»Wir wechseln die Pferde und legen einen Halt ein, um zu frühstücken. Danach werden Akash und ich Sie zu Ihrer Tante begleiten.«
»Nein.«
»Heißt das nein zum Frühstück oder nein zu unserer Gesellschaft?«
Sie besaß so viel Anstand, nach dieser unverblümten Antwort zumindest ein bisschen beschämt auszusehen. »Ich muss zugeben, dass mir ein Frühstück schon zusagen würde.«
Er vermutete, sie wollte damit andeuten, sich nicht eine letzte Mahlzeit entgehen zu lassen, bevor sie Reißaus nehmen würde. Auf jeden Fall wäre es genau das, was er tun würde, wenn er mittellos und in Gefahr wäre. »Nun gut, dann Frühstück«, sagte er mit neutralem Ton in seiner Stimme.
Die Kutsche hielt an. Akash drehte sich zu ihr um. »Ich werde Sie hineintragen.«
Der Blick des Mädchens schoss hinüber zu Gideon. Er konnte sich des eigenartigen Gefühls nicht erwehren, sie wollte, dass er sich dafür anböte. Dabei war er doch ein solch armseliges Exemplar von Mann. Nicht einmal das konnte er.
Er ballte die Hände zu Fäusten und redete sich ein, sich mit dieser trostlosen Wahrheit schon seit langem abgefunden zu haben. Doch da er heute dieses wunderbare Mädchen in die Arme eines anderen geben musste, erkannte er es als hohle Lüge.
»Danke, aber ich kann gehen.«
»Ihre Verletzungen werden nicht so viel Aufmerksamkeit erregen, wenn ich Sie trage«, sagte Akash und beobachtete dabei genau die wortlose Kommunikation zwischen Gideon und Sarah.
»Miss Watson, es wird so das Beste sein«, sagte Gideon.
Ein Schatten der Enttäuschung zog über ihr Gesicht. Eigenartig, wie ausdrucksstark es trotz ihrer Verletzungen war. Sie hob das Kinn, als wappnete sie sich gegen eine Herausforderung.
»Wie Sie wünschen«, sagte sie ruhig.
Akash trug Charis mit einer distanzierten Unbekümmertheit die Treppe hoch, die ihr jegliche peinliche Berührtheit ersparte. Sie konnte sich nicht vorstellen, so gelassen in Sir Gideons Armen liegen zu können. Der Gedanke, Gideon hielte sie an seiner breiten Brust, ließ ihre Wangen erröten, und sie neigte den Kopf nach vorne, um es zu verbergen.
Warum fühlte sie sich so eigenartig von Sir Gideon angezogen? Seine physische Präsenz hatte auf eine Weise von ihren Gedanken Besitz ergriffen, die sie so vorher noch nie erlebt hatte.
Es war erstaunlich, wie sehr er ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Aufmerksamkeit, die sie ausschließlich ihrer Flucht und ihrer Sicherheit in den nächsten drei Wochen widmen sollte. Seit sie ihn das erste Mal gesehen hatte, war er zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Gedanken und Gefühle geworden. Mit jedem Moment wuchs ihre Besessenheit. Lag es nur daran, dass er sie vor ihrer Entdeckung und weiterem Unheil gerettet hatte? Oder war dieses aufwühlende Gefühl etwas vollkommen anderes?
Gott sei Dank hatte sich ihr unbesonnenes Herz wieder gefangen, als Akash sie in dem großen separaten Raum, um den Sir Gideon bei ihrer Ankunft gebeten hatte, zurück auf die Füße stellte. Ihr Puls fing jedoch sofort wieder an zu rasen, als das Objekt ihrer lächerlichen Phantasie hinter ihnen den Raum betrat. Sie kämpfte darum, ihre verwunderliche, unerwünschte Reaktion zu unterdrücken, doch nichts hielt das Prickeln auf, das sie bei seinem Anblick verspürte, als er hinüber zum Feuer schritt.
Gleich nachdem sie Tulliver losgeschickt hatten, ein reichhaltiges Frühstück zu bestellen, wandte sich Akash mit seiner für ihn typischen Ernsthaftigkeit Charis zu. »Dürfte ich mir Ihre Verletzungen noch einmal ansehen, Miss Watson? Ich konnte in der Dunkelheit nicht viel tun.«
»Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Außer dem bitteren Geschmack in ihrem Mund von dem von ihr so verabscheuten Laudanum fühlte sich Charis in Wahrheit um einiges besser. Ihre erstarrten Muskeln tauten durch die Wärme im Raum auf.
Sir Gideon hatte es sich auf einer geschnitzten Holzbank in der Nähe des Feuers gemütlich gemacht, das hinter dem Kaminrost loderte. Seine Augen waren gebannt auf sie gerichtet, als sie sich vom Stuhl erhob. Mit zittrigen Beinen ging sie in die Mitte des Raumes, wo Akash wartete.
Sie nahm das dicke Tuch von ihrem Kopf, zog den Mantel von ihren Schultern und ließ beides zu Boden gleiten. Es war absurd, aber sie hatte das Gefühl, sich für Sir Gideon zu entkleiden. Dieser schamlose Gedanke kam aus dem Nichts. Sie war darüber schockiert, konnte aber nicht davon ablassen.
In Sir Gideons unbeirrtem, starrem Blick schien Verlangen zu liegen. Was keinen Sinn ergab, wusste sie doch, dass sie wie ein wahrhaftiges Monster aussehen musste. Aber ihre Haut prickelte vor Hitze, und sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die trockenen Lippen.
Seine Augen flackerten auf, als er das sah.
Das Herz schlug ihr gegen die Rippen. Etwas an Gideons Blick traf sie bis ins Mark. Es war, als blickte er in ihre Seele.
Sie bewegte sich unruhig unter Akashs Händen.
»Habe ich Ihnen wehgetan?«, fragte er mit gerunzelter Stirn.
»Nein«, murmelte sie.
Es mussten Akashs medizinische Fähigkeiten sein, weshalb er ihre Pflege übernommen hatte. Was immer er auch letzte Nacht auf ihre Blutergüsse aufgetragen hatte, es hatte gewirkt. Ihr tat zwar immer noch alles weh, aber das war nichts im Vergleich zu gestern.
Eigenartig. Dieser gut aussehende, rücksichtsvolle Gentleman berührte sie zwar mit seinen Händen, doch machte ihr das rein gar nichts aus. Sir Gideon befand sich in der Mitte des Raumes und raubte ihr den Atem.
Was war nur passiert? In ihrem Kopf drehte sich alles, als sie versuchte, ihren noch nie da gewesenen Empfindungen auf den Grund zu gehen. Sie war schon so vielen Männern, attraktiven Männern, kultivierten Männern, aufmerksamen Männern in Ballsälen und Salons begegnet. Keiner von ihnen hatte etwas Ähnliches in ihr ausgelöst wie dieser wortkarge, schwarzhaarige Adonis mit seinen glänzenden Augen und seiner bekümmerten Miene. Ihre Gefühle ließen sie zu Tode erschrecken.
Während sie Akashs Fragen zu ihren Verletzungen beantwortete, fiel ihr Blick auf Sir Gideons behandschuhte Hände, die einen unberührten Bierkrug umfassten. Sie zitterte vor Erregung bei dem sündigen Gedanken, diese Hände würden sie berühren. Bis jetzt hatte er nicht einmal ihren Arm angefasst.
Begierig nahm sie jedes Detail seiner Gesichtszüge auf. Sein Gesicht war ernst und rein wie das steinerne Abbild eines Kreuzritters. Seine Wangenknochen und seine Kieferpartie waren im perfekten Winkel geschnitten. Sein Mund war streng, entschlossen und schön, und zeugte mit seiner vollen Unterlippe doch von Sanftheit. Er wirkte wie ein in Stein gemeißelter Heiliger, bis der Blick auf seine brennenden Augen fiel.
Von Heiligkeit war dort nichts mehr zu sehen.
Sie waren dunkel, fast schwarz. Intensiv. Funkelnd. Voller unterdrückter Leidenschaft und Schmerz.
Und Zorn.
Weil jemand gewagt hatte, ihr weh zu tun.
Wärme drängte sich in ein Herz, in dem seit langem Kälte herrschte. Sie konnte sich diesen Männern nicht anvertrauen. Zu viel hing davon ab, ihre Identität geheim zu halten. Ihr einziger Ausweg war immer noch die Flucht.
Aber das Wissen, einen derart bemerkenswerten Menschen wie Sir Gideon auf ihrer Seite zu haben, ließ sie neuen Mut fassen, der sie beschämenderweise fast verlassen hätte.
Die Blicke von Charis und Gideon trafen sich, wobei in seinem eine unmissverständliche Warnung lag. Er erhob sich und ging hinüber, um aus dem Fenster zu sehen.
Hilflos betrachtete Charis seinen geraden Rücken in der perfekt sitzenden schwarzen Jacke. Er musste nichts sagen. Der letzte Blick aus seinen glänzenden Augen hatte ihr ein lautes Zutritt verboten zugerufen.
Akash drehte ihr Handgelenk in verschiedene Richtungen, was bei Weitem nicht mehr so schmerzhaft war wie am Abend zuvor. Selbst ihre Rippen fühlten sich nicht mehr an, als wäre eine Herde von Elefanten trampelnd darübergelaufen. Plötzlich erinnerte sie sich an die dunkle Pferdebox, in der Gideon sie gefunden hatte. Hätte er ihr nicht bei der Flucht geholfen und Akash ihre Wunden versorgt, wäre sie in der Tat übel dran.
Ihre Instinkte, die darauf beharrten, dass Sir Gideon ihr furchtloser Ritter war, drängten sie, ihm alles zu gestehen und sich seiner Gnade zu unterwerfen.
Nein, er war ein Fremder. Sie konnte die Folgen unüberlegter Vertrauensseligkeit nicht riskieren. Wenn Sir Gideon sie den Gesetzeshütern übergäbe, wie es das Recht verlangte, wäre sie wieder in der Gewalt ihrer Stiefbrüder, sobald diese nach Portsmouth ritten.
Oder noch schlimmer, vielleicht würde ihr Gold Gideon und Akash genauso blenden wie jeden anderen Verehrer vor ihnen. Ihr Herz schrie ihr zu, dass diese Männer gut waren. Die Erfahrung mahnte sie zur Vorsicht. Selbst noch so gute Männer gaben ihre Prinzipien auf, wenn sie von ihrem riesigen Vermögen erfuhren.
So war es für sie um einiges sicherer, sich auf ihre eigenen Ressourcen zu verlassen, egal wie dürftig die auch waren. Einen Anflug von schlechtem Gewissen konnte sie dennoch nicht unterdrücken, da sie die Menschen, die versuchten ihr zu helfen, benutzte und hinterging. Die Erfahrungen mit ihren Brüdern hatten es ihr unmöglich gemacht, sich freiwillig in die Obhut irgendeines Mannes zu begeben. Ihr Herz aber bestand darauf, dass sie einen großen Fehler machte, wenn sie die Hilfe von Sir Gideon ablehnte.
»Danke für alles, was Sie beide für mich getan haben«, sagte sie leise und wusste, dass dies, gemessen an ihren Lügen, schändlich unangemessen war.
»Keine Ursache.« Akash verband ihren Arm und ließ die Schlinge weg.
Sie beugte sich hinunter, um ihren Schal aufzuheben, und taumelte dabei gegen ihren Stuhl. So lange zu stehen stellte ihre Kraft auf die Probe. Gideon auf der anderen Seite des Raumes sagte kein Wort und schaute nur aus dem Fenster hinaus in das Schneetreiben. Sie sagte sich, kein Recht zu haben, sich durch seine Gleichgültigkeit gekränkt zu fühlen.
Das Frühstück wurde serviert und unterbrach ihre verdrießlichen Gedanken. Charis hielt den Kopf gesenkt und verbarg ihr Gesicht in dem Tuch. Sie musste mit ihrer nicht zusammenpassenden Kleidung leben, aber wenn die Dienerschaft ihr Haar und ihr zerschundenes Gesicht sähen, könnten sie sie, sollten ihre Stiefbrüder nach ihr fragen, sofort identifizieren.
Fieberhaft versuchte sie, ihre Flucht zu planen, auch wenn Sir Gideons Nähe ihre Gefühle beharrlich in Aufruhr brachte. Das schlechte Wetter war sowohl Fluch als auch Segen. Sollte ihr die Flucht gelingen, könnte sie sich dadurch einfacher verstecken. Doch war sie für diese Kälte nicht entsprechend gekleidet. Sie fand sich damit ab, den Mantel stehlen zu müssen. Es würde eher eine Leihgabe als ein Diebstahl sein, versicherte sie ihrem widerstrebenden Gewissen. In wenigen Wochen würde sie ihn zurückgeben und Sir Gideon seine Freundlichkeit vergelten.
Einen Sir Gideon Trevithick von Penrhyn in Cornwall ausfindig zu machen würde sicherlich nicht so schwierig werden. Wenn sie erst einmal wieder Kontakt hätten …
Sie bremste ihre törichten Träume.
Zuerst einmal musste sie die kommenden drei Wochen überleben und vermeiden, wieder in die Fänge ihrer Stiefbrüder zu geraten. Sie musste einen Unterschlupf finden, Essen auftreiben und sich irgendwie über Wasser halten, alles ohne ihre Identität preiszugeben. Oder die Identität der mächtigen Männer, die sie suchten. Hubert war Lord Burkett und Felix ein aufstrebender Politiker des Parlaments.
Gideon, Akash und sie ließen sich zu einem weiteren schweigsamen Mahl nieder. Tulliver musste sich in die Schankstube zurückgezogen haben. Charis war dankbar, dass sie nicht miteinander sprachen. Sie wäre an jeder weiteren Lüge erstickt. Außerdem überfiel sie bei dem Gedanken, Sir Gideon verlassen zu müssen, das törichte Verlangen zu weinen. Wie hatte er nur in so kurzer Zeit so viel Macht über ihre Gefühle gewinnen können? Ihr war, als hätte ein eigenartiger Wahnsinn sie befallen.
Nachdem die Dienerschaft die Teller abgeräumt hatte, gelang es ihr, ihrer Stimme eine angemessene Note weiblicher Verlegenheit zu verleihen. »Wäre es möglich, wenn ich kurz ungestört sein könnte?«
Gideon und Akash tauschten einen vielsagenden Blick miteinander, standen jedoch sogleich auf. »Wir schicken Ihnen jemanden zur Hilfe«, sagte Gideon.
»Das ist nicht nötig«, erwiderte Charis eilig, die ihre Chance zur Flucht vor ihren Augen dahinschwinden sah.
»Ich bestehe darauf.« Gideon, verflucht sei er, wartete mit ihr im Raum, während Akash hinausging, um nach den Bediensteten zu rufen.
Eine ganze Reihe Dienstmädchen brachte heißes Wasser und Handtücher sowie verschiedene Toilettenartikel. Sie musste vor Freude seufzen, als der letzte Gegenstand, ein einfaches, braunes Kleid aus Baumwolle, vor ihr ausgebreitet wurde. Sie sehnte sich danach, ihre zerlumpte, schmutzige Kleidung zu wechseln.
Weiß der Himmel, wo Sir Gideon so schnell ein Kleid hatte auftreiben können. Was einmal mehr zeigte, wie umsichtig und aufmerksam er doch war. Wieder verdrängte sie dieses aufrührerische Verlangen, alles zu beichten und ihn um Hilfe zu bitten. Männer änderten sich, wenn sich ihnen die Möglichkeit bot, ihre Taschen mit Gold zu füllen.
Gideon stand in der Tür und entließ die Dienerschaft. »Tulliver ist draußen, falls Sie etwas benötigen.«
»Danke.« Wie sehr wünschte sie sich doch, sie könnte mehr sagen, sich von ihm verabschieden, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, ihm erzählen, wie sehr sie sich wünschte, ihn besser kennenlernen zu können.
Doch das war unmöglich.
Sie schaute ihn lange an und nahm seine körperliche Ausstrahlungskraft, die Stärke und Intelligenz, die in seinen unwiderstehlichen Gesichtszügen lag, in sich auf. Sie wusste schon jetzt, dass sie ihn niemals vergessen würde. Sie drehte sich weg und tat so, als interessierte sie sich für die Gegenstände auf dem Tablett. Wenn sie Gideon noch länger anschaute, müsste sie anfangen zu weinen.
Die Tür wurde leise geschlossen. Endlich war Charis alleine. Sie stieß den angehaltenen Atem aus. Dennoch setzte sie ihren Plan nicht sofort um. Stattdessen näherte sie sich langsam dem Spiegel, der in der Ecke stand.
Angesichts der zahlreichen Schwierigkeiten, in denen sie sich befand, war es geradezu lächerlich, dass sie all ihren Mut zusammennehmen musste, um ihr Spiegelbild zu prüfen.
Sie wappnete sich innerlich, um der Frau im Spiegel entgegentreten zu können. Und als sie es schließlich tat, blieb ihr nichts anderes übrig, als in schallendes Gelächter auszubrechen.
Hatte aus Sir Gideons Augen Verlangen gesprochen? Was für eine eitle, verblendete Närrin sie doch war. Kein Mann konnte bei ihrem Anblick etwas anderes als Mitleid empfinden. Oder Ekel.
Sie hatte sich auf einen schockierenden Anblick gefasst gemacht. Doch was sie sah, war schlimmer als ihre schlimmsten Befürchtungen. Ihr Gesicht bestand aus einer Ansammlung von blauroten und gelben Flecken. Ihr Kiefer war so verzerrt, dass sie geradezu grotesk aussah. Zwischen den ganzen Schrammen starrten ihr vertraute haselnussbraune Augen mit einem benommenen Ausdruck aus dem Spiegel entgegen.
Sie biss ganz hart auf ihre zuckenden Lippen, doch der stechende Schmerz konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie war ein Monster, ein Schreckgespenst, ein Drache. Wie dumm, etwas zu beweinen, was wieder heilen würde, aber dennoch musste sie ihre unverletzte Hand heben, um die Tränen aus ihren Augen zu wischen. Akash hatte ihr versichert, dass sie keine bleibenden Schäden davontragen würde, doch die Worte schienen wie blanker Hohn, als sie die Frau im Spiegel betrachtete.
Das einstmals elegante blaue Kleid stand vor Dreck und war so zerrissen, dass es sinnlos war, es nähen lassen zu wollen. Ihre zittrige Hand wanderte nach oben, um das verfilzte, zerzauste Haar, das um ihre Schultern hing, zu berühren.
Sie holte Luft, was sich fast wie ein Schluchzen anhörte, und sah den Blick ihrer wässrigen Augen im Spiegel. So konnte es nicht weitergehen. Sie richtete sich auf. Sie war Lady Charis Weston, letztes Mitglied einer Familie mit einer langen Ahnenreihe von Kriegern. Eine Tochter von Hugh Davenport würde sich nicht von zwei Feiglingen wie Hubert und Felix geschlagen geben.
Das Grauen, das sie im Spiegel sah, würde vergehen. Jetzt musste sie sich auf ihre Flucht konzentrieren.
Eilig wusch sie sich und zog ihre zerrissene Kleidung aus. Das billige Kleid war zwar zu groß und kratzte auf ihrer empfindlichen Haut, doch es war zumindest sauber und nicht kaputt. Es zuzumachen dauerte eine halbe Ewigkeit, und sie keuchte vor Schmerz, als sie fertig war.
Sie verbrachte kostbare Minuten damit, ihr Haar zu entwirren, bis es ihr schließlich gelang, es aus ihrem Gesicht zu stecken. Das Mädchen im Spiegel begann, einigermaßen ordentlich auszusehen. Solange niemand ihr zerschundenes Gesicht sah.
Mit zittrigen Händen zog sie den Mantel an. Ein stechender Schmerz fuhr durch ihren verletzten Arm, als er behutsam in den Ärmel glitt, aber dank Akashs Pflege war er zu ertragen. Der riesige Mantel sah lächerlich an ihrem zarten Körper aus, doch hielt er sie warm, weshalb sie nicht auf ihn verzichten mochte.
Sie fühlte in der Manteltasche nach der Pistole. Sobald sie eine sichere Bleibe gefunden hätte, würde sie sie verpfänden. Sie redete sich ein, dass es kein Diebstahl war, sie mitzunehmen. Sowie es ihr möglich wäre, würde sie die Waffe einlösen und wieder zurückgeben. Sie hatte sich schon gewappnet, den Ring und das Medaillon ihrer Mutter zu verpfänden, obwohl ihr bei diesem Gedanken das Herz blutete.
Wie lange war sie schon hier drinnen? Würden Gideon und Akash bald zurückkehren und wissen wollen, was sie im Schilde führte? Sie durfte nicht trödeln. Das Anziehen hatte schon viel zu lange gedauert.
Ihr Mund war durch die Anspannung ganz trocken, als sie einen Blick durch das Fenster warf. Sie wusste, dass unter dem Fenstersims ein kleines Dach über den Hinterhof ragte. Mit einem verstauchten Handgelenk im Schnee herumzuklettern war riskant, aber nicht so riskant, wie darauf zu warten, dass ihre Stiefbrüder sie fänden oder ihre Retter ihre Identität entdeckten, um sie dem Richter vor Ort zu übergeben.
Vorsichtig schob sie das Fenster nach oben und kletterte hinaus. Ihre geprellten Rippen machten sich bemerkbar, aber sie biss die Zähne zusammen und arbeitete sich weiter vor zum Dach. Der Gedanke, ihre Stiefbrüder könnten sie schnappen, ließ alle Schmerzen vergessen.
Drei Wochen noch bis zur Freiheit, versprach sie sich grimmig.
Sie schob die verlockende Erinnerung an schwarze Augen, die sie glühend anschauten, beiseite und fand Halt auf dem rutschigen Dach.