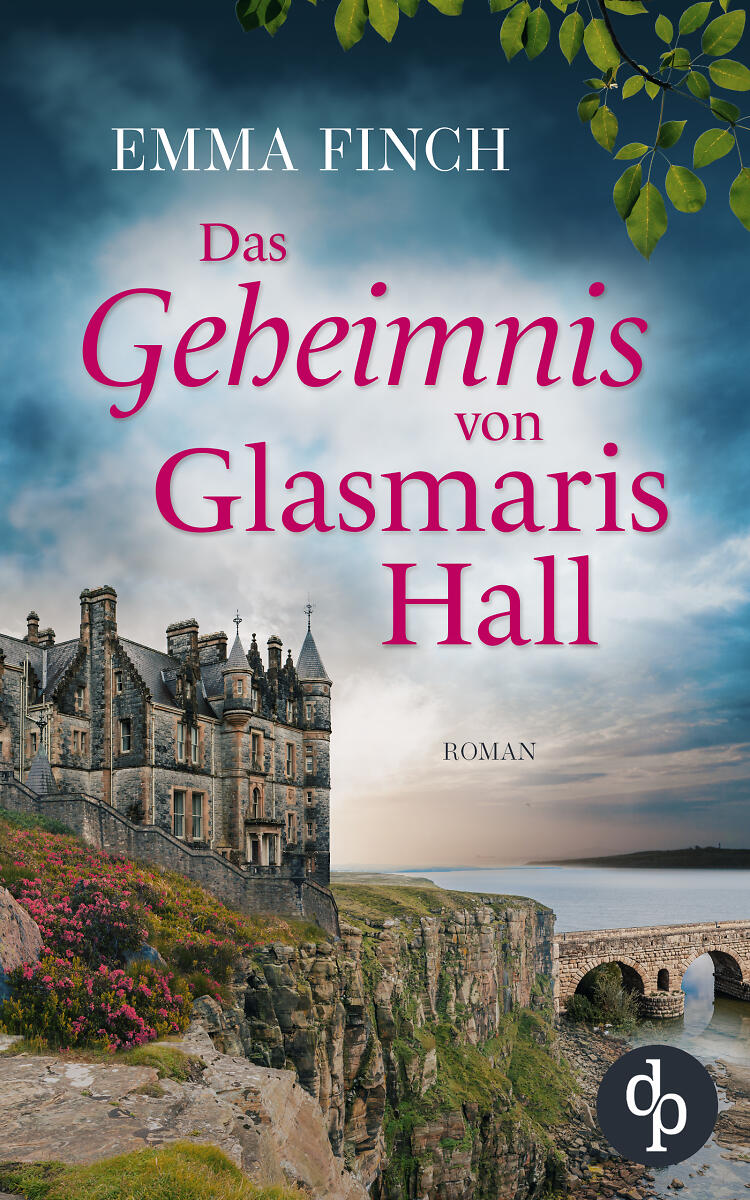ZEHN
Anfangs hielt ich es für Zufall.
Ich hieß Caitlyn Brown, und mein Leben war genauso gewöhnlich wie mein Nachname.
Schon, seit ich denken konnte, wohnte ich in einer kleinen Stadt in Surrey südlich von London. Mein Vater führte dort jahrzehntelang eine Arztpraxis, in die vor ein paar Jahren mein älterer Bruder eingestiegen war. Meine Mutter war Angestellte im Außenministerium gewesen und es hatte uns völlig unvorbereitet getroffen, als sie unmittelbar vor meinen A-Level-Prüfungen an einer akuten Leukämie erkrankt und innerhalb weniger Wochen gestorben war. Wir fielen damals in eine Art ohnmächtige Schockstarre. Ich brauchte dringend einen Tapetenwechsel und verkroch mich einige Monate bei Freunden von Dad in Schottland. Nach meiner Rückkehr war ich wild entschlossen, Krankheiten wie Krebs den Krieg zu erklären. Ich spielte sogar mit dem hehren Gedanken, eines Tages in die Forschung zu gehen, und weil ich quasi in einer Arztpraxis aufgewachsen war, glaubte ich, ich könnte beurteilen, was diese Arbeit bedeutete.
Ich konnte es natürlich nicht.
Nach den ersten Stunden in der Anatomie war mir klar, dass ich mir schleunigst etwas anderes überlegen musste – obwohl der Geruch der Chemikalien im Sektionssaal der Anatomie dank des ausgeklügelten Lüftungssystems auszuhalten und der Anblick der präparierten Leichen kaum schlimmer war als der von gekochtem Hühnerfleisch. Doch irgendwann würde ich keine toten Körper mehr vor mir haben und alles, was ich für die Kranken tat und auch all meine Fehler konnten tragische Folgen für ihr Leben und ihre Gesundheit haben.
Diese Verantwortung war mir eine Nummer zu groß.
Kurzerhand hängte ich das Studium an den Nagel und ging, um Zeit zum Nachdenken zu schinden, als Au-pair auf eine Farm im Nordosten Kanadas. Anschließend kehrte ich zu meinem ursprünglichen Plan zurück, Mathematik zu studieren – allein schon, um meinem Vater einen Gefallen zu tun, der meine Kapriolen klaglos hingenommen hatte. Im Nebenfach belegte ich Sport und Englisch und da ich gern mit Kindern arbeitete, machte ich anschließend eine praktische Lehrerausbildung, unterrichtete fortan an der Highschool meiner Heimatstadt und korrigierte die zwar manchmal tragischen, aber längst nicht so folgenreichen Fehler meiner Schüler.
Ich war, wie man so schön sagt, erwachsen geworden und mein Leben in jeder Hinsicht berechenbar. Nichts deutete darauf hin, dass die bunte Fassade meines Alltags längst Risse bekommen hatte – bis zu jenem Sommernachmittag, an dem ich Zeugin eines Mordes wurde, dessen Motiv ich in der Vergangenheit meiner Familie finden sollte und dessen Folgen nicht nur meine Zukunft auf den Kopf stellten. Der Countdown zu einem Spiel auf Leben und Tod hatte ohne mein Wissen begonnen.
„The Fens“, East Anglia
Er drehte das Streichholz zwischen seinen Fingern. So klein, so unscheinbar. Nicht mehr als ein Holzsplitter, an dessen einem Ende Gefahr lauerte. Harmlos, solange es niemand benutzte.
Mit einer knappen Bewegung riss er das Schwefelende über die raue Fläche. Wartete, während sich die Flamme unaufhaltsam seinen Fingerspitzen näherte.
Er schloss die Lider.
Feuer.
Solange es Nahrung hatte, brannte es, loderte, verzehrte. Zerstörte, was sich ihm in den Weg stellte.
Tötete.
Der Kuss des Feuers war schmerzhaft.
Abrupt riss er die Augen auf und legte das Streichholz in den Kamin, in dem sich Holz und zusammengeknüllte Zeitungen befanden. Zuerst schien es, als würde das Feuer erlöschen, doch dann stieg Rauch auf, eine Flamme leckte an dem Papier, zuerst winzig, schließlich immer größer, bis es hell lodernd zu verkohlen begann. Schatten tanzten an den weiß getünchten Wänden, während das Feuer neue Nahrung fand und schließlich auf das trockene Holz übergriff.
Neben ihm auf dem Boden lag ein Notizzettel, auf dem in akkurater Handschrift ein Name, eine Adresse und eine Nummer notiert waren. Er ließ seine Finger sanft über den Zettel gleiten und schob ihn beiseite. Darunter kamen zwei Fotos zum Vorschein: Ein altes, das in verblichenen Farben ein kleines Mädchen auf einer Bank unter einem Baum zeigte, und ein neues, bunt und lebendig, mit einer jungen Frau. Er sah es lange an – und warf dann alles ins Feuer.
Die Schrift löste sich als Erstes in loderndes Nichts auf, der blonde Haarschopf erglühte im Feuerschein, bevor sich ein schwarz verkohlter Schatten darüberlegte. Die dargestellte Person verschwand erst auf dem einen, dann auf dem anderen Bild, als hätte es sie niemals gegeben. Zurück blieb am Ende nur Asche.
Eine unumkehrbare Metamorphose.
So, wie der Tod.
Ohne hinzusehen, griff er nach einem Tuch, das neben den Fotos gelegen hatte. Es war schon alt, der blutrote Stoff fadenscheinig und seine Mitte zierte ein Symbol in absoluter Symmetrie, wie ein perfekt geschliffener Kristall. Er hielt es unter seine Nase und atmete mit geschlossenen Augen den nur für ihn wahrnehmbaren Rosmarinduft ein.
Es war alles, was von ihnen geblieben war. Das Tuch und die Asche, die er im Meer verstreut hatte.
Langsam zog er sein Jackett aus, krempelte den Ärmel auf und brachte seinen rechten Unterarm in die Nähe der Flammen, dichter und dichter, bis das Feuer an seiner Haut leckte. Schweißperlen erschienen auf seiner Stirn. Sein Atem ging schneller.
Asche zu Asche.
Jetzt war er das Feuer.
Mit einem erstickten Laut zog er den Arm zurück und nahm das Tuch, um damit seine glühend rote Haut abzudecken.