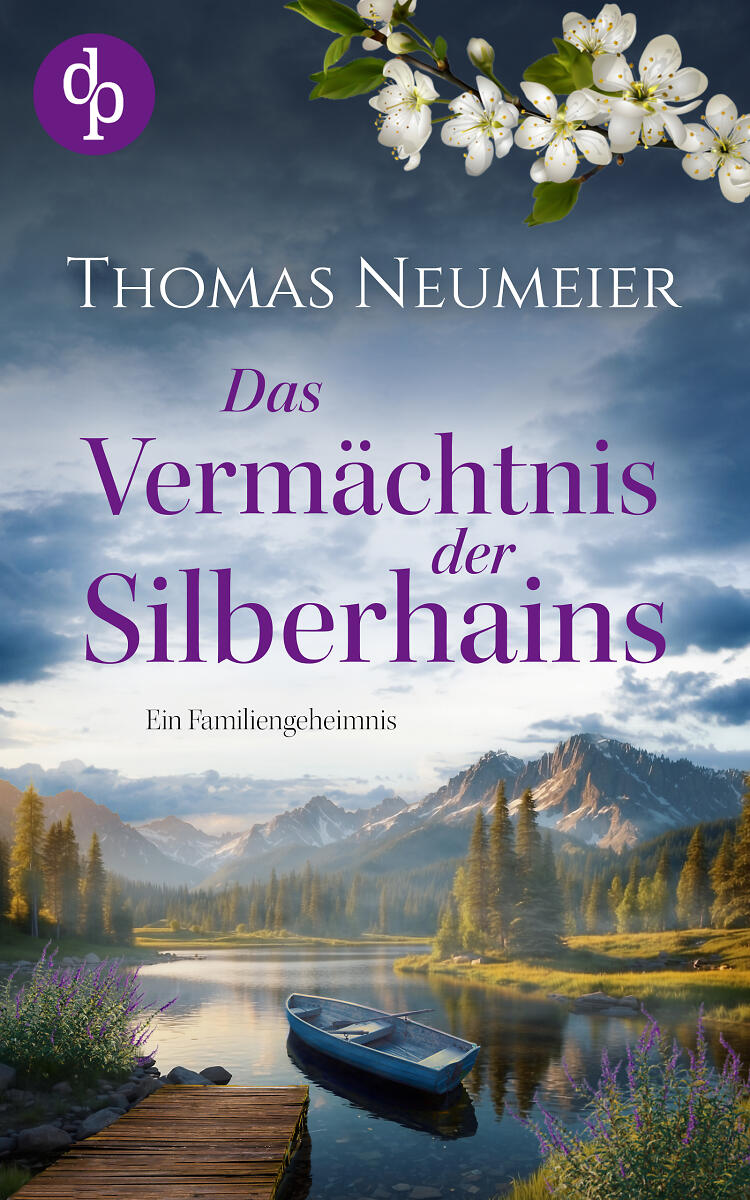Kapitel 1: Drei wenig durchlauchte Silberjäger
Dina riet ihm davon ab, aber Nicolai ignorierte ihren Einwand. Er stoppte den Wagen und stieg aus, um einen grimmig dreinblickenden Dorfbewohner, der vor seiner Steinhütte Holz aufschichtete, nach dem Weg zu fragen.
„Die Silberhains?“, knurrte der bärbeißige Kerl und stellte sich breitbeinig vor Nicolai auf. „Wer bist du und was willst du von den Silberhains?“
Stechende Augen musterten Nicolai misstrauisch. Er ließ sich davon nicht einschüchtern. Weder von der demonstrativen Drohgebärde noch von dem umständlichen Dialekt, den der Hüne sprach. Aus der Innentasche seines Sakkos fischte er das graugrüne Stück eingeschweißtes Papier, das ihm schon öfter gute Dienste geleistet hatte.
„Meine Begleiter und ich arbeiten für die Regierung“, log er und hielt es seinem Gegenüber unter die Nase. „Unsere Angelegenheiten haben Sie nicht zu interessieren, guter Mann. Ich würde es allerdings zu schätzen wissen, wenn Sie uns den Weg zum Gestüt der Silberhains zeigen könnten.“
Der nach Schweiß müffelnde Kerl beäugte den falschen Ausweis argwöhnisch. Niemand wusste so genau, wie sich Regierungsleute auswiesen – oder ob es überhaupt taten –, nicht in Bukarest und schon gar nicht hier auf diesem zivilisationsfernen Plateau in den Karpaten. Dieses windige Stück Papier aus einem Farbdrucker und eingeschweißt in Plastik hatte Nicolai schon öfter Türen geöffnet. Es funktionierte auch dieses Mal.
„Die Straße weiter“, brummte der Kerl nun mit einem deutlich demütigeren Anstrich.
Was er als Straße bezeichnete, war nicht mehr als ein unbefestigter und von Felsspuren durchzogener Karrenpfad. Das überschaubare Streudorf ringsum bestand aus grobgemauerten Steinhäusern und Scheunen. In ihrer Größe variierten sie, de facto aber sahen sie alle gleich aus. Es gab keine Garagen und bis auf den einen oder anderen Viehlaster wahrscheinlich auch keine Autos. Strom gab es immerhin, was von schmalen Masten gestützte Leitungen zumindest vermuten ließen. Nicolai schaute zurück zum Auto, in dem nach wie vor Dina und Ilia verharrten und das Szenario mit finsteren Mienen verfolgten. Der bärtige Hüne war ein wenig auf Abstand gegangen. Ein paar weitere Gestalten und Pferde oder auch Esel machte Nicolai auf den bewirtschafteten Feldern weiter unten aus. Auf der anderen Seite der Straße stieg hinter den Dorfbauten eine Felsenwand auf, gekrönt von Nadelhölzern.
„Danke, das war doch gar nicht so schwer“, sagte Nicolai und steckte den falschen Ausweis wieder ein. „Ich wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.“
„Du wirst da keine Silberhains antreffen“, raunte der Kerl, als Nicolai schon wieder einsteigen wollte.
Er hielt inne. „Wie das? Leben keine mehr? Oder sind sie weggezogen?“
Die Antwort kam verzögert. „Weggefahren.“
Nicolai fluchte im Stillen, äußerlich aber blieb er ruhig. „Nun gut, dann werden wir eben auf sie warten. Wie viele Silberhains leben hier denn?“
Der Griesgram wirkte misstrauisch, doch er gab auch darauf bereitwillig Auskunft. „Zwei. Toma und seine Schwester Teresa.“
Zwei. Nicolai hatte mit mehr gerechnet. Vor allem mit mehreren Generationen. „Verheiratet?“, fragte er.
Gemessenes Kopfschütteln. „Toma ist verlobt gewesen. Sie ist letzten Herbst fortgegangen.“
„Wie bedauerlich“, kommentierte Nicolai und machte sich gedanklich Notizen. „Und zurzeit sind beide Silberhains weggefahren?“
Der Knurrer nickte gewogen.
„Wissen Sie, wann sie wiederkommen?“
Der Mann verneinte. Nicolai rätselte, wie alt er sein mochte. Die wenige, nicht vom schwarzgrauen Rauschebart verdeckte, Gesichtshaut auf der Stirn und um die Augenpartie war schorfig wie bei Greisen, und sein grau durchsetztes Haupthaar schon ziemlich licht. Trotzdem vermutete Nicolai ihn nur wenig älter, als er selbst war. Um die fünfzig wahrscheinlich.
„Wo können wir uns denn hier einquartieren?“, fragte Nicolai.
„In einem anderen Dorf“, kam die unmissverständliche Antwort.
Nicolai verstand und nahm die Ablehnung ohne Groll hin. Je nachdem, wie sich die Sache entwickeln würde, könnte es sich noch von Nachteil erweisen, würden sie von hier aus operieren. Ein Dorf weiter talabwärts wäre wahrscheinlich die bessere Alternative. Sie hatten auch ein Zelt im Kofferraum, aber angesichts von Bären, Wölfen und Absturzgefahren erschien es ihm wenig ratsam, in der Wildnis zu übernachten. Zumindest nicht, bevor sie die Umgebung besser kannten.
Fürs Erste wusste Nicolai genug, aber eine letzte Frage konnte er sich nicht verkneifen. „Sagen Sie mir noch, guter Mann, gibt es Juneskrogs in der Gegend?“
Die Augen des Mannes schienen sich noch ein wenig weiter zu verengen. „Nein, gibt es nicht“, antwortete er.
Nicolai hatte nichts anderes erwartet. Er bedankte sich und stieg wieder in seinen von der Sonne brutal aufgeheizten Wagen. Dina und Ilia rochen leider kaum besser als der grobschlächtige Kerl. Er selbst wahrscheinlich auch nicht. Die Fahrt war lang und beschwerlich gewesen.
„Nun? Sag schon, wohin müssen wir?“, fragte Dina ungeduldig auf dem Beifahrersitz.
„Die Straße weiter“, antwortete Nicolai. „Aber sie sind nicht da. Behauptet der Kerl da jedenfalls.“
Ilia schlug zornig auf die Rücksitzlehne ein und stieß einen Fluch aus. „Das darf doch nicht wahr sein! Und was jetzt? Ich habe keine Lust, in einem stinkenden Stall zu übernachten.“ Er schaute sich gehetzt um, so als stünde in Aussicht, hier irgendwo eine billige Absteige zu finden. „Ich sage, wir fahren trotzdem hin. Zu diesem Landsitz, meine ich. Irgendwer muss da doch sein. Stallknechte und sowas. Wenn wir denen sagen, dass wir Freunde der Hausherren sind, lassen sie uns schon rein.“
„Das bezweifle ich“, sagte Nicolai und startete den Wagen. „Außerdem würde uns das in ein zweifelhaftes Licht rücken. Das können wir nicht gebrauchen.“
Der bärbeißige Kerl musterte sie grimmig.
„Warum glotzt dieser dämliche Hinterwäldler so?“, blaffte Ilia aufgebracht. „Hat der noch nie ein Auto gesehen? Ja, glotz nur her, du Riesenaffe! Du bist gemeint! Ja, du!“
„Jetzt beruhige dich schon“, gemahnte Dina misslaunig und wandte sich an ihren Bruder. „Na schön, was machen wir jetzt?“
„Umdrehen und uns irgendwo weiter unten ein Gasthaus suchen“, sagte Nicolai und wendete den Wagen. „Schau nach, wo das nächste Dorf liegt.“
Die Sonne trat hinter den Wolken hervor und versprach eine weitere schweißtreibende Autostunde. Sie waren hier gefühlt am Ende der Welt.
Kapitel 2: Vom Fluss zum Stein
Lianas bisherige Erwachsenenwelt hatte sich auf Bukarest konzentriert. Auslandsreisen für ihr Musik- und Kulturjournal brachten sie hin und wieder in andere europäische Städte. Das naturnahe und zuweilen entbehrungsreiche Leben in hochgelegenen Bergdörfern und verschlungenen Tälern war ihr bestenfalls eine wildromantische Fantasie gewesen. Teresas gelegentliche Einlassungen aus ihrer Kindheit hatten diese Fantasie nicht unbedingt befeuert, sondern eher beschnitten. Eine verhärmte Vergangenheit passte hervorragend zu Teresas herbem Naturell. Liana hatte daraus gefolgert, dass die Kindheits- und Jugendjahre ihrer Freundin und Bandkollegin wohl eine ziemlich karge und eintönige Angelegenheit gewesen waren und sie es genoss, inzwischen in Bukarest am Puls der Zeit zu leben. Umso seltsamer klang ihre jüngste Äußerung, wahrscheinlich nicht zurückkehren zu wollen.
Nicht zum ersten Mal seit Teresas Fortgang ließ Liana prägende Momente ihrer gemeinsamen fünf Jahre an sich vorbeiziehen. In ihrer Dachwohnung hatten sie oft nächtelang akribisch an Soundvariationen und Aufnahmeexperimenten getüftelt, Partys gefeiert und sich mit anderen Künstlern vernetzt. Durch Lianas Arbeit für ein Kulturmagazin wussten sie gute Kontakte in die Veranstalterszene, womit sich so mancher Gig arrangieren ließ, nicht zuletzt ein Auftritt auf einem Musikfestival, bei dem sie viel Zuspruch erfahren hatten.
Auch bei ihrer Arbeit war ihr Teresa schon nützlich gewesen. Ein Interview mit einer Crust-Punk-Band, die als ziemlich schwierig galt, lief nach Lianas kritischen Fragen erwartungsgemäß aus dem Ruder. In der Hotellobby kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Zum Glück war Teresa als Backup zur Stelle und hatte dem Sänger einen Kinnhaken verpasst – womit sich die Situation dann doch schnell wieder beruhigen ließ.
Abends tanzten sie in Clubs, besuchten Konzerte und erdachten und verwirklichten ihre eigene Musik. Das Bett hatten sie nur gelegentlich geteilt. Sie waren Freunde. Sehr gute Freunde. Ein Team in allen Freuden und Leiden, die der Musikbetrieb so mit sich brachte.
Der Zug entließ Liana unweit eines heruntergewirtschafteten Gebäudes aus unbearbeiteten Bruchsteinen. Es war der Bahnhof eines geschäftigen Holzfällerdorfes, das hier eine kaum noch begrünte Talsohle ausfüllte. Auf Nebengleisen reihten sich Güterwaggons, etliche mit Baumstämmen beladen, die man mit mächtigen Ketten festgezurrt hatte. Lastkräne entluden Traktorenanhänger und hievten weitere Stämme heran. Der Duft von Holz war allgegenwärtig, wofür die unermüdlich arbeitenden Kreissägen der Sägewerke sorgten. Neben den überall gleichaussehenden Wohnbaracken für Wanderarbeiter gab es abseits der Gleise auch durchaus schmucke Häuser aus Holz oder Bruchstein, die sich den sacht ansteigenden Talseiten andienten, manche mit Pferchen und Stallanbauten. Straßen aus festgefahrenem Schutt und Geröll waren vermutlich vornehmlich für die Holzzuleitung angelegt worden.
Nach Liana verließ noch eine Gruppe Männer den Zug, gestandene Holzfäller ihrem Aussehen nach. Ein Vorarbeiter nahm sie in Empfang und hieß sie, ihm zur Verwaltung zu folgen. Liana wiederum hielt auf das Bahnhofsgebäude zu. Aus dem war soeben Teresa auf den Bahnsteig gekommen und empfing sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Das war durchaus bemerkenswert, da das bei Teresa eher selten vorkam. In Bukarest hatte sie sich der Stadtmode angepasst, bei ihren Bandauftritten sich meist in Lack und Leder geschnürt. Hier und heute trug sie ein kariertes Hemd, Jeans und Wanderstiefel. Ihr nussbraunes Haar war ein paar Nuancen dunkler als Lianas, und sie hatte es zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden. Sie war nicht allein gekommen. Ein Mann flankierte sie, unmerklich größer als sie, schulterlanges Haar in sattem Braun und ebenfalls in Hemd, Jeans und leichte Stiefel gewandet. Entweder hatte sie hier jemanden aufgerissen oder das war – wie Liana vermutete – ihr Bruder Toma. Der, dem die Verlobte weggelaufen war, weswegen Teresa für ein paar Wochen im Familiengestüt aushelfen wollte. Das jedenfalls hatte sie bei ihrer Abreise behauptet. Inzwischen waren sechs Monate vergangen.
Mit scheelen Blicken begutachtete sie Lianas Reisetaschen. „Wo hast du deine Gitarre gelassen?“, rief sie. „Es gibt hier Strom, stell dir vor.“
„Dein Board steht noch im Proberaum“, entgegnete Liana. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir jammen würden.“
„Wir haben ein altes Klavier im Haus“, sagte Teresa.
Liana stellte ihre Taschen ab, dann schlossen sich die beiden in die Arme. Der Zug nahm bereits wieder Fahrt auf.
„Schön, dich zu sehen“, murmelte Liana.
„Ist nett, dass du uns besuchen kommst“, entgegnete Teresa.
Anschließend machte Teresa ihren Begleiter bekannt, bei dem es sich wie angenommen um ihren Bruder Toma handelte. Sie hatte ihn ein paar Mal flüchtig erwähnt. Er war in Bukarest auf einer Wirtschaftsschule gewesen, was in Teresa Begehrlichkeiten geweckt und sie schließlich selbst von zu Hause fortgetrieben hatte. Toma war vier Jahre älter als sie, einunddreißig demnach, und der Stammhalter der Silberhains, der ihre zweihundertfünfzigjährige Familiendynastie in dieser Gegend fortführen sollte. Anscheinend hatte er sich dafür aber die falsche Frau ausgesucht. Ob es noch weitere Geschwister gab, wusste Liana nicht. Eltern hatten die Silberhains jedenfalls nicht mehr.
„Sei uns willkommen, Liana“, sagte Toma bei einem flüchtigen Händedruck. „Teresa hat mir alles über dich erzählt.“
Alles bestimmt nicht, dachte Liana und verkniff sich ein Grinsen. Eine ruhige Stimme, dem ersten Eindruck nach auch eine ruhige Art, nahm sie auf. Das zurücknehmende Lächeln in seinem Gesicht wirkte echt und sogar routiniert. Anders als bei Teresa, deren Lippen immer wie Fremdkörper aussahen, wenn die Mundwinkel gelegentlich mal nach oben gingen.
„Wartet ihr schon lange?“, fragte Liana. „Wir hatten einen langen Stopp in einem Dorf weiter unten.“
Toma verneinte. „Wir haben Besorgungen gemacht. Sachen, die wir bei uns oben nicht bekommen.“
Liana überflog die nahen Häuser und Bauten des Ortes. Nichts hier sah nach einem Supermarkt aus. „Was denn zum Beispiel?“
„Sägeblätter, genormte Dübel, Schrauben, Tortellini, eine Kiste Wein“, zählte Toma auf. „Außerdem haben wir eine neue Harfe für unsere Käserei in Auftrag gegeben.“
„Ihr habt eine Käserei?“
„Die letzte geschäftstüchtige Instanz der Silberhains“, raunte Teresa. „Na los, wir haben anderthalb Stunden Autofahrt vor uns.“
Zuvorkommend nahm Toma eine von Lianas Reisetaschen auf. Liana hatte gewusst, dass das Gestüt weit abgelegen war, aber anderthalb Stunden vom nächsten Bahnhof war schon eine Hausnummer.
Da Toma den Geländewagen steuerte, hatte Liana genug Muße, die Gegend auf sich wirken zu lassen. Bei der Zugfahrt wusste sie die spärliche Besiedlung und der Mangel an so vielem, was die moderne Zivilisation ausmachte – zum Beispiel ein Handynetz –, noch zu beunruhigen. Inzwischen war dem eine gewisse Faszination gewichen. Nicht unwahrscheinlich, dass sich diese Eindrücke in inspirative Ergüsse für ihre Musik kanalisieren ließen. Ihr Space-Trance lebte von Emotionen wie Einsamkeit und dem Eindruck von Verlorenheit in endlosen Weiten. Davon war hier reichlich geboten. Gelegentlich streiften sie dichte Wälder, zumeist aber hangelten sie sich über unbefestigte Straßen um Bergkegel herum, was Liana unvergessliche Aussichten über Schluchten und ferne Bergzüge bescherte.
Auch Teresa, die auf der Rücksitzbank saß, hatte ihren Blick meist nach draußen gerichtet, wenn Liana sich zu ihr umdrehte. Was in ihr vorging, war schwer zu erahnen, so wie meistens. In den fast anderthalb Stunden, die die Autofahrt inzwischen andauerte, hatte sie kaum zehn Sätze gesprochen. Vielleicht war sie in Gedanken bei ihren Pferden. Vielleicht auch bei ihrer Musik, bei faulen Pfirsichen oder fliegenden Einhörnern, das konnte man bei ihr nie so genau wissen. Nach der durchaus herzlichen Begrüßung hatte wieder das pragmatisch kurzangebundene Wesen Einzug gehalten, als das Liana sie vor fünf Jahren kennengelernt hatte. Über ihre in Bukarest zurückgelassenen Freunde und Bekannte hatte sie nicht viel wissen wollen. Selbst Grazian – immerhin seit fast vier Jahren ihr Mitmusiker – war in wenigen Sätzen abgehandelt gewesen. Vielleicht wollte sie in Gegenwart ihres Bruders nicht darüber reden. Wenigstens Toma hatte sich während der Fahrt um ein wenig Smalltalk bemüht und Liana ein paar Fragen über ihre Arbeit als Kulturjournalistin gestellt.
„Jetzt ist es nicht mehr weit“, meinte er weiterhin gutgelaunt, als nach einem steilen Waldstück Häuser eines Dorfes in Sichtweite kamen. „Im Tal dahinter liegt unser Gestüt.“
Straßen, die zuletzt kaum mehr als steinige Pfade gewesen waren, hatten sie weit hinaufgeführt. Die Sonne lugte gerade noch über ein tannengekröntes Felsmassiv, vor dem ein langgezogenes Gebäude mit einem eindrucksvollen Mansarddach stand. „Das ist die Käserei“, merkte Toma an. „Leute aus dem Dorf betreiben sie. Wir machen nur die Buchhaltung.“
Liana schaute sich um. Grob überschlagen überflog sie etwa dreißig bis vierzig verstreute Wohnhäuser aus Stein und nochmal so viele Scheunen und Ställe. Die bestanden überwiegend aus Holz, aber es gab auch Mischbauten, die wahrscheinlich beides in einem waren. Dazwischen spannten sich in angeratener Höhe Stromleitungen, vielfach von schlanken Holzmasten gestützt. Die meisten Häuser hatten Pflanzgärten, hier und dort entdeckte Liana auch Einwohner. Autos waren keine zu sehen, nur zwei alte Lkw, die ihrem Aussehen nach für Viehtransporte benutzt wurden. Hinter dem Käsereigebäude stieg ein Felsmassiv an, doch in die andere Richtung fiel das Land sacht ab. Ein steiniger Weg führte von den Häusern fort zu bewirtschafteten Feldern weiter unten. Liana erspähte eine Schaf- und Ziegenweide und ein paar Gestalten. Auf einer Wiese tollten Kinder in den letzten Sonnenstrahlen dieses Tages. Dabei war es erst fünf Uhr nachmittags. Liana brachte die in ihren Augen unglückliche Lage des Dorfes zur Sprache.
„Das hat schon seine Bewandtnis“, erläuterte Toma. „Die Sonne geht früh unter, aber dafür schützt uns das Massiv vor den eisigen Stürmen im Winter. Unser Tal liegt schon seit zwei Stunden im Schatten.“
Die holprige Straße ließ bald die letzten Dorfbauten hinter sich und grub sich in teils engen Windungen in ein dicht bewaldetes Tal. An manch lichten Stellen war auch hier der Ausblick ehrfurchtgebietend. Liana sah Wipfel majestätischer Nadelhölzer. Wie Türme eines gewaltigen Schlosses ragten sie empor, und Liana kam sich plötzlich ziemlich klein vor. Auf eine Art Schloss machte sie sich auch an ihrem Zielort gefasst. Teresa hatte mal erwähnt, dass der Landsitz ihrer Familie über einen Turm verfügte. Die Silberhains waren alter deutscher Adel, Siebenbürger Sachsen, die im achtzehnten Jahrhundert nach Transsilvanien ausgewandert waren und hier ihre Dynastie begründet hatten.
Die Straße lotste sie an einen vom Efeu umrankten Holzzaun und schließlich an ein brusthohes Tor. Teresa stieg aus, öffnete es mit einem eindrucksvoll großen Schlüssel, und Toma konnte einfahren.
Beidseitig säumten Bäume die brüchig gepflasterte Einfahrt. Die langen Arme und Fänge von mehrheitlich Buchen und Eichen kratzten beinahe am Autodach. Als sie die Sicht freigaben, zauberte der Anblick Liana ein Staunen auf die Lippen. Sie hatte nicht zu viel erwartet. Stufen führten zu einer Empfangsterrasse hinauf, auf der vier mächtige Säulen das nach vorn gerückte Obergeschoss des Mittelhauses stützten. Alles bestand aus Fachwerk, inklusive dem Rundturm, der das Mittelhaus linksseitig begrenzte. Die Turmrundung floss weich in einen sich zurücknehmenden Hausflügel über, den Liana als Wirtschaftshaus identifizierte. Dafür sprach die umschließende Pferdekoppel, deren Begrenzungszaun bis zum Waldrand reichte. Eine Handvoll grau- und dunkelhäutige Tiere tummelten sich darin, darunter auch ein paar Fohlen.
Der rechte Hausflügel wurde von einem prächtigen Giebel im Satteldach gekrönt. Ein Wohnhaus, vermutete Liana, da auch eine Terrasse dazugehörte. Knapp über dem Grund reihten sich Fenster, was auf ein Kellergeschoss schließen ließ.
„Wofür ist der Turm?“, fragte Liana. „Zwischen diesen engen Talseiten macht der doch nicht viel Sinn, oder?“
„Warte es ab“, meinte Toma mit einem süffisanten Schmunzeln. „Nord- und ostwärts sieht man ziemlich weit. Süd- und westwärts hast du allerdings recht. Er wurde um 1890 errichtet. Wahrscheinlich wegen der Nordseite, um frühzeitig Räuber auszumachen – zweibeinige und vierbeinige.“
„Was hat es mit der Nordseite auf sich?“
„Wirst du gleich sehen“, verhieß Toma.
Sie umrundeten das Gebäude an der Terrassenseite, und Liana verstand, was er gemeint hatte. Rückseitig flachte das Land sanft ab und floh in tiefer gelegene Täler. Liana sah eine Menge Wald und Wiesen, beidseitig von Felszügen flankiert.
„Wenn man die Pfade kennt, kommt man ziemlich weit nach unten“, sagte Toma. „Schon seit Jahrhunderten ziehen hier die Wölfe bei ihren Wanderungen durch. Aber auch Banditen sind hier früher vom Tal heraufgekommen.“
„Hat sich das denn gelohnt?“, fragte Liana. Wegen ein paar Pferde, Schafe und Ziegen?, ließ sie ungesagt.
„Als unsere Mine noch Gold abgeworfen hat, bestimmt.“ Toma steuerte eine offene Garage an der Hausrückwand an, in der auch ein Viehlaster und ein Unimog aufwarteten. „Sie ist vor etwa hundert Jahren stillgelegt worden.“
Liana runzelte die Stirn und fuhr vorwurfsvoll zu Teresa herum. „Wölfe, Banditen, eine Käserei, eine Goldmine, ich bin noch nicht mal ausgestiegen und habe schon mehr über deinen Familiensitz erfahren, als du mir in fünf Jahren erzählt hast.“
Teresa hob die Augenbrauen und taxierte sie mit ihrer gewohnt unwirschen Miene. „Als ob du eine ausgebeutete Mine spannend gefunden hättest.“
„Und wie ich das hätte“, beteuerte Liana, was nicht gelogen war.
Toma stellte den Wagen neben dem Viehtransporter ab. „Komm erstmal an und richte dich ein, dann führt dich Teresa sicher gern herum. Wir haben dir im Stall ein Bett aufgestellt.“ Dass er daraufhin grinste, beruhigte Liana.
Nach Stall roch es trotzdem, als sie ausstieg.
***
Der über die Jahrhunderte mehrfach erweiterte Landsitz wusste Liana zu beeindrucken, wenngleich er laut Toma eine Dauerbaustelle war. Es bestand aus dem nach Osten ausgerichteten Wohnhaus, dem Mittelhaus mit dem Rundturm und dem Wirtschaftshaus mit den Stallungen und der Pferdekoppel. Das Wohnhaus machte seiner Bezeichnung durchaus Ehre, wie Liana befand. Im Obergeschoss nahm sie ein großzügiges Vestibül in Empfang. Sie befanden sich hier unter dem Giebel, wo ein raumhohes Fenster eine Menge Tageslicht hereinließ.
„Hier wohnen wir“, merkte Toma an. „Schlafzimmer gibt es genug.“
Er und Teresa geleiteten Liana durch einen Bogen in einen freundlich gestalteten Flur. Der Boden war wie im Vestibül aus weichem Parkett. Liana fand es gemütlich und auch geschmackvoll eingerichtet, so auch die einsehbaren Räume. Das vorbereitete Gästezimmer konnte sich ebenfalls sehen lassen. Bett, Kommode, Schrank, ein Fenster, mehr brauchte es nicht. Liana stellte ihre Taschen ab und brach dann mit Teresa zu der versprochenen Besichtigungstour auf. Toma entschuldigte sich, um den Wagen auszuladen, was Liana ganz recht war. Ohne ihn würde sie Teresa leichter auf den Zahn fühlen können.
Der Wohntrakt des Anwesens brauchte sich hinter einer modernen Penthousewohnung in Bukarest nicht zu verstecken. Anders das Wirtschaftshaus, das über einen Flur durch das Mittelhaus zu erreichen war und sich mit vielfach bröckelnden Wänden, viel zu niedrigen Türstöcken und drückenden Decken auszeichnete. Es war der älteste Teil des Landsitzes. Aus Kostengründen waren nur die wichtigsten Räumlichkeiten im Laufe der Jahrzehnte kernsaniert worden.
In der Empfangshalle im Erdgeschoss des Mittelhauses trafen sie auf eine zierliche Frau. Teresa stellte sie Liana als ihre Haushälterin Griselda vor. Spitzgesichtig, mit schwarzer Steckfrisur und in ihrem bis oben zugeknöpften schwarzen Kittel wirkte sie wie eine wandelnde Krähe und hatte auch eine dazu passende Stimme. Gleichwohl brachte sie für den Hausgast ein gewogenes Lächeln zustande. Liana schätzte sie etwa fünfzig Jahre alt.
„Habt ihr noch mehr Angestellte?“, fragte Liana, nachdem Griselda die Hauptstiege empor entschwunden war.
Teresa verneinte. „Unser Vater hat die letzten beiden Stallknechte entlassen, als er sie nicht mehr bezahlen konnte. An der Situation hat sich nicht viel geändert.“
Von der Empfangshalle ging es weiter ins Erdgeschoss des Wohnhauses. Dort dominierten ein gemütlicher Salon und ein Speisesaal mit nebst gelegener Anrichte samt Speiseaufzug aus der Küche im Kellergeschoss, wie Teresa erläuterte. Im Salon, einem rechteckigen Raum mit Bücherwand und Kamin, der stirnseitig an der Terrassenfront mündete, besah sich Liana gerahmte Familienfotos. Sie zeigten mehrere Generationen von Silberhains, darunter auch Teresas Eltern.
Liana dachte an Tomas Bemerkung im Vestibül mit den vielen Schlafzimmern und musterte ihre Freundin von der Seite. „Früher haben hier eine Menge Silberhains gelebt, nehme ich an“, folgerte sie.
Teresa bestätigte mit einem vagen Nicken. „Meistens mindestens drei Generationen, dazu Knechte im Souterrain. Wir hatten Äcker und Wald, Tiere, eine Säge, eine Schmiede, eine Stellmacherei. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das meiste haben uns die Kommunisten in den Tagen unserer Großeltern weggenommen. Unsere Eltern wollten alles wiederherstellen. Sie haben investiert, um aus dem Gestüt etwas zu machen, das Zukunft hat.“ Teresa seufzte und wandte sich ohne Hast von ihrer Ahnenwand ab. „Sie sind gescheitert“, fügte sie mit Blick auf die gläserne Terrassenfront hinzu. „So wie auch Toma scheitern wird.“
Damit waren sie am Kernpunkt von Lianas Reise angelangt.
„Wenn du das Unterfangen für sinnlos hältst“, sagte Liana und trat an ihre Seite, „warum bist du dann noch hier?“
Teresa ließ sich Zeit für einen Atemzug, während sich ihre Augen irgendwo draußen verloren. „Weil Toma mich braucht“, antwortete sie. „Und weil ich hier etwas wiedergefunden habe, das ich in Bukarest verloren hatte. Lange Zeit habe ich es ignoriert. Nun spüre ich es wieder.“
Liana musterte sie fragend. „Ich höre. Was ist das?“
„Stille“, sagte Teresa und sah Liana wieder an. „Ruhe. Andacht. Innehalten. Sich selbst begreifen.“
Das ist alles?, war Liana geneigt zu fragen, schluckte es aber hinunter. „Wann kommst du zurück?“, kam ihr stattdessen über die Lippen.
„Ich weiß noch nicht, ob ich zurückkomme“, war Teresas ernüchternde Antwort, und in ihren Augen las Liana, dass sie es so meinte.
„Aber hier ist doch nichts!“, entfuhr Liana aufgebracht. „Hier gibt es nichts! Keine Clubs, keine Bars, keine Musik, kein Publikum! Nur Stein, Wald und verdammt viel Schatten!“
„Und unseren Familiensitz“, entgegnete Teresa.
Liana zuckte mit den Schultern. „Wenn schon. Toma sieht gut aus, der wird bald wieder jemanden finden. Oben im Dorf gibt’s doch bestimmt Frauen.“
„Das ist nicht der Punkt“, sagte Teresa geduldig. „Ich bin gern hier. Es tut mir gut. Und mir ist tief drin bewusst geworden, wie sehr ich das Stadtleben leid bin.“
Liana konnte es nicht fassen. „Und unsere Musik?“ Dass Teresa alles, was sie in Bukarest zusammen hatten – ihre Band, ihre Wohnung, ihre Freundschaft – für diese abgelegene Einöde aufzugeben bereit war, verletzte sie.
„Du und Grazian könnt ohne mich weitermachen“, schlug Teresa vor.
Liana wurde wütend. „Du und ich sind das Herz der Band! Wir haben sie gegründet! Wir haben unseren Sound und unseren Stil definiert. Ich kann nicht einfach mit Grazian weitermachen. Will ich auch gar nicht. Du und ich sind die Band!“ Sie bemühte sich um Strenge, innerlich aber rang sie mit den Tränen. Wie konnte Teresa fünf Jahre Freundschaft, akribisches Komponieren und all die erhebenden Momente bei Live-Auftritten einfach wegwerfen?
Teresa atmete abermals durch und nahm Liana an beiden Händen. „Ich kann verstehen, was in dir vorgeht“, behauptete sie und klang tatsächlich einfühlsam – ein klein wenig zumindest. „Gib mir Zeit, dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“
Erst jetzt bemerkte Liana die innere Ruhe, die von ihrer Freundin ausging. Das musste wohl tatsächlich die Gegend ausmachen. Die getriebene Teresa, mit der sie sich ganze Nächte mit Komponieren, Soundexperimenten und Aufnahmen um die Ohren geschlagen hatte, war ihr trotzdem lieber.
***
Zuletzt durfte Liana noch den Keller besichtigen – das Souterrain, wie Teresa es betulich nannte.
„Was ist mit Sushi?“, fragte Liana auf der Treppe. „Shawarma? Indisch hast du auch immer gern gegessen. Und Pizza!“
„Nichts davon brauche ich wirklich“, erklärte Teresa, die vorausging. „Und für Pizza hätten wir sogar einen Steinbackofen.“
Am Fuß der Treppe angelangt, sorgte sie für Licht, und die beiden betraten ein niedriges Backsteingewölbe. Draußen hielt die Abenddämmerung Einzug, aber auch bei Tag musste dieser Bereich eine ziemlich düstere Angelegenheit sein. An den mächtigen Querbalken konnte sich jemand von Tomas Statur leicht den Kopf stoßen. Liana kam gerade so durch. Sie zog trotzdem intuitiv den Kopf ein. Vom Hauptkorridor führten ein paar Seitenflure fort und mündeten an Fenstern, die Juliana bei ihrer Anfahrt gesehen hatte. Lichteinfall von draußen war kaum wahrnehmbar. Ohne die Wandlampen wäre es wahrscheinlich nächtlich finster gewesen.
„Was ist mit Sex?“, setzte Liana ihre Anhörung nach Annehmlichkeiten fort, auf die Teresa hier verzichten musste.
„Ich habe Sex“, erklärte Teresa bestimmt. „Wann immer ich will.“
Liana hob skeptisch die Augenbrauen. „Ach ja? Mit wem?“
Teresa fuhr herum und bedachte sie mit einem schneidenden Blick. „Wenn du es unbedingt wissen willst, mit einem Jugendfreund. Oben, im Dorf. Er ist inzwischen mit einer guten Freundin verheiratet. Für sie ist das in Ordnung.“
Liana staunte unfreiwillig und nahm das Gesagte hin. Sie und Teresa waren bei bislang drei Gelegenheiten miteinander im Bett gelandet. Das erste Mal zusammen mit Grazian in der betörenden Euphorie nach einem gelungenen Auftritt, das zweite Mal, nachdem Liana von ihrem Ex-Freund Bogdan fallengelassen worden war, und noch einmal, weil ihnen schlichtweg danach gewesen war.
„Und das genügt dir?“, schob Liana frustriert hinterher.
„Ob du es glaubst oder nicht“, erwiderte Teresa.
***
Nach der rudimentären Besichtigungstour fanden sie sich zum Abendessen im Speisesaal ein. Nur zu dritt an der etwa sechs Meter langen altehrwürdigen Tafel zu sitzen, fühlte sich seltsam an und sah wahrscheinlich auch seltsam aus, nichtsdestotrotz war das offenbar üblich im Hause Silberhain. Möglicherweise Tomas und Teresas Art, ihre verstorbenen Vorfahren zu ehren. Liana fragte nicht. Toma saß an der von den beiden Fenstern abgewandten Stirnseite, Teresa und Liana nebeneinander ihm zur Rechten. Der Raum war bis unter die Decke holzvertäfelt, was ihm den Anstrich einer urigen Kneipe verpasste.
Griselda servierte ein reichhaltiges Abendessen, wofür Toma sie ausgelassen lobte. Teresa hingegen wirkte abwesend und verhielt sich seit ihrem Rundgang ziemlich zugeknöpft. Liana kannte sie Grunde kaum anders. Gleichwohl hoffte sie, etwas in ihr aufgerührt zu haben. Liana wollte sie zurück. In Bukarest. An ihrem Keyboard. Und als ihre Freundin.
„Hey, ich habe einen Vorschlag“, brachte sie sich ein, nachdem es ziemlich ruhig an der Tafel geworden war. „Wie wäre es mit einem gemeinsamen Spieleabend? Carcassonne oder Die Siedler von Catan, habt ihr sowas im Haus? Dazu eine Flasche Wein, was meint ihr?“
Aus Tomas Blick schloss Liana, dass er nicht recht wusste, wovon sie redete. Auch Teresa war nicht der Spiele-Typ, aber in Bukarest hatte Liana sie immerhin ein paar Mal überreden können.
„Monopoly vielleicht?“, fügte sie hinzu. „Oder Cluedo?“
„Ich glaube, wir haben irgendwo ein Schachspiel“, überlegte Toma.
Liana seufzte. „Habt ihr Spielkarten? Ganz egal, welche, wir improvisieren einfach. Das wird sicher lustig.“
„Ohne mich“, stellte Teresa klar. „Ich stehe morgen früh auf. Die Tiere brauchen ihren Auslauf.“
„Dann machen wir das ein andermal“, bemerkte Toma in Teresas Richtung. „Wir haben nämlich Spielkarten im Haus.“ Er schien der Idee tatsächlich etwas abgewinnen zu können.
Anders Teresa. Sie streifte ihn mit einem genervten Blick und widmete sich wieder ihrem Essen.
Aus dem gemeinsamen Spieleabend wurde somit nichts, deshalb zog sich Liana nach einem Glas Wein in ihr Zimmer zurück. Die lange Reise in den Knochen und von unerwarteten, aber auch faszinierenden Eindrücken beseelt schlief sie schnell ein.
***
Das Aufregendste, was sie für den neuen Tag erwartete, war ein gemeinsamer Ausritt mit Teresa. Dann aber geschah etwas, das dem Morgen eine unerwartete Dynamik verlieh. Auf der Terrasse nippte sie an ihrer Kaffeetasse und badete in den ersten Sonnenstrahlen, die über die flach ansteigenden Waldhänge im Osten auf sie fielen, als eine frühlingshafte Melodie einen Besucher am Außentor ankündigte. Im ersten Moment sah Liana wenig Veranlassung, darauf zu reagieren und wollte lieber in Ruhe ihren Kaffee genießen, doch dann war das Interesse doch größer, wer den Silberhains so früh seine Aufwartung machte. In der Eingangshalle traf sie auf Toma.
„Erwartet ihr jemanden?“, fragte sie.
Toma, der sich an der Garderobe gerade eine leichte Jacke über sein Hemd zog, verneinte. „Weder Handwerker noch Lieferanten noch Verwandtschaft“, sagte er und wirkte etwas verhalten.
Liana schlüpfte ebenfalls in eine Jacke. „Hast du eine Vermutung?“
„Nein, aber nach meiner Erfahrung bringen unangekündigte Besuche selten was Erfreuliches.“
Liana konnte das von sich zu Hause nicht bestätigen, aber sie nahm es hin. Sie folgte Toma durch die schwere Hauspforte nach draußen und stieg mit ihm die Treppen zur Zufahrt hinunter. Bald war das Außentor in Sichtweite. Liana erspähte einen schwarzen Wagen und ein paar Gestalten, die sich um ihn scharten.
„Kennst du die?“, fragte sie Toma.
Toma schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht. Niemand aus dem Dorf.“
Sie gingen näher. Ein hellhaariger Mann war bis ans Tor herangetreten. Hinter ihm verharrten zwei weitere Personen am Auto. Die eine schien eine Frau zu sein. Als Liana und Toma nur noch ein paar Meter entfernt waren, hob der Mann am Tor eine Grußhand. „Guten Morgen“, rief eine klare wie kräftige Stimme.
„Guten Morgen“, erwiderte Toma. „Was kann ich für Sie tun?“
Der Mann trug ein marineblaues Jackett auf weißem Hemd, was ihm durchaus stand. Sein weizenfarbiges Haar neigte bereits zu Geheimratsecken. Er war etliche Jahre älter als sie und Toma und sicher schon in den Vierzigern.
„Sie sind Toma und Teresa Silberhain, nehme ich an“, sagte er mit einem freundlichen Lächeln im bartlosen Gesicht.
Liana und Toma hielten ein paar Schritte vor dem Tor inne.
„Ich bin Toma Silberhain“, entgegnete Toma. „Und mit wem habe ich das Vergnügen?“
„Sind Sie verwandt mit Rudolf Silberhain?“, fragte der Fremde, ohne sich vorzustellen.
„Das war mein Großvater“, antwortete Toma. „Dürfte ich jetzt erfahren, wer Sie sind?“
„Verzeihung, ich musste erst sichergehen, dass wir hier richtig sind“, erwiderte der Fremde unentwegt lächelnd. „Mein Name ist Juneskrog. Nicolai Juneskrog.“ Mit einer weichen Geste verwies er auf seine beiden Begleiter am Auto. „Das sind meine Schwester Dina und ihr … Gefährte Ilia.“
Die besagte Schwester war eine eher kleine Frau und bemerkenswert muskulös, konstatierte Liana. Ihre schulterlangen rostbraunen Haare mochten gefärbt sein, vielleicht auch nicht. Bluse und Rock hatten schon bessere Tage gesehen. Ein unwirscher, humorloser Blick, gar mit Teresa zu vergleichen, wohnte ihr inne. Der stämmige Mann neben ihr trug einen ähnlichen Ausdruck zur Schau. Sein pechschwarzes Haar war so kurz wie der Bartflaum in seinem Gesicht. Er steckte in Jeans und einer engen grünen Jacke mit arg ausgebeulten Brusttaschen. Zigaretten wahrscheinlich, vermutete Liana. Beide nickten zum Gruß. Toma tat es ihnen mit einem wachsamen Blick gleich.
Der Vorderste der drei, Nicolai Juneskrog, musterte ihn, so als erwarte er eine Reaktion. Nachdem eine solche ausblieb, hakte er nach. „Sie wissen nicht, wer wir sind?“
„Woher sollte ich?“, entgegnete Toma. „Meines Wissens begegnen wir uns heute zum ersten Mal.“
Das Paar am Wagen tauschte einen Blick, der Liana nicht sonderlich gefiel.
Nicolai Juneskrog studierte weiterhin Toma. „Mein und Dinas Vater war Martin Juneskrog“, sagte er. „Unser Großvater war Lothar Juneskrog.“
Toma zuckte die Schultern. „Diese Namen sagen mir nichts, tut mir leid.“
„Ich hab’s doch geahnt“, schnarrte die Frau am Wagen verächtlich und taxierte Toma finster. „Er leugnet es. Will nichts davon wissen.“
„Was will ich nicht wissen?“, erwiderte Toma strenger als zuvor.
Bemerkenswert schnell und katzengleich begab sich der andere Mann ebenfalls ans Tor. „Du hast etwas für uns“, fuhr er Toma grimmig an. „Denk mal scharf nach, Junge. Mag ’ne Weile her sein, aber du hast etwas zugesteckt bekommen, das uns gehört.“
Liana verspürte den Impuls, zurückzuweichen, Toma hingegen trat nun sogar näher an die beiden Männer heran. „Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind“, sagte er so ruhig wie resolut. „Auch lasse ich mich nicht von Ihnen auf meinem Grund einen Dieb heißen. Steigen Sie in Ihren Wagen und verschwinden Sie von hier.“
„Nicht, bevor wir haben, was uns gehört“, blökte der Aggressivere der beiden, der vorhin als Ilia vorgestellt worden war.
„Beruhige dich und lass mich das machen“, raunte Nicolai Juneskrog und drängte den anderen Mann einen Schritt zurück, bevor er sich wieder an Toma wandte. Auch Teresa war plötzlich da. Liana hatte sie nicht kommen sehen und war dankbar um die Verstärkung. Diese Begegnung entwickelte sich äußerst unerfreulich.
„Hören Sie zu“, sagte Nicolai Juneskrog. Er lächelte nicht mehr, aber er war noch immer der Umgänglichste der drei. „Wir sind einen weiten Weg gekommen. Unser Vater, Martin Juneskrog, ist kürzlich verstorben. Er hat uns Ihren Namen genannt. Silberhain. Sie haben etwas, das uns gehört. Ihr Großvater, Rudolf Silberhain, hat es vor vielen Jahren von unserem Großvater Lothar anvertraut bekommen.“
„Ich wiederhole mich“, sagte Toma streng, aber geduldig. „Ich weiß nicht, wovon Sie reden. In unserem Familiensitz befindet sich garantiert nichts, das Ihnen gehört. All die Namen, die Sie mir hier aufzählen, sind mir völlig fremd. Falls mein Großvater je mit Ihrem Großvater zu tun hatte, ist mir nichts davon bekannt.“
„Denken Sie nochmal nach“, forderte Nicolai Juneskrog mit nicht mehr der Spur seines vormals so freundlichen Lächelns. „Es mag lange her sein, aber unser Name muss Ihnen etwas sagen.“
„Tut er nicht“, stellte Toma klar und sah zu Teresa. „Sagt er dir etwas?“
„Nicht die Spur“, erklärte Teresa mit eisigem Blick. „Ich schlage vor, Sie verschwinden jetzt.“
„Es war Gold, nicht wahr?“, zischte plötzlich die Frau und trat mit funkelnden Augen ebenfalls ans Tor heran. „Ihr habt euch hier mit unserem Gold ein nettes Leben aufgebaut, was? Ihr diebischen –“
„Ruhe!“, wurde sie von ihrem Bruder angeherrscht. Schon wandte er sich wieder an Toma. „In der Tat frage ich mich, warum euch die Kommunisten nicht ebenfalls enteignet haben, wie so viele andere. Hat sich euer Großvater vielleicht freigekauft? Mit unserem Gold zum Beispiel?“
Liana hatte es schon geahnt. Worum immer es hier ging, die Wurzeln lagen wie so vieles in den dunklen Tagen, als die Sozialisten das Land unterjocht und ausgeplündert hatten.
Toma trat nun so nahe ans Tor, dass ihn die drei auf der anderen Seite mühelos packen könnten, würde sie wollen. Liana rang mit dem Impuls, ihn von dort wegzuziehen, doch sie verstand, dass Toma hier klarmachen musste, dass er vor diesen drei seltsamen Vögeln keine Angst hatte. „Dieses Land hier“, sprach er langsam und in jedem Wort eine Drohung, „wurde von Silberhains erschlossen, von Silberhains urbar gemacht und von Silberhains besiedelt. Alles, was Sie hier sehen, wurde von Generationen von Silberhains aufgebaut und erwirtschaftet. Wir haben geblutet, als die Kommunisten alles an sich rissen, o ja, das haben wir, und doch gibt es uns noch. Unser Großvater hat sich mit dem Regime arrangiert, und Gold hatte rein gar nichts damit zu tun. Ich lege Ihnen dreien jetzt ein letztes Mal nahe, in Ihren Wagen zu steigen und zu verschwinden. Es gibt hier nichts für Sie.“
Der Mann namens Ilia setzte ein höhnisches Grinsen auf. „Und was willst du machen, wenn wir bleiben, Bursche?“
Eine Antwort blieb Toma erspart, denn Nicolai Juneskrog drängte seinen Schwager – oder was immer er sein mochte – mit sanfter Gewalt zum Wagen zurück. „Komm, lass es gut sein, wir ziehen ab.“
Die giftige Frau fuhr ihren Bruder empört an. „Was? Du willst die damit durchkommen lassen?“
Nicolai Juneskrog ging nicht auf sie ein, sondern drehte sich noch einmal zu Toma um. „Stöbern Sie in Ihren Papieren, Herr Silberhain“, verlangte er schroff. „In Testamenten und sonstigen Aufzeichnungen Ihres Vaters und Ihres Großvaters. Und dann sprechen wir uns wieder.“
Toma verharrte unbewegt am Tor, bis das Auto der drei gewendet hatte und die schmale Straße in Richtung Dorf zurückrollte. Durch die Heckscheibe sah Liana Ilias bärtiges Gesicht, der sie und die Silberhains mit finsteren Blicken aufspießte. Als sich Toma Liana und Teresa zuwandte, wirkte er besorgt. „Die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen, fürchte ich. Ich werde tun, was mir der Kerl geraten hat. Alte Papiere durchforsten.“ Er schüttelte versonnen den Kopf. „Juneskrog. Dieser Name ist mir völlig unbekannt.“
„Mir nicht“, sagte Teresa zur Überraschung ihres Bruders und auch Lianas.
Beide taxierten sie erwartungsvoll, doch Teresa blieb still.
„Na, jetzt sag schon“, verlangte Toma. „Wer sind die?“
Nun war es Teresa, die unmerklich den Kopf schüttelte. „Es fällt mir nicht ein. Aber ich bin mir sicher, diesen Namen schon mal irgendwo gehört oder gelesen zu haben.“ Sie stolzierte Richtung Koppel davon. „Ich denke darüber nach.“
Als sich die drei zum Mittagessen im Speisesaal trafen, wusste Teresa mehr.
„Juneskrog, ich habe diesen Namen mal gelesen“, erklärte sie. „Und zwar in einen Türstock eingraviert. Bei den Totans.“