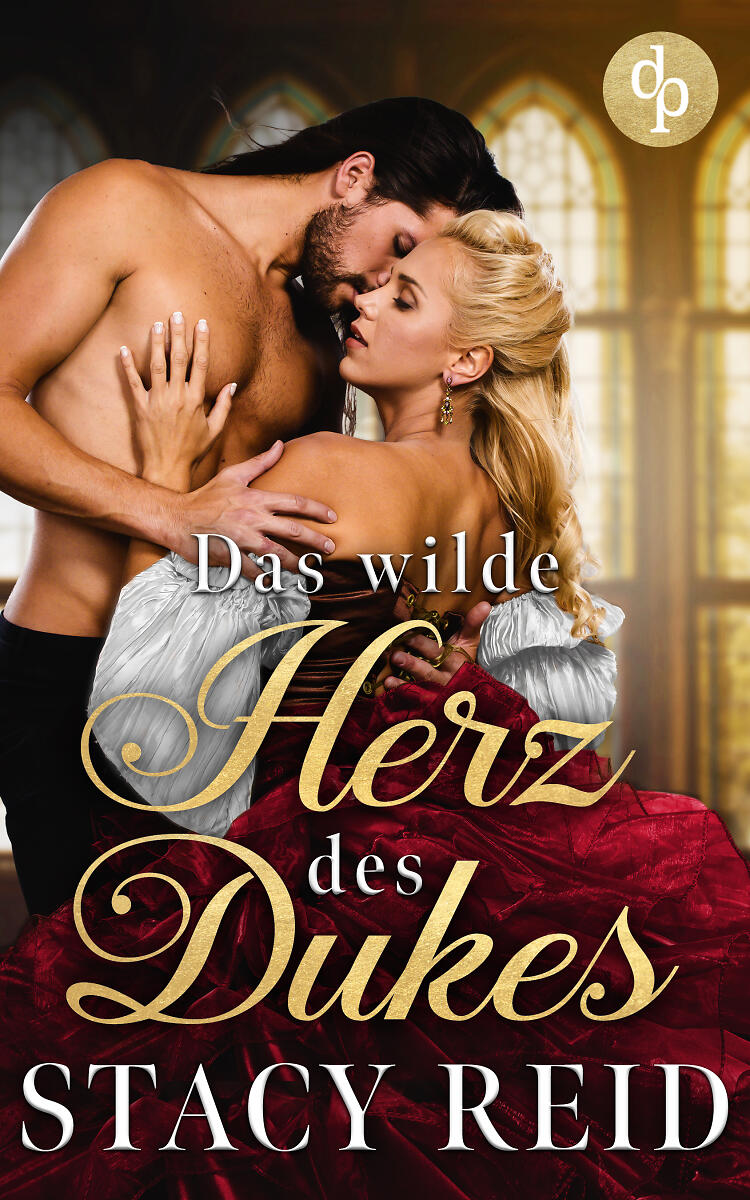Prolog
Sheffield, 1860
Im Schlafzimmer herrschte brütende Hitze. Der Schmerz peinigte Mrs. Miranda Southby noch unbarmherziger als bei den letzten Malen, die sie im Kindbett gelegen hatte. Noch schlimmer war jedoch die Verzweiflung in ihrem Herzen. Sie hatte lange und inbrünstig um ein gesundes Kind gebetet, doch auch dieses kam zu früh. Ein Schrei entrang sich ihrer Kehle, als der Schmerz sie durchfuhr und Panik sie überkam. Sie wand sich auf dem schweißgetränkten Bett und zerrte so heftig an den Laken unter sich, dass sie sie beinahe in Fetzen gerissen hätte. Sie hörte, wie ihr Mann nervös auf und ab ging. Er wartete natürlich, ob dieses Kind leben und – noch wichtiger – ein Junge sein würde. Sie hatten eine entzückende Tochter, die erst gestern ein Jahr alt geworden war, doch für ihren Mann spielte das keine Rolle. Er brauchte einen Sohn, der sein Erbe antreten würde. Die Sehnsucht danach war so stark, dass er die Anweisungen des Arztes nach Sarahs Geburt ignoriert hatte.
Ich rate Mrs. Southby dringend davon ab, noch ein Kind zu bekommen. Diese Geburt war schwer und sie hat viel Blut verloren. Ich fürchte, dass es beim nächsten Mal nicht gut ausgeht.
Ihr Mann hatte den Arzt wortlos angestarrt und dann andere Meinungen eingeholt. Schon nach wenigen Monaten hatte er wieder ihr Bett aufgesucht und seine ehelichen Rechte eingefordert. Miranda hatte protestiert und gesagt, dass sie sich noch nicht von ihrer letzten schweren Geburt erholt habe, doch er war verführerisch hartnäckig geblieben und sie konnte ihm ihre Pflichten nicht verweigern – sie liebte ihn zu sehr. Jetzt zerriss nicht nur der Schmerz ihren Körper, sondern auch panische Angst. Sie war erst sechsundzwanzig und würde vielleicht noch heute sterben. In ihr stieg Widerwillen gegen den Mann auf, den sie von ganzem Herzen liebte.
„Nur noch einmal pressen, Mrs. Southby“, murmelte die Hebamme und wischte ihr den Schweiß von der Stirn. „Ich sehe schon den Kopf!“
Miranda schöpfte Hoffnung. „Wirklich?“
Um die Augen der Hebamme bildeten sich Lachfältchen. „Ja, Ma’am. Nur noch einmal pressen, dann ist das Baby da.“
Miranda nickte matt und presste mit aller Kraft. Bitte, lass es diesmal einen Sohn sein.
„Kommen Sie, Ma’am, Sie müssen pressen, es ist noch nicht da!“
Miranda fing an zu weinen, doch selbst das kam nur als schwaches, klägliches Wimmern heraus. „Ich kann … nicht. Ich … ich bin so müde. Kann ich mich vielleicht ein paar Minuten ausruhen und wir machen dann weiter?“
Die Hebamme machte ein entschlossenes Gesicht. „Ich weiß, dass Sie müde sind, aber ich kenne auch Ihre Kraft. Das Baby braucht Sie, also bitte, pressen Sie!“
Miranda stützte die Ellbogen auf, holte tief Luft und presste. Es fühlte sich an, als würde sie etwas zerreißen, und sie kreischte.
Ein feuchter Lappen wurde ihr auf die Stirn gedrückt. „Sie sind eine starke Frau. Sie schaffen es, Ma’am!“
Mirandas ganzer Körper bebte, sie kniff die Augen zu und presste mit letzter Kraft. Mehr ging nicht. Ein heftiger Druck durchfuhr Mirandas Körper und dann war ihr, als würde sie durch die Luft schweben. Ein dünnes Wimmern ertönte. Freude überwältigte sie und sie versuchte, sich aufzurichten. Das Kind war am Leben und hatte auch gesunde Lungen. Sie fing an zu lachen und zu weinen und merkte kaum, dass die Nachgeburt herauskam und die Hebamme und ihre Gehilfin sie in aller Eile sauber machten.
„Ist es ein Junge?“, rief ihr Mann durch die Tür. Hoffnung und Aufregung schwangen in seiner Stimme mit. Sie spürte seine Ungeduld, doch er war ein ehrenwerter Herr und würde nicht einfach hereinplatzen.
„Es ist ein schönes, gesundes Kind“, sagte die Hebamme.
„Ich will ihn sehen“, sagte Miranda heiser. Sie weinte immer noch vor Freude und Erleichterung. „Geben Sie mir meinen Sohn!“
Ein fest verpacktes Bündel wurde ihr in die Arme gelegt.
„Oh, mein kleiner Schatz, wie schön du bist!“
„Ich habe einen Sohn!“
Miranda hob den Kopf mit einem Ruck, als sie den freudigen Ausruf hörte. Sie hatte nicht gemerkt, dass ihr Mann hereingekommen war. Charles eilte an ihr Bett und fiel auf die Knie. Sein schönes blondes Haar war zerzaust – ein Zeichen dafür, wie oft er sich mit den Fingern hindurchgefahren war. Sogar seine Brille saß schief auf seiner langen Nase. Seine Wimpern glänzten feucht, als er das Baby in ihren Armen sah.
„Wir haben einen Sohn“, sagte er rau und strich dem Baby über die Wange. Charles sah sie an und Liebe und Dankbarkeit sprach aus seinen dunkelgrünen Augen. „Ich werde ihn so viel lehren. Danke, meine Liebste, danke!“ Ihr Mann beugte sich vor und küsste sie zärtlich auf die Stirn.
Miranda schluchzte; die Erleichterung überwältigte sie. Gott sei Dank.
„Keine Kinder mehr“, flüsterte sie. „Wir haben zwei wunderbare Sprösslinge und ich glaube, sie werden uns mehr als genug Freude machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht noch mehr Kinder bekommen. Ich stehe das einfach nicht noch einmal durch, Charles.“
Er lehnte seine Stirn an ihre und schloss die Augen. „Es war dumm von mir, dich so unter Druck zu setzen, Liebling. Ich fühle mich schuldig. Verzeih mir.“ Charles hielt sie ein paar Sekunden fest in den Armen und sie fühlte sich beruhigt.
Ein paar Minuten später schloss die Tür sich leise hinter ihm. Sie hörte, wie er nach den Dienern rief, die Portwein holen sollten; heute Abend würde es ein großes Fest geben.
Miranda blickte auf und ihr Lächeln erstarb ebenso wie die Freude in ihrem Herzen. „Was ist los, Mrs. Garrick?“, fragte sie, als sie die ungewohnt düstere Miene der Hebamme sah. „Ist mit dem Kind alles in Ordnung? Ist er gesund?“
Die rundliche Hebamme kam näher. „Es war schon passiert, bevor ich etwas sagen konnte, Ma’am. Die Kleine hat geschrien, ich habe sie Ihnen in den Arm gelegt und Sie sagten, Sie hätten einen wunderschönen Sohn. Da ging die Tür auf und ich fürchtete …“
Miranda wurde das Herz schwer wie Blei. „Sie?“
Die Hebamme setzte sich auf den kleinen Stuhl an ihrem Bett. Ihre Miene war besorgt, die dunkelbraunen Augen voller Mitgefühl. „Das Kind ist ein Mädchen. Ein schönes gesundes Baby.“
Miranda brachte keinen Ton heraus. Sie schluckte den Kloß in ihrer Kehle hinunter und faltete mit zitternden Händen die Tücher auseinander, in die das Baby eingewickelt war. „Ein Mädchen“, flüsterte sie. „Er wird so enttäuscht sein.“ Miranda schaute die Hebamme durch einen Schleier aus unvergossenen Tränen an. „Er will es sicher wieder versuchen.“ Bald. „Ich kann das nicht ertragen.“
Mrs. Garrick seufzte tief. „Sie lagen zwei Tage in den Wehen, Mylady. Der ganze Haushalt dachte, Sie würden bald nicht mehr unter uns weilen, und hat mit bekümmerten Mienen Wache gehalten. Sie werden kein weiteres Kindbett überstehen, Ma’am. Ich könnte Abhilfemaßnahmen vorschlagen, aber die wirken vielleicht nicht lange.“
Ein Schluchzen kam aus Mirandas Kehle und sie hatte das Gefühl, dass ihr das Herz brach. „Ich stehe das wirklich nicht noch einmal durch. O Gott, was soll ich tun? Wie kann ich es meinem Mann erklären und ihn zur Vernunft bringen?“
Mrs. Garrick schwieg eine Weile. Dann seufzte sie – tief, aber entschieden. „So viel ich weiß, Ma’am, kümmern sich auch in ärmeren Schichten Männer nicht um ihre Kinder, so lange diese noch klein sind. Sie baden sie nicht und ziehen sie auch nicht an und aus. Nicht einmal von Ihnen wird man erwarten, dass Sie dieses Kind stillen. Es ist einfach nicht schicklich.“
Miranda war verwirrt. „Wie bitte?“
Die Hebamme reckte das Kinn. „Mr. Southby muss nicht erfahren, dass dieses Kind ein Mädchen ist. Niemand muss es erfahren. Meine älteste Tochter wird gern Ihre Amme sein. Wir würden das Geheimnis mit ins Grab nehmen.“
„Aber mein Mann … er wird es doch irgendwann merken“, sagte Miranda und wunderte sich, dass sie dieses verrückte Gespräch überhaupt führte. „Ich kann ihm nichts vormachen, schon gar nicht für immer.“
„Ja … nicht für immer“, sagte Mrs. Garrick milde. „Aber es wird Ihnen Zeit geben, sich zu erholen. Ich habe Sie in nur sieben Jahren fünf Mal betreut, Ma’am. Ihr Mann sagt, er liebe Sie, aber ein Sohn ist ihm wichtiger als Ihre Gesundheit.“
Miranda zuckte zusammen, als eine Wahrheit ausgesprochen wurde, von der sie schon lange wusste und deretwegen sie bitterlich geweint hatte. Ihr Mann war der zweite Sohn eines Viscount und sie hatten sich vor acht Jahren verliebt und Hals über Kopf geheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen; in Charles hatte sie einen Mann gefunden, den sie bewunderte und dem sie vertraute. Sie wusste, dass er sie liebte. Doch es machte ihr Kummer, dass sie seinen verzweifelten Wunsch nach einem Sohn nicht verstehen konnte. Er war ein zweitgeborener Sohn und würde wahrscheinlich keinen Titel erben, es sei denn, der Familie seines älteren Bruders würde eine schreckliche Tragödie widerfahren. Ihr Mann besaß ein großes Landhaus in Sheffield und hatte ein Einkommen von zweitausend Pfund im Jahr. Es war ein beachtliches Vermögen, von dem sie gut leben konnten, doch kein immenser Reichtum, für den man unbedingt einen Erben und einen Ersatzmann brauchte. Doch Charles bestand darauf, dass er einen Sohn brauchte, der beruflich in seine Fußstapfen treten würde.
Das Baby regte sich in ihren Armen. Miranda schaute auf das kleine, runzlige rosa Gesicht hinunter und eine große Zärtlichkeit stieg in ihrem Herzen auf.
„Ich liebe dich schon so sehr“, flüsterte sie. „So sehr.“
„Verzeihen Sie mir meine Kühnheit, Mylady, aber es gibt keinen Grund, warum Mr. Southby dieses Kind jemals nackt sehen sollte. Dank Ihrer Position wird sich ein Kindermädchen um das Kind kümmern und meine Tochter wird Stillschweigen wahren, solange Sie wollen. Geben Sie der Kleinen einen Jungennamen, frisieren Sie sie wie einen Jungen und am wichtigsten, behandeln Sie sie in jeder Hinsicht wie einen Sohn. Und dann hoffen und beten Sie, dass Sie, wenn Sie Mr. Southby irgendwann die Wahrheit sagen, stark genug sein werden, den Sturm der Entrüstung verkraften – und vielleicht auch ein weiteres Kindbett.“
Miranda schüttelte ablehnend den Kopf. „So eine Täuschung würde meine Familie ruinieren. Es würde einen riesigen Skandal geben, wenn es herauskäme. Der Bruder meines Mannes ist ein Viscount und unsere Familie gehört zur Oberschicht. Unser Ruf wäre auf ewig ruiniert. Ich … ich würde die Liebe und das Vertrauen meines Mannes verlieren.“
„Die Täuschung ist nötig, um Ihr Leben zu retten. Es sei denn, Sie glauben, dass Mr. Southby Ihr Bett meiden wird.“
Miranda schoss die Röte in die Wangen. Das würde er nicht tun. Ihr Mann teilte ihr Bett nicht nur, damit sie schwanger wurde. Sie empfanden eine Leidenschaft füreinander, die bei der leisesten Berührung aufflammte. Sie konnte versuchen, ihn mit dem Argument von sich fernzuhalten, dass sie sich noch nicht völlig erholt hatte, aber es hatte sich ja gezeigt, dass sein Wunsch nach einem Sohn stärker war als sein gesunder Menschenverstand.
„Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, zu verhindern … dass ich schwanger werde?“
Die Hebamme schnitt eine Grimasse. „Solche Methoden sind nicht geeignet für eine Dame und ich fürchte, er würde dahinterkommen. Manche sind eine echte Strapaze für den Körper und Sie sind sehr schwach, Ma’am. Ich glaube, dass Sie mindestens fünf Jahre Pause vom Kindbett brauchen. Vielleicht können Sie Ihrem Mann dann die Wahrheit sagen und hoffen, dass er Ihnen verzeiht. Vielleicht liebt er Sie so sehr, dass er Sie nicht verprügelt oder vor die Tür setzt.“ Die Hebamme stand auf und fing an, das Zimmer in Ordnung zu bringen.
Miranda starrte auf ihr Kind hinunter. Konnte sie ihrem Mann so eine schreckliche Lüge auftischen? Er war dabei, sich als Psychologe einen Namen zu machen. Sie war selbst die Tochter eines Viscounts, aber seit ihrem Debüt vor ein paar Jahren nur wenig unter Menschen gewesen. Wie sollte das Geheimnis je herauskommen, wenn es sorgfältig gehütet wird? Miranda schloss die Augen und Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie hatte sich damals auf dem Ball auf den ersten Blick in ihn verliebt und das Gefühl war nie ins Wanken geraten. Wie hatte sie gebetet, ihm endlich einen Sohn schenken zu können. Doch jetzt spürte sie, wie schwach sie war, und bei dem Gedanken, dass Charles bald nach dieser Tortur wieder zu ihr ins Bett kommen würde, wurde ihr übel. Miranda hatte keine Freude an Schwangerschaften, geschweige denn an Geburten. Das endlose Erbrechen, Schmerzen in den Füßen und im Rücken, der Schwindel … und der herzzerreißende Schmerz, das Kind zu verlieren, bevor es bereit war, auf die Welt zu kommen. Doch nun, da sie eine Tochter hatten … und einen Sohn, war ihre wunderbare Familie vollständig. Charles würde ihr gern ein paar Monate Ruhe gönnen, und wenn sie einen Sohn hätten, würde Charles ihren Wunsch nach Verhütung respektieren. Doch wenn kein Sohn da war, würde er wollen, dass sie wieder schwanger wurde.
Miranda war auf einmal fest entschlossen. Sie nahm das Kind auf den Arm und küsste es auf die Stirn. „Willkommen auf dieser Welt, mein geliebter Jules.“ Miranda betete, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.
1. Kapitel
23 Jahre später … England, Derbyshire.
The Daily Scandal, 18. April 1884
Vor zehn Jahren haben der Duke und die Duchess of Wulverton auf tragische Weise ihren Sohn, den kleinen Lord James, und ihre kleine Lady Felicity auf See verloren. Jetzt summt es in London wie in einem Bienenstock, seit sich herumgesprochen hat, dass eine Gruppe Archäologen in einem Dschungel nahe der Grenze zum Kongo zwei Personen, auf die die Beschreibung von Lord James und Lady Felicity zutrifft, gefunden hat. Es heißt, sie seien nicht mehr als menschliche Wesen erkennbar, sondern eher wilde Tiere, nachdem sie so viele Jahre inmitten aller möglichen Geschöpfe verbracht haben und keinen Kontakt zu Menschen hatten!
Jules Southby ließ die Zeitung sinken und gab ein ärgerliches Schnauben von sich. Das war schon der dritte Bericht, den sie über eine sensationelle Entdeckung las, und wieder waren die Fakten verdreht. Sie nahm sich eine andere Zeitung und fand die Stelle mit dem Klatsch, der die ganze Gesellschaft und angeblich sogar die Königin in Atem hielt.
The Morning Chronicle, 18. April 1884
Endlich gute Nachrichten! Der Herzog wurde gefunden! Nachdem er zehn Jahre vermisst war, gibt es nun glaubwürdige Berichte, dass Lord James, der neue Duke of Wulverton, am Norton-Sund des Beringmeers gefunden wurde. Angeblich wurde er in einer Höhle entdeckt, war mit Tierfellen bekleidet und kaum als Mensch zu erkennen. Viele – vor allem medizinisch und wissenschaftlich bewanderte – Zeitgenossen erinnern sich an die unglaubliche Entdeckung von Wolfskindern in der norwegischen Wildnis und ihren tragischen Tod. Niemand hätte gedacht, dass ein solches Unglück einer unserer vornehmsten Familien widerfahren könnte.
Jules seufzte. Die Geschichten wurden immer fantastischer. Erst gestern, als sie von Manchester in die Stadt gefahren war, hatten die Reisenden im Zug kein anderes Gesprächsthema gehabt als den verschwundenen Herzog und das Gerücht, er sei verrückt geworden.
„Ich habe alle Zeitungen und Skandalblätter gelesen gelesen. In allen steht etwas anderes über den Herzog und seine Familie – falls der Gefundene wirklich der Duke of Wulverton ist. Sie sollten sich schämen, die Massen mit Gerüchten zu füttern, statt die Wahrheit zu schreiben.“
Jules’ Mutter, Mrs. Miranda Southby, die das Gespräch ihres Mannes gewissenhaft belauscht hatte, richtete sich auf und glättete ihre rotblonde Frisur.
„Deine Haare sind nicht in Unordnung geraten, als du an der Tür gehorcht hast“, sagte Jules grinsend. „Mama, du bist unmöglich. Vater führt ein privates Gespräch. Du solltest nicht lauschen.“
„Und du hast dich während deiner Zeit im Ausland kein bisschen verändert“, sagte ihre Mutter mit einem Hauch Bissigkeit und errötete bis unter die Haarwurzeln. „Ich bin furchtbar neugierig darauf, wer deinen Vater in solcher Heimlichkeit besucht. Die Dame trägt einen Schleier und das Wappen auf ihrer Kutsche ist mit einem schwarzen Tuch verhangen. Willst du gar nicht wissen, was los ist?“
Jules warf einen Blick auf die Zeitungen und Skandalblätter, die auf dem Rokoko-Tisch lagen. Sie konnte leicht erschließen, wer ihren Vater, den berühmten Psychologen, besuchte.
„Ich denke, es ist die Herzogin.“
Ihre Mutter machte große Augen. „Wie bitte?“
„Eine Herzogin, Mama“, wiederholte Jules geduldig.
„Eine Herzogin ist in meinem Haus und ich weiß nichts davon? Was für eine Herzogin?“
Jules hielt eine der Zeitungen hoch. „Ihre Gnaden, die Duchess of Wulverton. Vielleicht irre ich mich, aber ich habe den starken Verdacht, dass die Herzogin bei Vater ist, falls an all den Gerüchten etwas dran ist.“
„Das kann nicht dein Ernst sein!“
Jules rümpfte die Nase. „Doch.“ Sie wollte es gern glauben, aber die Berichte waren alle zu … fantastisch und klangen wie aus einem Märchenbuch. Der Herzog und vielleicht auch seine Schwester, die seit über zehn Jahren – seit das Schiff ihrer Eltern untergegangen war – vermisst waren, sollten noch am Leben sein? Und selbst wenn sie in den schneebedeckten Bergen von Kanada verloren gegangen waren, wie konnten sie dann noch leben? Wie? Ihre Neugier war geweckt, denn die Auswirkungen auf ihren Geist und ihre Persönlichkeit würden gewaltig sein. Waren sie wirklich wilde Tiere? Konnten sie wieder in die Gesellschaft integriert werden? Wie alt waren sie wirklich gewesen, als sie verschwunden waren?
„Kennst du die Geschichte, Mama?“
Ihre Mutter sah aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. „Ich habe davon gehört, aber ich habe nie viel Notiz von den Zeitungsartikeln über den verschwundenen Herzog genommen. An jedem Jahrestag der Tragödie wird in den Londoner Zeitungen eine Belohnung für Neuigkeit über den Verbleib des jungen Herzogs ausgesetzt. Sogar die Lokalzeitung hier in Derbyshire schreibt etwas dazu. Ruf Helga. Wir müssen sofort Tee und Kuchen servieren.“
„Mama“, sagte Jules milde und stand auf. „Ich denke, wir sollten abwarten, bis Vaters Sprechstunde zu Ende ist. Stören wir sie nicht mit Tee und Kuchen.“
„Pst!“ Ihre Mutter fuhr herum, bückte sich und linste wieder durchs Schlüsselloch. „Es wäre eine unglaubliche Ehre für unsere Familie, wenn sich herumspricht, dass die Herzogin unser bescheidenes Herrenhaus besucht hat. Dein Onkel würde es sehr schätzen.“
Jules sagte nichts dazu, denn ihr Onkel, Albert Southby, Viscount Ramsey, machte sich wirklich viele Gedanken über den Status seiner Familie und die Beziehungen zur Oberschicht. „Ja, das würde er wirklich“, murmelte sie dann doch trocken.
Ihre Mutter warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. „Wir hatten noch nie so einen wichtigen Gast! Bist du gar nicht neugierig, mein Kind?“
„Doch, aber dies ist kein Höflichkeitsbesuch, Mama.“ Jules verschränkte die Arme vor ihren abgebundenen Brüsten und lehnte ihre schmale Hüfte an den großen Schreibtisch aus Eichenholz. „Schlüssellochguckerei ist nicht gut.“
Ihre Mutter richtete sich auf und lächelte verlegen. „Wäre es nicht ein riesiger Glücksfall, wenn Ihre Gnaden deinen Vater engagiert, jetzt, da du gerade von der Universität gekommen bist? Es wäre eine einmalige Gelegenheit, deinem Vater zu beweisen, dass du in seine Fußstapfen treten und an seiner Seite arbeiten kannst. Du weißt ja, dass das schon lange sein Traum ist.“
Jules lächelte und fuhr sich durch ihr kurz geschnittenes rotblondes Haar. Sie hatte die letzten vier Jahre in Österreich verbracht und dort sowie an der Universität Leipzig in Deutschland Psychologie studiert. Sie hatte ihren Abschluss mit Auszeichnung gemacht. Dort hatte sie dank der Freundschaften, die sie mit Professoren und Kommilitonen geschlossen hatte, gelernt, die Lüge zu akzeptieren, auf die ihr Leben aufgebaut war, auch wenn sie sie nicht ganz verstand. Vier Jahre war sie England ferngeblieben und hatte voller Bitterkeit erkannt, dass sie – wenn sie sich nicht weiter als Mann ausgab – keine solchen Freiheiten mehr haben würde. Jules hatte sich bei ihrer Heimkehr geschworen, das Lügengerüst einzureißen, das um ihr ganzes Dasein errichtet worden war. Sie war bereit gewesen, den Schmerz und den Schaden in Kauf zu nehmen, den ihre Familie erleiden würde, und hatte sich darauf gefasst gemacht, die ganze Verantwortung zu tragen. Aber … jetzt war sie hier und erinnerte sich an die Bitten und Tränen ihrer Mutter, als Jules das letzte Mal geplant hatte, ihrem Vater alles zu offenbaren. Es lastete schwer auf ihren Schultern. Konnte sie ihrer Familie, die ansonsten glücklich war, solchen Kummer machen? Schlimmer noch – wenn Jules ihrem Vater alles erzählte, riskierte sie den Verlust des freien Lebens, das sie dreiundzwanzig Jahre lang geführt hatte. Wie würde er reagieren? Würde er ihr helfen, die Täuschung aufrecht zu erhalten?
Ihre Mutter wedelte graziös mit der Hand vor Jules’ Gesicht. „Mein Kind, hör auf zu träumen und antworte mir. Ich hasse diese Gewohnheit – du hast das von deinem Vater. Ins Leere zu starren, als ob ihr allein wäret! Findest du nicht, dass es eine wunderbare Gelegenheit wäre?“
„Du weißt doch, dass ich davon träume, mit Vater zu arbeiten, Mama“, sagte Jules sanft und starrte ihre Mutter an, die ein misstrauisches Gesicht machte. „Ich bin nur nicht sicher, ob er wollte, dass ich seine Arbeit weiterführe, wenn …“
Angst flackerte in den Augen ihrer Mutter auf und sie hob die Hand. „Jules, bitte … du darfst nicht …“ Sie atmete tief durch und strich ihr Kleid glatt. „Warum willst du, dass dein Vater die Wahrheit erfährt? Es ist doch bisher alles gut gegangen. Und bist du nicht glücklich?“
„Mich beschäftigt die Frage, ob Vater mich noch genauso lieben würde … ob er noch so stolz auf mich wäre und noch die gleichen Hoffnungen in mich setzen würde, wenn er wüsste, dass ich weiblichen Geschlechts bin, Mama“, sagte sie leise. „Würde er verstehen, dass ich noch der gleiche Mensch bin, auch wenn ich ein Kleid trage?“
Ihre Mutter wurde blass und bei dem Kummer in ihren Augen hatte Jules wieder diesen schrecklichen Kloß im Hals. „Wie geht es Sarah, Mama? Ich habe seit ihrer Hochzeit nichts mehr mit ihr gesprochen. In ihrem letzten Brief vor ein paar Monaten hat meine Schwester geschrieben, dass sie unsterblich in Viscount Halliwell verliebt sei und sich gut in die Rolle als neue Viscountess eingelebt hat.“
Unsterblich verliebt … das war für Jules unvorstellbar.
Ihre Mutter war sichtlich erleichtert über den Themenwechsel. Doch bevor sie antworten konnte, ging die Tür auf und Jules’ Vater erschien. Seine Miene war ruhig, doch seine dunkelgrünen Augen, die denen von Jules so sehr ähnelten, funkelten vor Eifer und Aufregung. „Jules, kommst du bitte für einen Moment in mein Arbeitszimmer? Ich möchte dir einen wichtigen Gast vorstellen.“
Seine Frau warf ihm einen erwartungsvollen Blick zu. Sie wollte wissen, was los war. Vater blinzelte ihr zu. Mama schmollte, lächelte dann jedoch aufmunternd und verließ den Salon.
Ihr Vater trat beiseite und winkte Jules herein.
Jules fasste sich instinktiv an den Schnurrbart, den sie trug. Sie zog ihre Krawatte zurecht, straffte die Schultern und trat ein. Sie sah sofort die Respekt einflößende Frau auf dem Stuhl, der eigentlich der ihres Vaters war. Neben ihr stand noch ein Herr. Die Frau war weder alt noch jung. Ihre Schönheit und kalte Steifheit hatten etwas Zeitloses. Sie war faszinierend mit ihrem dichten schwarzen Haar, das noch keine grauen Strähnen aufwies. Ihre Haut war immer noch rosig, die blauen Augen funkelten lebhaft.
„Euer Gnaden, Mr. Williams, gestatten Sie mir, Ihnen meinen Sohn vorzustellen – Mr. Jules Southby. Er ist gerade aus Österreich zurück, wo er seinen Abschluss in Psychologie gemacht hat. Mit Auszeichnung“, sagte ihr Vater stolz. „Er spricht auch fließend Französisch, Deutsch, Russisch und Latein.“
Jules machte eine elegante Verbeugung. „Es ist mir ein Vergnügen, Euer Gnaden.“ Sie richtete sich wieder auf und sah den Herrn an. „Mr. Williams, sehr erfreut.“
„Mr. Southby“, murmelte Mr. Williams. Sein aufmerksamer Blick fiel auf ihr Gesicht und verharrte dort einen Moment länger, als schicklich war. Er konnte nicht verhindern, dass seine Augen sich weiteten.
Jules war daran gewöhnt, ebenso wie daran, dass die Leute oft Bemerkungen über ihre helle Haut und ihre Gestalt machten, die so zierlich für einen „Herrn“ war. Sogar auf der Universität hatten ihn ein paar Leute damit aufgezogen, dass er ein „hübscher Junge“ sei.
Sie fasste sich unauffällig an die Oberlippe, um sicherzugehen, dass ihr angeklebter Schnurrbart noch richtig saß. Das Make-up, das ihrem Gesicht einen strengeren Ausdruck gab, war vollkommen und sie hatte sich im Laufe der Jahre angewöhnt, mit tiefer Stimme zu sprechen. Alles war so, wie es sein sollte, und sie sagte: „Danke, dass Sie mich an diesem Treffen teilnehmen lassen, Euer Gnaden.“
Nach den höflichen Floskeln herrschte ein Moment Stille.
„Was nützt es mir, dass ich diesen jungen Grünschnabel treffe?“, fragte die Herzogin. Es klang ungeduldig und sie spießte Jules förmlich mit Blicken auf. „Dr. Southby, Sie wurden mir von Sir James Reid empfohlen und ich bin hergekommen, aber ich weiß immer noch nicht, wie Ihre neumodischen Ideen meiner Familie helfen sollen.“
Aus den Worten der Herzogin sprachen Skepsis und Verachtung. Jules war nicht gekränkt, denn sie erlebte es oft, dass Leute seelische Krankheiten einfach abtaten. Das war einer der Gründe, weshalb sie in Österreich studiert hatte, denn dort wurde ihre Leidenschaft ernster genommen. In England verstanden nicht alle, warum man Geisteskrankheiten erforschen wollte oder dass es jemandem helfen konnte, der darunter litt.
„Die Erforschung des Geistes ist nichts Neumodisches, Euer Gnaden“, sagte Jules höflich und setzte sich auf das Sofa, das am nächsten bei der Herzogin stand. „Schon die alten Griechen haben sich damit befasst.“ Jules machte eine Handbewegung zu ihrem Vater. „Mein Vater ist einer der besten Psychologen in ganz England. Sie waren sicher bei ihm, weil Sie sich Sorgen um Ihren Sohn und Ihre Tochter machen … und es wichtig, dass Sie alles tun, um den beiden zu helfen, auch wenn Sie selbst nicht an die Methoden glauben.“
Die Herzogin starrte Jules lange an und stieß dann einen zittrigen Atemzug aus. „Ihr Vater wurde mir von Dr. Grant empfohlen – dem Leiter des … des Institutes in Reading für Menschen mit ungesunder … Denkweise.“ Ihre Lippen zitterten und Jules sah die Angst in den Augen der Herzogin.
„Fürchten Sie, dass … dass Ihre Kinder an Geisteskrankheiten leiden, Euer Gnaden?“
Die Herzogin atmete tief durch. „Mein Sohn … nur mein Sohn.“
Jules lächelte milde. „Verzeihen Sie mir, Euer Gnaden.“
„Vor Kurzem hat eine Gruppe von Fallenstellern jemanden … einen Mann in der Wildnis von Alaska gefunden. Oder er hat sie gefunden. Dieser Mann stand vor genau vier Wochen bei mir vor der Tür. Ich weiß, dass er mein Sohn ist – keiner dieser Betrüger, die im Laufe der Jahre aufgetaucht sind und behauptet haben, der Herzog zu sein, weil sie Geld wollten. Er … er ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.“ Die Herzogin verstummte und Jules und ihr Vater warteten geduldig darauf, dass sie sich wieder fing. Sie warf Jules’ Vater einen bittenden Blick zu.
Er fragte: „Hat dieser Mann Sie erkannt?“
„Ja. Ich habe es in seinen Augen gesehen, aber er hat mich nicht umarmt – und auch sonst keinerlei Erleichterung oder Freude darüber gezeigt, dass er wieder bei mir … und bei seiner Familie ist.“
Jules rutschte auf dem Sofa hin und her. „Wie nennt er Sie?“
Die Schultern der Herzogin versteiften sich. „‚Euer Gnaden‘ … seit seiner Rückkehr nur ‚Euer Gnaden‘ oder ‚Herzogin‘. Die Zeitungen sind voll von Geschichten über seine Rückkehr. Die Königin hat ihren Leibarzt nach Hertfordshire geschickt und mein Sohn, er … er ist so abweisend zu Sir James Reid, der natürlich viele Fragen hat. Wie soll er der Königin Bericht erstatten?“
„Hoffen Sie, dass der Herzog uns gegenüber offener sein und seine Erfahrungen schildern wird?“, fragte Jules’ Vater. „Oder fürchten Sie, dass sein … Verstand gelitten hat?“
Die Herzogin fuhr zusammen. „Ich sehe keinen Grund, warum er mit Fremden reden sollte statt mit seiner Familie. Ich bin seine Mutter … und ich … ich habe ihn so vermisst, dass es mir das Herz brach. Jeden Tag.“ Und da war es – das Schuldbewusstsein in ihrer Stimme und ihrem Blick. Schuld war eine schreckliche Last und die Herzogin trug offenbar schwer daran. „Mein Sohn ist nicht mehr derselbe … und darum … darum brauche ich Ihre Hilfe, Dr. Southby. Wie soll er die Rolle übernehmen, zu der er verpflichtet ist, wenn er als exzentrisch und verrückt gilt? Mein Sohn hat sehr sonderbare Angewohnheiten, die in unseren Kreisen nicht akzeptabel sind. Er ist der Duke of Wulverton. Er ist die Gesellschaft.“
Jules’ fand das etwas arrogant, doch die Herzogin hatte nicht unrecht.
„Jetzt, da mein Sohn gefunden wurde, muss er der Königin und der Gesellschaft vorgestellt werden – als Mann, der geistig und körperlich gesund ist. In nur drei Wochen findet der erste Ball statt, den ich in dieser Saison gebe; dort wird er den Vertreter der Königin treffen und schließlich die Königin auf Schloss Windsor besuchen. Es darf keinen Zweifel geben, dass er geistig gesund ist. Keinen!“
Drei Wochen? Die panische Angst in der Stimme der Herzogin traf Jules mitten ins Herz. Sie verstand diese Angst. Die Königin hatte die Macht, den Herzog in ein Irrenhaus zu verbannen, wenn sie den Eindruck hatte, dass er eine Gefahr für sich oder andere war. Oder wenn ihr Vater ihn für geisteskrank erklärte. Noch bedrohlicher war jedoch, dass die Königin auch das Recht hatte, dem Herzog sein Erbrecht abzuerkennen, wenn sie ihn für psychisch instabil hielt. Es gab nicht viele private Kliniken für Geisteskranke und erst vor Kurzem war ein Baron auf Anordnung der Queen in das Bethlehem Hospital for the Insane in Moorfields eingewiesen worden. Es war Monate her, doch der Skandal bot immer noch Gesprächsstoff in den Salons der Gesellschaft. War dem Herzog klar, dass ihm so etwas widerfahren konnte? Oder glaubte nur die Herzogin, dass ihr Sohn nicht in die gegenwärtige Gesellschaft passte?
„Mein Vater kann ihm helfen“, versicherte Jules der Herzogin. „Viele betrachten ihn als brillanten Psychologen, Euer Gnaden.“
Die Herzogin starrte Jules’ Vater an. Hoffnungen und Ängste sprachen aus ihrem Blick.
„Ich setze meine ganze Hoffnung auf Sie, Dr. Southby. Ich habe nur ein paar Wochen, um meinen Sohn darauf vorzubereiten, der Welt zu beweisen, dass er der Duke of Wulverton ist. Aber das Ziel scheint mir unerreichbar und ich bin ganz verzweifelt.“
Ihr Vater ging auf sie zu. „Euer Gnaden, wenn Sie einverstanden sind, möchte ich, dass mein Sohn mitkommt, um den Herzog zu treffen und bleibt, bis ich meine Untersuchungen abgeschlossen habe.“
Ein freudiger Schreck durchzuckte Jules und sie bemühte sich, gelassen zu wirken. Es wäre ein Privileg und eine Ehre, mit ihrem Vater zusammenzuarbeiten. Er war einer der bekanntesten und anerkanntesten Psychologen in Großbritannien, auch wenn die Gesellschaft sich immer noch schwertat, Psychologie als Wissenschaft anzuerkennen, die Menschen half. Sie war froh, dass er sie an dieser wichtigen Aufgabe beteiligen wollte.
„Vater?“ Jules musste sich räuspern. Er hätte jeden seiner renommierten Kollegen mitnehmen konnten, aber er wollte sie an seiner Seite haben. Nein, nicht mich – seinen Sohn. Jules versuchte, ihre Angst abzuschütteln, dass ihr Vater – wenn er wüsste, dass sein einziger Sohn eine junge Dame war – bitter enttäuscht sein und sie nicht mehr so lieben und achten würde, wie er es tat. Jules hatte nächtelang wach gelegen und sich das Hirn zermartert, ob sie offen mit ihrem Vater reden sollte und wie er reagieren würde. Mit Scham und Wut, dass sein Jules weiblichen Geschlechts war und seine Frau ihn dreiundzwanzig Jahre getäuscht hatte? Mit Schmerz und Abscheu, dass seine Tochter bei der Täuschung mitgemacht hatte, seit sie alt genug war, um alles zu begreifen? Würde ihre Familie daran zerbrechen, wie ihre Mutter fürchtete? Oder würde ihr Vater es gelassen hinnehmen? Hatte er schon lange erkannt, dass sein Sohn eine Tochter war, und geschwiegen, um den Ruf der Familie zu wahren? Wenn alles herauskommen sollte, würde ihr Vater erwarten, dass Jules die einzige Identität aufgab, die sie kannte, und die Rolle annahm, die ihre älteste Schwester mit solchem Stolz spielte, die Jules aber fremd war? Sie musste sich sehr zusammennehmen, um diese Gedanken abzuschütteln und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt wichtig war.
Die Herzogin richtete einen forschenden Blick auf Jules. „Ihr Sohn ist noch sehr jung und offenbar noch nicht trocken hinter den Ohren. Ich glaube nicht, dass er eine große Hilfe wäre.“
Jules stöhnte unhörbar und sah die Gelegenheit entschwinden.
„Euer Gnaden, mein Sohn war ein ausgezeichneter Student und viele seiner Professoren haben mir geschrieben, seine Leistungen seien nahezu unglaublich“, sagte ihr Vater ernst. „Er muss nicht selbst mit dem Herzog zu tun haben, wenn Sie es nicht wünschen, doch mein Sohn wird mich unterstützen, indem er sich Notizen macht und mir Denkanstöße gibt.“
Die Herzogin starrte Jules an. Jules erwiderte den Blick, ohne mit der Wimper zu zucken, und hätte am liebsten gebettelt, dabei sein zu dürfen. Lass dich nicht hinreißen, sagte sie sich energisch, und zwang sich, sich den Herzog als Menschen vorzustellen und nicht als interessantes Studienobjekt.
„Euer Gnaden“, sagte Jules milde. „Wollen Sie uns mehr über Seine Gnaden erzählen? Wie heißt er?“
Die Miene der Herzogin wurde etwas sanfter. „Mein Sohn … er heißt James Leopold Winters und ist Duke of Wulverton und Earl of Lydon. Dieses schreckliche Erlebnis hat ihn sehr verändert“, sagte sie. Ihre Lippen zitterten, dann kniff sie sie zusammen. Die Herzogin stand auf, ging zum Kamin und hielt die Hände vor die zuckenden Flammen. „Ich will … ich will den sanften Jungen wiederhaben, der die gebrochenen Flügel von Vögeln verarztet hat, der mit mir Klavier gespielt und wunderschön gesungen hat. Ich will meinen Sohn zurück, der sich umarmen und küssen ließ, auch als er einen Kopf größer war als ich. Er lässt sich von niemandem mehr anfassen. Ich …“ Die Herzogin ließ die Hände sinken und schaute Jules und deren Vater an. „Mein Sohn ist nicht mehr er selbst. Er soll wieder so werden, wie er war.“
„In der Zeitung steht, er sei auf See verschwunden und mehrere Jahre vermisst gewesen?“
Die dunkelblauen Augen der Herzogin schauten in die Ferne. „Das ist ganz falsch. Mein Sohn war fast achtzehn, als er in der kanadischen Wildnis im Yukon verloren ging. Zehn Jahre und vier Monate hat er in der Einsamkeit des Mount Logan ohne Kontakt zu anderen Menschen gehaust.“ Sie schluckte schwer. „Zehn Jahre. Wir wussten, dass er dort war … Alle Experten, die wir angeheuert haben, um ihn zu finden, sagten, es wäre möglich, dass er überlebt hat. Mein Mann … bevor er starb, haben wir Dutzende Experten angeworben, um die Gegend abzusuchen, doch alle kamen unverrichteter Dinge zurück. Und ich versichere Ihnen, viele haben es versucht, weil wir Tausende von Pfund für James’ Rückkehr boten. Sogar für eine Leiche, denn dann hätten wir ihn wenigstens so beerdigen können, wie es dem Erben eines Herzogtums zusteht.“ Die Herzogin ging mit aufgeregten Schritten zu den Fenstern, von denen aus man auf den Garten des Stadthauses blickte. „Mount Logan ist der größte und höchste Berg in Kanada und dort herrscht ein subarktisches Klima. Haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet, Mr. Southby?“
Jules wählte ihre Worte mit Bedacht, obwohl ihr Herz raste und ihr alle möglichen Fragen durch den Kopf schossen. „Ja. Er … Ihr Sohn hat an einem Flecken Erde gelebt, an dem lange kalte Winter herrschen und es nur sehr kurz warm ist. Um dort zu überleben …“ Jules konnte es sich nicht ausmalen. Umgeben von endlosen Meilen mit Bäumen, Hügeln, schneebedeckten Bergen und bitterer Kälte. Seine kargen Mahlzeiten musste man auf der Jagd erbeuten. Wie hatte ein damals achtzehnjähriger Junge das überlebt? Noch dazu jahrelang? „Dafür braucht man unglaubliche Widerstandskraft.“ Und Glück. „Ihr Sohn muss sehr tapfer sein.“
Die Herzogin sah überrascht aus. „Das hört sich an, als würden Sie den Herzog bewundern, Mr. Southby, ohne ihm begegnet zu sein.“
„Das tue ich, Euer Gnaden.“ Sie dachte an den Ausdruck „Das Überleben des Stärkeren“, den der Psychologe Herbert Spence in seinem Buch Principles of Biology geprägt hatte. Sie hatte das Werk immer wieder verschlungen und jetzt kamen ihr die Theorien darüber in den Sinn, warum manche die schlimmsten Widrigkeiten überstehen und andere scheitern. Sie wollte den Herzog sehen … sofort. Gott, die Aufregung war geradezu unwirklich.
„Als … als die Fallensteller meinen Jungen fanden … hatte er eine Waffe dabei, eine Art Dolch aus den Knochen der wilden Tiere, mit denen er gekämpft hatte. Wölfe … Bären …“ Die Herzogin faltete ihre behandschuhten Hände. „Er hat diese Waffe immer noch. Bei uns zu Hause.“
Jules hörte die Besorgnis in ihrer Stimme. „Die Waffe war sein Schutz in der eisigen Wildnis – vielleicht ist es ihm eine Beruhigung, sie jetzt bei sich zu haben.“
„Bei uns zu Hause?“, wiederholte die Herzogin. Es klang ungläubig. „Dort besteht doch keine Gefahr. Dort sind nur Leute, die ihn lieben und ihn willkommen heißen wollen. Aber er will sie nicht sehen und mit niemandem etwas zu tun haben.“
Jules wählte ihre Worte mit Bedacht. „Die Herren in unserer Gesellschaft tragen doch alle Waffen, Euer Gnaden. Die meisten Herren haben ein Schwert in ihrem Gehstock, einige sogar Dolche in den Stiefeln. Ich habe manchmal auch ein Messer in meinem Gehstock. An einigen Orten in Amerika tragen Männer offen Pistolen in einem Halfter bei sich und beim kleinsten Anlass kommt es auf offener Straße zu Schießereien. Dass der Herzog seine Waffe aus Knochen behalten will, der er sein Überleben in der Wildnis verdankt, ist normal und kein Grund zur Sorge.“
Die Augen der Herzogin weiteten sich und Jules bekam einen anerkennenden Blick von ihrem Vater. „So … so habe ich das noch nicht gesehen.“ Ihre Gnaden runzelte die Stirn. „Es bietet einen furchterregenden Anblick. Ich habe ihn gebeten, es wegzuwerfen, aber … das will er nicht.“
„Sagt er, warum?“, fragte Jules’ Vater und griff nach seinem Notizbuch. Er setzte sich in einen Sessel und schaute die Herzogin über seine Brille hinweg an, die er auf seiner knochigen Nase trug.
„Der Herzog sagt überhaupt nichts. Und das ist einer der vielen Gründe, warum ich einen Fachmann Ihres Gebiets brauche.“
Jules’ Vater runzelte die Stirn. „Soll er selbst entscheiden?“
Sie griff sich ans Herz. Die Bewegung wirkte zerbrechlich, beinahe ätherisch, doch Jules hatte den Eindruck, dass die Herzogin ein Rückgrat aus Stahl hatte. „Ich habe es vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Der Herzog spricht kaum. Meistens grunzt er nur als Bestätigung und sonst starrt er schweigend vor sich hin. Ich habe noch keinen ganzen Satz aus seinem Mund gehört. Es ist, als … als finde er seine Umwelt anstrengend. Er …“ Die Herzogin atmete tief durch. „Ich kann nicht annähernd beschreiben, wie sich mein Junge verändert hat.“
„Versuchen Sie es“, hauchte Jules. Sie konnte nicht an sich halten. „Bitte, Euer Gnaden. Wenn es Ihnen nicht zu schwer fällt.“
„Mein Sohn war in seiner Jugend sehr schlank. Jetzt ist seine Gestalt nicht mehr die eines Herrn, sondern eher die eines … eines gewöhnlichen Hafenarbeiters. Geradezu einschüchternd.“ Die Herzogin entfernte sich vom Fenster und ging wieder aufgeregt auf und ab.
Jules sah jemanden vor sich, der kräftige Muskeln hatte … überall. Völlig unerwartet tauchte vor ihrem inneren Auge ein nackter Mann auf – mit Schultern, Rücken, Hintern und Beinen voller Muskeln und Sehnen.
Die Herzogin fuhr fort. „Nach vielen Bitten war der Herzog bereit, ein paar Bäder in Milch und dann in Rosenwasser zu nehmen, um seine Haut etwas weicher zu machen. Es hat nichts gebracht. Seine Zähne wurden mit Zitronensaft, Salz und Zahnpulver gesäubert. Die Ärzte sagten, seine Zähne seien in gutem Zustand, keiner fehlte – es hatte den Anschein, als habe der Herzog sie inmitten der Wildnis irgendwie gepflegt. Seine Haare sind lang und zottig, aber er will sie sich nicht schneiden lassen. Zum Glück bindet er sie wenigstens zusammen.“
„Warum wollen Sie ihn zwingen, sie schneiden zu lassen?“
Die Herzogin sah verblüfft aus, weil Jules das überhaupt fragte. Ihre Lippen wurden schmal. „Sie verstehen doch wohl, dass der Herzog sich so nicht sehen lassen kann. Seine Erscheinung wird den Klatsch befeuern, doch er stellt sich taub gegen die Bitten von mir, seiner Großmutter, seiner Schwester … von allen.“
„Macht der Herzog sich über Ihre Vorschläge lustig?“, fragte Jules. Sie versuchte, ein Bild von dem Charakter des Herzogs zu bekommen.
„Nein, viel schlimmer. Er ist … nur gleichgültig.“
„Können Sie ihn eingehender beschreiben?“
Die Herzogin lächelte liebevoll. „Er hat die Augen seines Vaters … eine wunderschöne arktische Farbe, eher grau als blau. Aber sie leuchten nicht mehr. Sie sind stumpf und ausdruckslos, bis auf die Momente, in denen ich die Wildheit hinter dem Schleier sehe. Er verbringt viel Zeit im Wald, aber ich weiß nicht, was er da draußen treibt. Ich liebe meinen Sohn, doch ich finde sein Verhalten unzivilisiert und inakzeptabel.“
Wildheit. Jules begriff nicht, warum ihr Herz einen Satz machte und ihre Finger zitterten. Das Bild, das die Herzogin zeichnete, stieß sie nicht ab, im Gegenteil, sie war fasziniert. Sie war nicht sicher, welcher Teil von ihr reagierte – die angehende Wissenschaftlerin oder die verborgene Frau. Sie schlug sich den Gedanken energisch aus dem Kopf, stand auf und stolperte beinahe zum Kaminsims. Dort stand die Karaffe mit Branntwein. Warum denke ich überhaupt an solchen Unsinn? Für Jules war jede Art von Beziehung ausgeschlossen. Ihr ganzes Leben war eine ausgefeilte Täuschung und eine Enttarnung würde unvorstellbare Folgen haben. Vor ein paar Jahren hatte sie überlegt, ob es eine Möglichkeit gab, der Gesellschaft die Wahrheit zu offenbaren. Monatelang hatte sie gegrübelt, welche Vorteile das Leben einer Dame bot. Brautwerbung, Küsse, Verliebtheit, Kinder, Handarbeiten, Klavierspielen und alle anderen schönen Künste, denen sich ihre Schwester mit solcher Begeisterung widmete. Dann dachte Jules wieder an die Freiheiten, die sie genoss. Sie konnte in eine Kneipe gehen und Bier trinken, ohne Begleitung ausgehen, im Herrensitz reiten … und sie hatte beschlossen, die Täuschung auf die Spitze zu treiben und zu studieren. Sie hatte alle weiblichen Sehnsüchte begraben und sie nie wieder an die Oberfläche kommen lassen. Nicht einmal, als ihre Kommilitonen ihr von ihren Liebeserfahrungen vorschwärmten. Sie hatten sie für einen Mann gehalten, doch die Frau in ihr war nicht neugierig geworden. Warum also jetzt? Noch dazu auf einen Menschen, zu dem sie nur vorübergehend Kontakt haben würde? Das war doch lächerlich.
Die Herzogin ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. „Werden Sie den Fall übernehmen, Dr. Southby?“
Ihr Vater zögerte ein wenig.
„Ich würde Sie großzügig bezahlen“, sagte die Herzogin und hob das Kinn. „Und die Königin hat natürlich auch von Ihnen gesprochen.“
Jules’ Herz schlug heftig und sie verstand, worüber ihr Vater nachdachte. Die ganze Situation war ungewöhnlich und von großer Bedeutung. Der Ruf ihres Vaters und seiner ganzen Familie war in Gefahr, wenn seine Behandlung keinen Erfolg bringen würde.
Ihr Vater spielte mit dem Federhalter, den er in der Hand hatte. „Weiß Ihr Sohn, dass er der Herzog ist und welche Hoffnungen Sie in ihn setzen? Dass er seinem Titel und seinem Besitz Verantwortung schuldet?“
„Ich weiß nicht“, sagte die Herzogin. Ihre Augen wurden feucht. „Auf diese Frage brauchen wir eine Antwort – die Gesellschaft, die Königin und seine Familie. Und sie muss so beantwortet werden, dass keine Zweifel bleiben, Dr. Southby.“
Ihr Vater stand auf und verbeugte sich. „Es wird uns eine Freude sein, Ihnen in jeder Hinsicht zur Seite zu stehen, Euer Gnaden.“
Ein seltsames, unbekanntes Gefühl durchfuhr Jules. Es kam ihr beinahe vor wie Angst. Es war natürlich lächerlich, doch Jules war es, als würde sich ihr Leben durch diese Reise nach Hertfordshire für immer ändern.