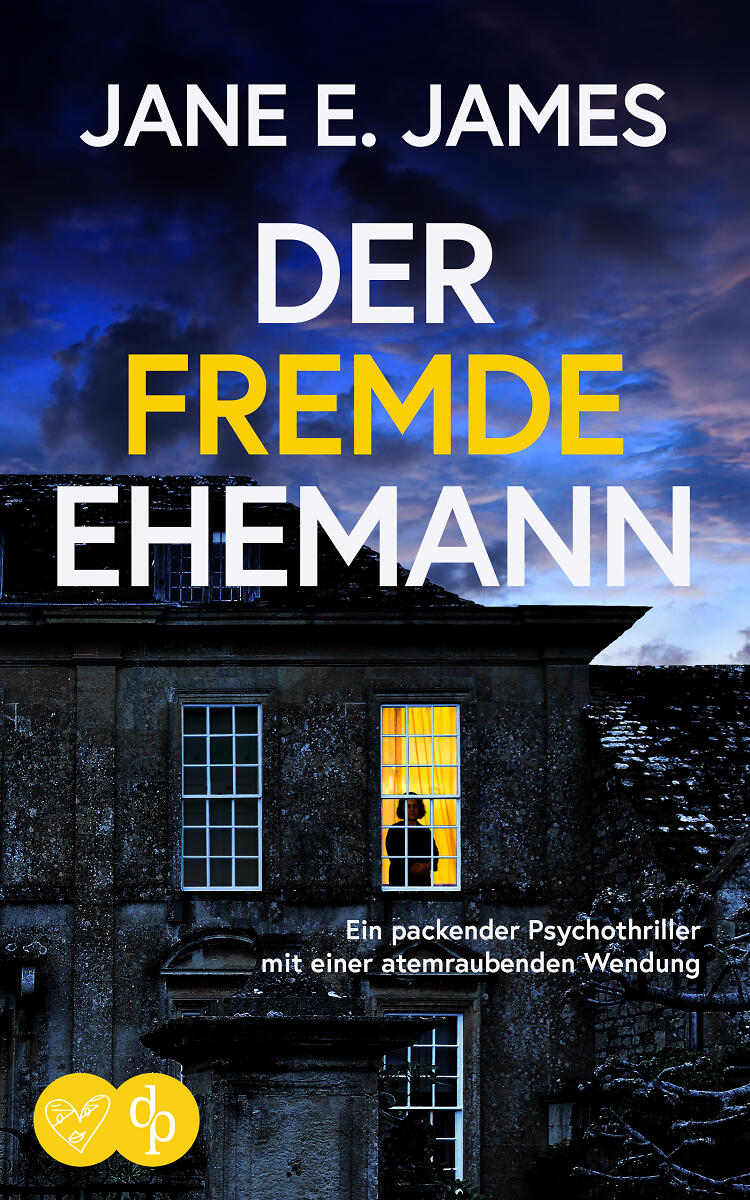Damals
Augen so blau und warm wie das Wasser. Haar so weiß wie der Meeresschaum der nahenden Flut. Ein Sonnenuntergang umgibt sein hübsches Gesicht mit einem sanften goldenen Schein.
Doch dieser Mann ist kein Engel. Nicht mit solch einem teuflischen, neckischen Lächeln und solch haifischartigen Zähnen. Er trägt sein Markenzeichen, das ihn als bürgerlichen Mann mittleren Alters auszeichnet: ein knittriges cremefarbenes Leinenhemd und eine dazu passende Leinenhose. Seine nackten, perfekt pedikürten Füße halten im nassen Sand inne, als er meinen Schatten erkennt, der sich ihm nähert. Bilde ich mir das ein, oder streckt er bei meinem Anblick seine immer noch muskulöse, gebräunte Brust, bedeckt von einer feinen Schicht silberner Haare, raus wie ein Silberrücken-Gorilla? Er hat jedes Recht genervt auszusehen, aber seine überraschte Reaktion verschafft mir einen Vorteil, den ich zu nutzen gedenke.
Hinter uns ist das beruhigende Summen von Insekten zu hören und weiter weg in der Ferne das Gelächter verliebter Urlauber, die mit Ouzo auf Eis anstoßen, während sie Oliven ohne Stein im Mund hin und her schieben und dafür sorgen, dass sich ihre roten Gesichter von einem Tag in der Sonne erholen. Und das alles, während ihnen göttlich aussehende, dunkelhaarige Kellner mit olivfarbener Haut schmeicheln.
Der Geruch von Tabak und etwas anderem … Marihuana, glaube ich, weht zu uns herüber und umhüllt uns. Der Rauch klebt uns an der Kleidung wie Schweiß. Aber er gibt sich lässig. Er zieht sich ein zerknittertes Päckchen Zigarren aus der Gesäßtasche, klemmt sich eine Zigarre zwischen die Lippen und zündete sie an. Dann schließt er die trägen, anzüglichen Augen und nimmt den Stoff in sich auf, als wäre es der Duft einer Frau. Bei dem Anblick hasse ich ihn erneut. Marcus, der Liebhaber. Marcus, der Frauenheld. Marcus, der Lügner.
Sein Blick ist vom Alkohol benebelt und er ist unsicher auf den Beinen. Er schwankt, als würde er zu langsamer Musik tanzen, nur liegt ihm diesmal keine Frau in den Armen. Seine Finger zittern leicht, als er einen zweiten Zug nimmt, und ich beobachte ihn dabei, wie er über das Meer hinweg Richtung albanische Küste blickt, die in der Ferne von dunklen Ruinen übersät ist. Er wirft die Zigarre in das unruhige Wasser des Ionischen Meeres und streicht sich mit der Hand über sein stoppeliges Gesicht, das kratzig ist wie der Sand unter unseren Füßen. Wie ein kämpfender Gladiator mit müden, blutunterlaufenen Augen wartet er ab.
Wir sprechen kein Wort. Unsere Augen übernehmen das Reden. Er verspottet mich immer noch, das merke ich. Er wagt es, mich mit seiner überlegenen Art zu provozieren. Er nimmt mich nicht ernst. Noch nicht. Glaubt, dass ich nicht mutig genug bin. Er denkt, ich würde mich nicht wehren. Aber ich bin nicht der Feigling, für den er mich hält.
Tja, so weit ist es wohl gekommen, was?, scheint er zu sagen und grinst – ganz der Narzisst.
Deine Schuld. Alles deine Schuld, sagen meine lodernden Augen.
Als er unvorhergesehen den Halt verliert und eine Hand ausstreckt, um nicht ins Wasser zu fallen, welches ihm auf dem Weg zum Ufer die Füße umspült, sehe ich, wie sein Blick panisch zur Seite schießt. Das löst etwas in mir aus. Jetzt hab ich ihn, denke ich. Und zu seiner Verteidigung ist zu sagen, dass wir beide in diesem Moment erkennen, wie angreifbar ihn der Alkohol gemacht hat, denn zum ersten Mal sehe ich einen köstlichen Hauch an Zweifel in seinen Augen.
Keiner von uns verliert auch nur eine Sekunde Zeit. Als er sich nach vorne stürzt, um sich vor der Flutwelle zu retten, die aus dem Nichts aufgetaucht ist und die seine untere Körperhälfte zu erfassen droht, stoße ich ihn gegen die Brust und spüre, wie meine Handfläche auf seinen für einen alten Mann noch immer starken Brustkorb trifft. Erneut stolpert er und das Wasser steigt ihm bis über die Brust, als der Meeresboden unter ihm verschwindet. Mit fuchtelnden Armen wehrt er sich gegen mich und das klare dunkelblaue Wasser, das bis heute Abend noch sein Freund war. Doch in seinem betrunkenen Zustand ist er langsamer als ich. Er trägt Angst im Blick und unsere Blicke begegnen sich ein letztes Mal. Schuldgefühle plagen mich, aber das Verlangen, ihn so zu verletzen, wie er mich verletzt hat, übertrumpft alles andere. Dieser Mann, der sich nur für sein eigenes Glück interessiert und sich einen Dreck um alle anderen schert, hat mein Mitleid nicht verdient. An einem guten Tag – und heute ist kein guter Tag – würde mir sogar Marcus selbst zustimmen.
Wir können das wie Erwachsene klären. Kein Grund zur …
Seine finsteren Augen, die nicht mehr funkeln, sondern schockiert und fassungslos erscheinen, flehen um Hilfe. Er ist es gewohnt, dass man ihm leicht verzeiht. Männer wie er halten so viel für selbstverständlich. Aber der Hass, den er in meinem Gesicht sehen muss, schenkt ihm nicht die geringste Hoffnung.
Hast du wirklich geglaubt, du kommst damit durch? Ohne bestraft zu werden? Meine Augen brennen sich in seine und lassen ihn wissen, dass er dieses Mal nicht gewinnen wird. Dieses Mal gibt es keine Vergebung.
Er ist nicht so wütend wie erwartet und ich spüre, dass er irgendwie immer schon wusste, dass dieser Tag kommen würde, dass es sein Schicksal war, durch jemandem zu leiden, der allen Grund hat, ihn zu hassen. Er scheint sich mit seiner Lage beinahe abzufinden. Obwohl er jemand ist, der andere, insbesondere Frauen, dazu bringen kann, zu tun, was er will, versucht er nicht, sich zu rechtfertigen. Was ist mit ihm los? Stattdessen nickt er würdevoll, als gäbe er mir die Erlaubnis, mich auszutoben. Aber das ist nicht, was ich will. Nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe die Situation in der Hand. Nicht er. Er hat mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Weder jetzt noch sonst irgendwann.
Zögere ich, so bin ich mir dessen nicht bewusst. Während Marcus noch anwesend und quietschlebendig ist, gehe ich in Gedanken bereits durch, wie ich mich in Zukunft an diesen Moment erinnern werde. Ich weiß, dass es wichtig sein wird, wenn ich Jahre später wach liege und mich mit der Wahrheit quäle. Wenn ich ihn nur dazu bringen kann, dass er verschwindet, kann ich dafür sorgen, dass der Schmerz ein Ende hat. Ich denke nur noch an Leid und Demütigung. Es verzehrt mich. Tag und Nacht.
Schließlich siegt die Panik über ihn und mir wird klar, dass sein Mut nur ein Bluff war. Der Mistkerl dachte, ich würde es nicht durchziehen. Ich habe ihn noch nie verängstigt gesehen und das Gefühl der Macht über ihn ist besser, als ihm mit einem Messer die verlogene Zunge herauszuschneiden und ihm dann die Klinge in sein kaltes, gefühlloses Herz zu stoßen.
Aber ich habe kein Messer, also stoße ich ihn erneut, mit mehr Kraft, als ob das erste Mal reine Übung war. Diesmal stoße ich ihm mit beiden Händen gegen die Brust. Er geht kampflos unter. Ist er so betrunken? Ich bilde mir ein, dass ich ihn kichern höre, aber ich weiß, dass das unmöglich ist. Selbst Marcus, mit seiner Leidenschaft für Abenteuer und Gefahren, ist nicht so verrückt. Sein Duft, eine betörende Mischung aus Sex, Schweiß, Zigarrenrauch und Aftershave, vermischt sich mit Salzwasser und Seetang, als er in der starken Strömung der nahenden Flut untergeht. Er taucht nur ein einziges Mal auf, mit hervortretenden Augen, die nassen Haare über einem Auge. Er schnappt mehrfach nach Luft, doch gleichzeitig verschluckt er sich am Wasser, das ihn zu ersticken droht.
Ich schließe die Augen – ich habe ihm gesagt, dass ich ihn nie wieder sehen will, und das habe ich ernst gemeint –, dann lege ich ihm entschieden eine Hand auf den Kopf und drücke fester nach unten, als würde ich in der Schule ein kleineres, schwächeres Kind mobben, indem ich es im Schwimmbad untertauche. Das Wasser ist plötzlich kalt und reicht mir mittlerweile selbst bis zur Brust. Sollte ich mir Sorgen machen? Einen panischen Moment lang stelle ich mir vor, wie Marcus mich mit sich mitreißt. Er fände das sicher passend. Aber er ist unter den Wellen verschwunden.
Gerade als ich denke, dass es vorbei ist, dass er weg ist und weder mir noch sonst jemandem mehr wehtun kann, streckt er die Hand aus dem Wasser, die Handfläche gespreizt und die Finger in einem letzten Hilferuf ausgestreckt. Mir rutscht das Herz in die Hose, als ich das beobachte. Soll ich versuchen, ihn zu retten? Doch dann erhasche ich einen Blick auf das Gold an seinem Finger und etwas in mir stirbt, als ich es im Licht der untergehenden Sonne funkeln sehe.
Als es vorbei ist … als die ausgestreckte Hand mit dem goldenen Ring am Ringfinger im Schaum der Wellen versunken ist und ich ihn nicht mehr sehen kann, merke ich, dass mir das Blut so stark durch die Adern schießt, dass mein wummerndes Herz das Meeresrauschen übertönt. Dort, wo er sich einst vor mir aufgebaut und sich in seiner Männlichkeit gesonnt hatte, brechen jetzt die Wellen und ziehen sich wieder zurück, ohne dass etwas von ihm zurückbleibt. Nicht eine Spur.
Keine Meeresschätze, die darauf hindeuten, dass einer von uns jemals hier war. Also schleiche ich mich davon, wie eines der leisen, verstohlenen Tierchen, die nachts eilig dem Meer entfliehen, und meine schuldbewussten Schritte reihen sich in ihre Spuren im Sand ein, als ich mich aus dem Staub mache.
Kapitel 1
Das ist er. Da bin ich mir sicher. Aber das kann nicht wahr sein. Oder doch? Jedenfalls sieht es nach ihm aus, auch wenn das Foto unscharf ist. Doch ich weiß, dass das unmöglich ist. Ich muss verrückt oder betrunken sein, aber da es erst neun Uhr ist, weiß ich, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Ich beschließe also, dass ich wohl halluziniere. Depressionen können einer Person Grausames antun, selbst einer so durchschnittlichen wie mir. Die vernünftige Linda, das bin ich laut Familie und Freunden – die ich mittlerweile kaum noch treffe. Ich kann es ihnen allerdings nicht vorwerfen. Wer will sich schon mit einer einsamen Frau in den Wechseljahren abgeben, die dank Brain Fog ständig benebelt ist.
Verdammt, wäre das Foto doch nur nicht so verschwommen. Dann könnte ich es mit Sicherheit sagen.
Nachdem ich meine Ersparnisse größtenteils verloren habe, muss ich leider gestehen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben auf Sozialhilfe angewiesen bin. Und mit einem unverbindlichen Null-Stunden-Vertrag im Fish-and-Chips-Imbiss gegenüber, dessen Besitzer außerdem Vermieter meiner schmuddeligen Einzimmerwohnung im ersten Stock ist, schwimme ich nicht gerade im Geld. Aber ich könnte mich dafür ohrfeigen, dass ich mir kein Upgrade auf die Premium-Version gegönnt habe, denn dann könnte ich wenigstens ein ungefiltertes Foto des Mannes sehen und seine vollständige Bio lesen, anstatt der anonymen 100-Worte-Kurzversion, die jeder schreiben muss, der sich bei Welcome Back, einer Onlinedatingseite für über Fünfzigjährige, anmeldet. Nur ist es nicht wirklich eine Datingwebsite, wenn man dem Marketing der Seite glauben darf, sondern eher eine Möglichkeit für Leute wie mich, wieder mit anderen in Kontakt zu kommen.
Bei den vertrauten Worten „Hallo, mooi vrou“ habe ich mich direkt an meinem Buttertoast verschluckt, denn die Sprache erkannte ich sofort: Afrikaans. Marcus ist in British Columbia geboren und im Alter von acht Jahren nach Südafrika gezogen, also hat das bei mir natürlich einen Nerv getroffen. Er stellte sich auf Englisch weiter vor:
Dein Profil hat mir direkt den Tag versüßt. Ich habe das Gefühl, dich schon zu kennen. Ich wette, du hast genau wie ich eine Vorliebe für die schönen Dinge des Lebens, Cocktails am Strand und gutes Essen. Ich sehe dich schon vor mir, Meeresbrise im Haar, wie du einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachtest. Aber was wäre ein Sonnenuntergang ohne eine schöne Frau wie dich?
„So was von kitschig“, hätte meine beste Freundin Gail geschnaubt und mich dabei mit unterdrücktem Kichern mit dem Ellbogen angestupst, wenn sie gesehen hätte, wie sich der geheimnisvolle Mann vorstellt. Ich hätte ihr recht gegeben und mir dabei insgeheim gedacht, dass mehr hinter diesen Worten steckt. Zumindest für mich. Ich bin zwar nicht an die schönen Dinge im Leben gewöhnt und habe mich nie in noblen Restaurants wohlgefühlt, aber die Worte schreien trotzdem nach Marcus und deshalb gehen sie mir nicht mehr aus dem Kopf.
Ich beschließe, meinen Account jetzt sofort upzugraden, damit ich eine vernünftige Entscheidung über den Mann auf dem Foto treffen kann – der vielleicht Marcus ist oder vielleicht auch nicht –, also hole ich meine Kreditkarte aus der Tasche. Dann ziehe ich meinen klobigen, fusseligen Morgenmantel aus und lasse ihn in der engen, fensterlosen Küche zu Boden fallen, bevor ich mich wieder an den kleinen Tisch setze, an dem mein schwerer alter Laptop so aufgeklappt ist, dass er ein großes, unfreundliches Gähnen von sich gibt.
Eigentlich sollte ich wieder zu einer dieser schrecklichen Selbsthilfegruppen für Frauen gehen, in denen alle außer mir aufstehen und ihre Geschichte erzählen, aber wer auch immer entschieden hat, dass zehn Uhr morgens ein geeigneter Zeitpunkt dafür ist, anderen sein Innerstes zu offenbaren, gehört erschossen. Zu dieser Tageszeit bin ich kaum funktionsfähig. Wäre ich nicht auf den Marcus-Klon gestoßen, würde ich immer noch mit halb geschlossenen Augen durch die Gegend laufen. Obwohl ich nicht aktiv auf der Suche nach einer Beziehung bin – und das bin ich wirklich nicht, im Gegensatz zu anderen, die es vehement bestreiten, nur um dann mit einer Person zusammenzuziehen, die sie seit fünf Minuten kennen –, logge ich mich manchmal zu häufig ein.
Ich rede mir ein, dass es ein harmloser Zeitvertreib ist, wenn schon nichts anderes daraus wird. Man hat viel Zeit, wenn man wie ich von seinen Lieben abgeschnitten ist.
Alles, was ich mir von Welcome Back wünsche, ist, Freundschaften mit Leuten in meinem Alter zu schließen. Es ist doch nichts falsch daran, sich ein wenig Gesellschaft zu wünschen, oder? Und das heißt nicht, dass man sich persönlich treffen muss. Online ist in Ordnung. Am liebsten würde ich Leute kennenlernen, die Ähnliches durchgemacht haben wie ich, aber ich nehme an, die Chancen stehen schlecht.
Im Gegensatz zur Bio des unbekannten Mannes, die nur so nach Leidenschaft und Abenteuer schreit – genau wie Marcus –, verrät mein Profil, mit dem ich erst nach mehreren Anläufen zufrieden war, nicht viel:
Ich heiße Linda. Ich bin siebenundfünfzig Jahre jung und liebe Tiere, vor allem Hunde. Ich reise gerne, fliege aber ungern und war schon lange nicht mehr unterwegs. Kälte macht mir viel aus, ich bin also definitiv Fan von warmem Wetter. Mir wird immer wieder gesagt, ich sehe zehn Jahre jünger aus, als ich bin, aber so fühle ich mich nicht. Lol. Ich bin außerdem ziemlich schüchtern und höre lieber zu, als selbst zu reden.
Diese Bio zu schreiben, war mir schwergefallen, denn ich bin ein verschlossener Mensch. Ich behalte meine Probleme lieber für mich, im Gegensatz zu den jungen Leuten auf Social Media heutzutage. Lieber Gott, was die teilweise so sagen!
Ich nehme an, dass ich deshalb keine Reaktionen auf mein Profil bekommen habe … bis jetzt. Aber bis ich mich für die Premium-Version angemeldet habe, und das tue ich, so schnell ich kann – Wo ist meine verdammte Brille? –, kann ich das Feld mit dem großen grünen Häkchen nicht öffnen, laut dem mir dieser Mann heute Morgen um 02:05 Uhr eine Nachricht geschickt hat. Er muss ein Nachtmensch sein, auch das hat er mit Marcus gemeinsam, wenn er um die Zeit wach ist. Ich denke darüber nach, während ich darauf warte, dass der Link an meine E-Mail-Adresse geschickt wird, die ich schon seit Jahren habe: lindadelamere@gmail.com. Ich bin nie dazu gekommen, mir eine E-Mail-Adresse mit meinem Ehenamen Bouchard zuzulegen, der sowieso nie zu mir gepasst hat. Marcus war viel glamouröser als ich und ihm stand der Name, während ich mich damit unwohl fühlte.
Der Link kommt ordnungsgemäß in meinem Posteingang an. Ich hatte nie einen Bürojob oder eine berufliche Karriere, also bin ich keine schnelle Tipperin, sondern eher eine unbeholfene Dickfinger-Tipperin. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein richtiger Ausdruck dafür ist, wie Oldies wie ich tippen, aber es „trifft den Nagel auf den Kopf“ – eine meiner Lieblingsredewendungen. Zusammen mit „Es ist, wie es ist“. Das Alter macht uns alle zum Klischee, finde ich, aber nicht auf gute Art und Weise. Als ich auf den Link zu meinem upgegradeten Account klicke, zittern mir nervös die Finger, als wäre ich ein junges Mädchen bei seinem ersten Date. Aber vorerst muss ich vorgeben, mich auf einen Chat mit der „Himmlischen Helen“ einzulassen, die mir sämtliche Funktionen erklärt.
„Verpiss dich, Helen“, zische ich herzlos. Sie will nur helfen. Aber während ich warte, frage ich mich, ob sie wirklich Helen heißt und ob sie überhaupt eine Frau ist. Sie könnte einer dieser Bots sein, von denen man immer wieder hört. Endlich lässt Helen mich sitzen, um sich jemand anderem zu widmen. Jetzt kann ich „klicken“ oder „swipen“ oder wie auch immer man es heutzutage nennt, wenn man anständige, hart arbeitende Menschen in den Papierkorb schiebt, nur weil einem ihr Aussehen oder ihre Haarfarbe nicht gefällt oder sie nicht sonderlich interessant sind, bis man sie besser kennenlernt, so wie es bei mir der Fall ist. Ich beschließe, dass diese Leute eine bessere Chance verdient haben, und entscheide, niemanden auszumisten, der nicht unhöflich oder übergriffig ist. Aber eins nach dem anderen – wo ist er?
Ein Klick auf das große, grüne Häkchen, das er mir geschenkt hat – und das schmeichelt mich ein wenig, ich kann nicht anders, auch wenn ich hoffe, dass ich dadurch nicht eitel wirke, denn so will ich nicht gesehen werden –, und schon wird endlich die Nachricht sichtbar, die er mir geschickt hat, wenn auch unglaublich langsam. Ich werde nervös und merke, dass ich meine Hände zu Fäusten geballt habe und sich meine Nägel in die Handflächen graben, während ich zusehe, wie sich die Nachricht öffnet.
Liebste Linda. Dein Profil ähnelt so sehr jemandem, den ich mal kannte und immer noch vermisse. Ich würde gerne mit dir reden, wenn du bereit bist, einem alten Mann eine Chance zu geben. Wie wär’s, wenn wir uns mal treffen? Liebe Grüße, Tony Fortin.
Meine Augen wandern nach rechts, wie es gedacht ist, und fokussieren sich auf Tonys Gesicht. Jetzt, wo der verschwommene Filter von dem Foto entfernt ist, erkenne ich ihn sofort.
Alles verschwimmt vor meinen Augen. Ich spüre, wie ich schwach werde. Die Dunkelheit ist zurück. Ich bekomme keine Luft.
Nichts fühlt sich mehr sicher an.
Wie ist das möglich?
Wenn ich nicht aufpasse, kriege ich wieder eine Panikattacke. Ich rufe mir in Erinnerung, was mir beigebracht wurde, und versuche, mich von der Bedrohung abzulenken.
Atme, Linda. So ist’s gut. Bleib ruhig. Konzentriere dich auf deine Atmung. Dir wird nichts passieren. Es ist alles in deinem Kopf.
„Blödsinn.“ Mit meinem Kopf ist nichts schief, ausnahmsweise mal. Ganz im Gegenteil. Und der Mann, den ich gerade anstarre, ist nicht Tony Fortin.
Aber ich mache mich lächerlich. „Wunschdenken“, würde meine jüngere Tochter Abby dazu sagen. Und damit hätte sie ausnahmsweise mal recht.
Und doch … ein weiterer Blick auf die lachenden blauen Augen, die durch die Sonne strapazierte Haut und das vertraute faule Lächeln und mir dreht sich der Magen um, bis ich denke, dass ich mich auf meinen Laptop übergeben muss.
Das ist Marcus.
Und wenn nicht … dann hat er irgendwo einen verlorenen Zwilling. Alles, bis hin zu der Art, wie er seinen Kopf leicht nach links neigt, weil das seine bessere Seite ist, schreit nach meinem Mann. Er war früher schon immer eitel und ich sehe, dass sich daran nichts geändert hat.
Aber er kann es nicht sein. Egal, wie sehr ich es mir auch wünschen würde. Denn mein Mann ist tot. Das ist er bereits seit acht Monaten, seit er am Strand von Barbati im Norden von Korfu – wo wir unseren Griechenlandurlaub verbracht haben – ins gefährliche Gewässer tauchte und nicht wieder zurückkehrte.
Seine Leiche wurde nie gefunden.
Aber wenn das Marcus ist, warum sollte er sich dann über eine Dating-App melden? Anstatt direkt zur Polizei zu gehen oder mich persönlich aufzusuchen? Wenn er jene Nacht irgendwie überlebt hat, hat er dann vor, zurückkommen, nur um mich zu bestrafen?
Kapitel 2
„Bin ich bescheuert? Was meinst du?“ Ich kaue auf meinen Nägeln, eine neue schlechte Angewohnheit von mir, während ich meine Theorie an meiner besten Freundin teste.
„Na klar, bist du bescheuert.“ Gail kichert am anderen Ende der Leitung. Sie will mich einfach nicht ernst nehmen. „Das ist nichts Neues.“
Ab und an hält sie inne, als würde sie nicht richtig zuhören, und ich schließe daraus, dass sie am Rauchen ist. Jeden Monat gibt sie es auf: Trinken und Männer noch dazu. Aber an Tag drei fängt sie wieder an. Gerade würde ich am liebsten meine Hand durch das Handy strecken und ihr die Kippe aus der Hand schnappen.
„Aber er sieht ihm so ähnlich, Gail.“
„Und Millionen andere tun das auch. Wir haben alle irgendwo da draußen einen Doppelgänger.“
Ich stöhne auf. Ich habe gar keine Lust, das schon wieder mit ihr durchzukauen. Gail, normalerweise eine vernünftige, hartgesottene und pragmatische Frau, ist der Überzeugung, dass wir alle einen Doppelgänger haben, der auf einem anderen Planeten ein eigenes Leben führt. Manchmal wünschte ich, ich könnte auch daran glauben.
Heute aber nicht. Heute ganz bestimmt nicht.
„Und überhaupt“, fährt sie fort, „selbst wenn es Marcus wäre, und er ist es ganz sicher nicht, warum taucht er dann nicht einfach vor deiner Tür auf und sagt: ‚Hey, Babe, ich bin wieder da. Jetzt zieh dich aus, ich sterbe vor Lust‘? Kapiert? Sterbe …“
„Ja, ich hab’s kapiert“, erwidere ich und versuche, dabei nicht allzu genervt zu klingen. Gail muss alles immer mit Humor sehen, während ich dagegen … tja, sagen wir’s mal so, wir sind ziemlich unterschiedlich. Komplett gegensätzlich vielmehr, weswegen wir wohl auch schon so lange befreundet sind. Genauer gesagt seit unserer Schulzeit, als sie mich vor einem älteren, größeren Mädchen gerettet hat, das mir eine Abreibung verpassen wollte. Claire Mullins.
„Hör zu“, sagt sie und versucht damit, die Sache in die Hand zu nehmen, „du nimmst jetzt schon eine ganze Weile diese Tabletten, die dir offensichtlich nicht guttun und dich nur noch mehr plemplem machen als sowieso schon. So, dass du dir Sachen einbildest, und so wie heute. Du solltest dir überlegen, sie abzusetzen.“
„Das mache ich auch. Nur noch nicht jetzt. Ich brauche sie noch.“ Ich winde mich bei dem Gefühl, so erbärmlich zu klingen. Gott sei Dank sieht sie nicht, wie ich das Gesicht verziehe. Sie würde sich in ihren postmenopausalen Tanga machen. Aber sie hat recht. Ich sollte die Tabletten absetzen. Laut meinem Arzt leidet eine von hundert Personen an schweren Nebenwirkungen in Bezug auf Serotonin und ich bin eine der Betroffenen, auch wenn meine Symptome als gemäßigt eingestuft werden. Das nennt sich eine milde Form des Serotoninsyndroms. Mir wurde Sertralin verschrieben, durch das ich in Kombination mit Tramadol oft verwirrt bin. Wenn ich eine Überdosis einnehme, was ich ab und an tue, kann die Kombination sogar Halluzinationen auslösen. Nicht dass ich das meinem Arzt, Gail oder sonst jemandem gegenüber zugeben würde.
„Ich weiß, Babe. Du bist depressiv, was vollkommen natürlich ist. Du hast viel durchgemacht und vermisst ihn wie verrückt. Niemand würde dich dafür verurteilen, dass du nicht akzeptieren willst, dass er in Wahrheit nie wieder zurückkommt.“
Natürlich kann ich Gail nicht von der Nacht erzählen, in der Marcus ins Wasser tauchte. Dieses Geheimnis werde ich mit ins Grab nehmen müssen, aber mit jedem Tag wächst in mir das Bedürfnis, es auszuplaudern. Sie ist meine beste Freundin und ich sollte ihr vertrauen können. Ich will das Thema gerade ansprechen, als ich merke, dass Gail mit mir noch nicht durch ist.
„Ich finde, du solltest dich definitiv eine Weile lang von dieser Datingwebsite fernhalten und so. Ich will damit nicht sagen, dass du keine neuen Bekanntschaften schließen sollst, aber wenn du auf diese Nachricht antwortest, machst du dich damit vielleicht nur …“, sie hielt inne, „krank.“
„Wieder. Du wolltest sagen, dass ich mich wieder krank mache“, bemerke ich, ohne es unhöflich auszudrücken. Es ist kein Geheimnis, wie nahe ich in den ersten Wochen nach dem Verlust von Marcus davorstand, mir das Leben zu nehmen. Es ist ein Wunder, dass man mich nicht weggesperrt hat. Ich bin selbst überrascht, dass ich diese dunkle Zeit überstanden habe.
„Apropos Ehemänner“, wechselt Gail schnell das Thema. „Ich habe Jim letztens im Cosy Club gesehen. Er war auf einen Drink da und das auch noch in Hemd und Krawatte.“
Ich stelle mir vor, wie Gail die Augen verdreht, und ich kann ihre Reaktion nachvollziehen. Jim, mein Ex, hat noch nie in seinem Leben Krawatten getragen, von unserem Hochzeitstag abgesehen. Sich im Pub aufzuhalten ist für Jim, den Stubenhocker, auch unüblich.
„War er mit einem der Mädchen unterwegs?“, frage ich und hoffe auf ein paar Krümel an Informationen über Abby oder Rosie. Ich vermisse die beiden so sehr, aber ich darf nicht nach ihnen fragen, weil Gail sonst schnippisch wird. Sie meint, das „setze sie unter Druck“. Aber es sind meine Kinder, nicht ihre, auch wenn sie quasi eine Tante der beiden ist. Natürlich sage ich das nicht. Bei Gail kommt man mit so etwas nicht durch. Als beste Freundin ist sie bereits beachtlich stark. Und als beschützerische Tante erst recht.
„Na ja, er war mit einem Mädchen unterwegs, wenn du es unbedingt wissen willst. Nur keines der beiden, die du meinst“, sagt Gail und verdirbt damit alles. Ich verstumme, erleichtert, dass ich mich vorhin nicht verraten habe. Es ist nichts Neues, dass sie es erzählt, als würde sie mich gern so verletzen. Aber ich schiebe es wie immer auf ihren Mangel an Feingespür. Sie verhält sich schon immer wie ein tollpatschiger Labrador. Macht sich nie Gedanken darüber, wie sich ihr Verhalten auf andere auswirkt.
„Oh“, erwidere ich einfach, weil ich sie nicht ausquetschen, aber unbedingt mehr erfahren will. Jim ist achtundzwanzig Jahre lang mein Mann gewesen. Natürlich interessiere ich mich für sein Leben.
„Tu nicht so“, schnauzt Gail.
„Ich mach doch nichts.“
„Ich kenne dich besser, Linda Delamere – oder Bouchard oder wie auch immer du dich zurzeit nennst“, sagt sie und ihr Ton ist dabei nicht harsch, „aber Jim verdient es, glücklich zu sein.“
„Nach dem, was ich ihm angetan habe, meinst du.“ Mein Tonfall klingt gemeiner, als ich beabsichtigt habe, und ich presse meine Lippen fest aufeinander. Am anderen Ende der Leitung ist es still. Gail weiß, wann sie die Klappe halten sollte.
„Wie war sie so?“, flüstere ich, weil ich mich nicht zurückhalten kann.
„Nett, anständig, ein Familienmensch, würde ich sagen“, antwortet sie abwesend, als ob ihr reger Kopf bereits wieder mit etwas anderem beschäftigt wäre. Gail kann nicht lange an Ort und Stelle bleiben, weder körperlich noch gedanklich. Sie ist unglaublich ungeduldig und steht nie still.
Ich stecke jedoch noch immer an selber Stelle fest und stelle mir meinen Ex mit diesem netten, anständigen Familienmenschen vor. Ich weiß nicht, wie Gail diese Vermutung über jemanden aufstellen kann, den sie nur einmal gesehen hat, aber ich beschließe, dass ich das besser unerwähnt lasse, und wechsle das Thema.
„Du meinst also, dass ich mir keine Sorgen machen muss?“, dränge ich erneut in Bezug auf meine Marcus-Theorie.
Statt der beruhigenden Worte, die ich mir erhofft habe, höre ich das Echo einer zuschlagenden Tür, gefolgt von Schritten auf Kies und dem schrillen Quietschen eines Tores. Diese Geräusche sind mir vertraut. Gail muss gerade ihren Sportwagen geparkt haben, wobei sie zweifellos zwei Parkplätze in Anspruch genommen hat. Jetzt wird sie auf dem Weg zu ihrem Kanalboot The Grand Dame sein, das auf dem mahagonibraunen Wasser neben einem Pub liegt, in dem Bio-Cider und Halloumi-Pommes im Bierteig serviert werden. Ich frage mich, wo sie die ganze Nacht unterwegs gewesen ist. Offensichtlich hat sie ihre Zeit woanders verbracht, nicht auf dem Boot. Ich stelle mir sie vor mit ihrem kurzen, feuerroten Haar, platt von der Nacht auf einem fremden Kissen, verschmierter Wimperntusche um die Augen und einem Spitzen-BH in 34E, den sie sich hinten in ihre Skinny Jeans gesteckt hat.
„Was hast du gerade gesagt, Babe?“, hakt sie nach und meldet sich damit zurück, als ich gerade ganz verrückt vor Neid aufgeben und auflegen wollte.
„Wegen Marcus. Du denkst, ich sollte nichts tun. Es niemandem erzählen.“
„Bloß nicht. Die stecken dich in eine Zwangsjacke und entsorgen den Schlüssel, wenn du das machst.“
Seufzend verabschiede ich mich und tue so, als ginge es mir gut, eine notwendige Maßnahme für alle Trauernden. Ich wünsche ihr Glück für das morgige Vorstellungsgespräch, das sie vergessen hat, während ich die ganze Zeit über am liebsten schreien würde: „Das ist nicht fair! Ich hasse das hier. Ich will einfach nur, dass der Schmerz aufhört. Ich halte es nicht mehr aus.“ Aber wenn ich das täte, würde Gail die Polizei anrufen, meinen Arzt, ihren Arzt, Jim, den Rettungsdienst, Barkeeper Ray aus dem Cosy Club, mit dem sie schon viermal geschlafen hat, ohne dass sie sich entscheiden kann, ob sie es noch einmal tun will – und jeden anderen, der ihr einfiele.
Sobald ich aufgelegt habe, frage ich mich, ob Gail recht hat. Vieles von dem, was sie gesagt hat, ergibt Sinn. Vielleicht liegt es an den Antidepressiva und ich sollte mich eine Weile von der Welcome Back-Website fernhalten.
Aber was Marcus angeht, ist die Sache viel komplizierter, als Gail je ahnen wird. Je mehr ich über jene Nacht nachdenke, desto leichter fällt es mir, mir einzureden, dass ich Marcus etwas angetan habe. Wir haben uns gestritten. Daran erinnere ich mich und ich erinnere mich auch an meine Eifersucht und Wut ihm gegenüber. Aber habe ich ihn geschubst? Habe ich mir all die Monate umsonst Vorwürfe gemacht, obwohl es schlicht und ergreifend ein Unfall war, wie es im Urteil nach den Untersuchungen hieß? Ich wünschte, ich könnte mich wieder erinnern, dann wüsste ich es mit Sicherheit. Ich habe bereits erwogen, mich professionell hypnotisieren zu lassen, aber ich habe Angst vor dem, was ich erfahren würde. Wie soll ich mit mir selbst leben, wenn sich herausstellt, dass ich meinen Mann habe sterben lassen, oder noch schlimmer, dass ich für seinen Tod verantwortlich bin?
Meine Ärztin hat mir gesagt, dass ich mit einer ganzen Reihe von Gefühlen rechnen muss, darunter auch Selbstvorwürfe und Schuldgefühle. Beides habe ich in Hülle und Fülle, allerdings nicht aus den Gründen, die sie vermutet. Wenn sie wüsste, was ich eventuell getan habe, würde ich womöglich in der Zwangsjacke enden, genau wie Gail gesagt hat.
Kapitel 3
Dank dem Ärgernis mit der Datingwebsite und meinem anschließenden Gespräch mit Gail bin ich fünfzehn Minuten zu spät dran. Aber trotz des elenden Novemberregens habe ich den Weg zum Gemeindezentrum mit meiner Blick-zu-Boden-und-bloß-nicht-auffallen-Taktik gemeistert und lasse mich auf meinem Plastikstuhl nieder, ohne allzu sehr zu stören.
Zum Glück ist bereits jemand anderes aufgestanden und redet, wodurch ich aus dem Schneider bin. Ich hasse es, im Rampenlicht zu stehen. Während ich meinen klatschnassen Anorak und meine billige Kunstledertasche unter dem Stuhl verstaue, schnappe ich nur Bruchstücke von dem auf, was die Frau gerade sagt. Begriffe wie Vergebung, faktengestützt, Mythen der Trauer, Bewältigungsmechanismen, Verwirrung, sich an der eigenen Heilung beteiligen und Handlungsschritte prasseln auf mich ein, ohne mich zu trösten, doch den vertrauten, freundlichen Klang ihrer Stimme erkenne ich.
Sie heißt Sue und ist Spezialistin für Trauerbewältigung. Sie selbst hat ihren Mann vor fünf Jahren an seine Hautkrebserkrankung verloren und sich anschließend zu diesem Thema weitergebildet, weil sie anderen helfen wollte. Sicherlich sehr lobenswert, aber bisher habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich mich auf den Prozess einlasse, obwohl das heutige Gruppentreffen bereits mein drittes ist. Könnte ich es mir leisten, auf eigene Kosten Hilfe in Anspruch zu nehmen, würde ich das tun, aber da diese Kurse von der Hilfsorganisation Victim Support finanziert werden, kann ich kaum schwänzen, während sich andere Leute verzweifelt um einen Platz im Kurs bemühen. Wie ich Sue letzte Woche bereits erklärt habe – und sie ist eine so liebenswerte, fürsorgliche Frau, dass ich es ihr gern recht machen möchte –, begreife ich nicht, wie es Leuten den Schmerz nehmen soll, einen Brief an einen verstorbenen Liebsten zu schreiben.
Sie hat mir erklärt, dass es nicht so einfach sei, da zuvor erst viele andere Schritte nötig seien, unter anderem die Teilnahme an Gruppenrunden, welche ich mittlerweile genauso fürchte wie meine jährliche Grippeimpfung, die mir üblicherweise eine dreitägige Migräne verschafft.
Wenn sie heute mit ihrer Ansprache fertig ist, wird sie mich bestimmt erneut bitten, meine Geschichte mit der Gruppe zu teilen. Das Problem ist nicht, dass ich das nicht will. Ich habe geübt, mir meinen Erfahrungsbericht laut selbst vorzulesen. Aber bei der Vorstellung, das vor sechs anderen Menschen zu tun, außer Sue größtenteils Fremde, wird mir übel. Ich weiß wirklich nicht, woher meine Töchter Abby und Rosie ihr Selbstvertrauen haben, mit dem sie etwa auf der Arbeit Vorträge halten, aber von mir haben sie es nicht und von Jim auch nicht.
Ich bin nur hier, weil ich weiß, dass es mir guttut, aber nicht so, wie Sue meint. Wenn ich unter Leuten bin, kann ich nicht wie besessen über die Website nachdenken und über den Mann, der genauso aussieht wie Marcus. Obwohl Gail mich davor gewarnt hat, bin ich versucht, ihm auf seinen Vorschlag für ein Treffen zu antworten und zu schreiben: „Ja, bitte. Unbedingt so schnell wie möglich“. Denn ich sterbe bald – oh Gott, schon wieder dieses Wort, ich klinge schon leichtfertig wie Gail –, wenn ich nicht herausfinde, ob er es wirklich ist. Auch wenn Gail sagt, dass er es nicht sein kann. Rein logisch gesehen weiß ich, dass sie recht hat.
Aber emotional sagt mir mein Herz etwas ganz anderes. Niemand kennt Marcus so gut wie ich. Wie er tickt. Sein Lächeln. Dieser Blick, der dir zeigt, wie selbstgefällig er ist. Alles an diesem Profilbild, der Nachricht und dem Schreibstil schreit nach meinem Mann.
Als Sue fertig ist, legen wir eine Pause ein und es gibt Tee und Hobnobs Haferkekse. Gierig verschlinge ich drei und hoffe dabei, dass es niemand bemerkt. Ich bin am Verhungern und kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal etwas gegessen und im Magen behalten habe. Außerdem bin ich nervös. Geradezu panisch. Denn natürlich fängt Sue mich ab, sobald sie die Gelegenheit hat, und fragt mich erneut, ob ich aufstehen und meine Geschichte mit der Gruppe teilen möchte. Dieses Mal lässt sie kein Nein gelten. Sie erklärt mir, dass es für meinen Heilungsprozess wichtig ist und niemand über mich urteilen oder erschrocken reagieren wird, wenn ich in Tränen ausbreche.
„Weinen ist erlaubt, wir ermutigen dich sogar dazu“, sagt sie eindringlich. Sie scheint dabei die Kekskrümel um meinen Mund zu bemerken und bleibt ihrem Wort treu, indem sie mich nicht dafür verurteilt.
Ich will ihr erklären, dass Weinen dort, wo ich herkomme, verpönt ist. Jim und ich sind in der gleichen Sozialsiedlung in Stamford aufgewachsen und haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir waren beide nicht gut in der Schule. Ich verließ die Schule ohne meinen O-Levels-Abschluss, heutzutage GCSEs genannt. Nachdem ich erst Rosie und dann Abby zur Welt gebracht hatte, habe ich eine Reihe an schlecht bezahlten Teilzeitjobs angenommen, während Jims Schreinerei unerwartet erfolgreich war und uns einen angenehmen Lebensstil ermöglichte. So konnten wir unser eigenes, renovierungsbedürftiges Haus kaufen, an dem Jim acht Jahre lang werkelte. Er opferte seine Abende und Wochenenden, damit wir das Haus haben konnten, von dem wir (also ich) immer geträumt hatten.
Obwohl wir ein großes Haus mit vier Schlafzimmern in der begehrten Victoria Road besaßen, das mittlerweile eine halbe Million wert ist, waren wir im Grunde immer noch dieselben Menschen. Jim sprach nie über seine Gefühle, nicht einmal als sein Dad starb. Seiner Meinung nach waren psychische Probleme etwas, worunter andere Leute litten. Ich war nicht so schlimm wie Jim und offen für neue Denkansätze, allein um meiner Töchter willen, aber zu dem Zeitpunkt war es bereits zu spät für mich, dachte ich zumindest. Bis ich Marcus traf und sich mein Leben änderte.
Ich drücke mir zur Beruhigung meine zerknitterte Tasche an die Taille, als wäre sie ein Kind, und lächle nervös in die Runde an erwartungsvollen Gesichtern um mich herum, einige alt, einige jung, einige besser gekleidet als andere. Sechs Fremde und Sue. Meine neue Familie, sagt man mir. Alle lächeln freundlich, nicken mir zu und schenken mir mit ihren ausdrucksstarken Augen ermutigende Blicke. Alle spornen mich an, es gut zu machen. Obwohl ich diese Frauen nicht kenne, treibt mir ihre bloße Anwesenheit plötzlich Tränen in die Augen, weil sie mir das Mitgefühl und das Verständnis entgegenbringen, das ich brauche und das ich von meinen Töchtern nicht bekomme.
„Ich heiße Linda Delamere. Bouchard, genau genommen.“
Meine Worte klingen schrill und nicht so, wie ich sonst klinge. Hochnäsig, obwohl ich das nicht bin. Abby würde mir vorwerfen, dass ich eine falsche Stimme aufsetze, um zu beeindrucken, und damit hätte sie recht. Aber an meine Töchter zu denken, bringt mich nicht weiter, beschließe ich leichtfertig, als wäre ich Gail.
„Und ich bin Witwe.“
Dieses Mal klingen meine Worte platt, als wären sie nicht sonderlich wichtig. Ich könnte gerade genauso gut bei einem Imbiss einen Grillteller bestellen. Die Art Imbiss, zu dem Jim vor vielen Jahren immer mit mir ging, als wir noch knapp bei Kasse waren.
Unerwartet stehen alle im Raum auf und klatschen. Erst bin ich schockiert und weiche einen Schritt zurück, weil ich es nicht verstehe, doch dann wird mir klar, was sie da tun. In ihren Augen habe ich die Mauer durchbrochen und mir gegenüber mir selbst und anderen endlich eingestanden, dass mein Mann tot ist und nicht mehr zurückkommen wird. Dass ich für immer allein bin.
Aber während ich da so stehe, komme ich nicht umhin, mich zu fragen: Und wenn sie sich irren? Wenn Marcus noch am Leben ist, wie ich es vermute? Was würden sie dann von mir halten? Und wenn sie die Wahrheit darüber wüssten, was ich ihm womöglich angetan habe, würden sie mich an den Pranger stellen. Doch dann denke ich mir, selbst wenn Marcus noch lebt, was soll mich davon abhalten, über ihn zu reden? Denn wenn er nicht tot ist, dann waren all der Schmerz und das Leid der letzten acht Monate umsonst. Alles wird verschwinden, als wäre es nie da gewesen, und ich werde nicht mehr Witwe sein. Oder schuldig. Meine Besuche in dieser Gruppe wird es nicht mehr geben und ich werde nicht mehr dazugehören. Dieser Gedanke zaubert mir ein zittriges Lächeln ins Gesicht und ich sehe diese Frauen in neuem Licht, diesmal mit Mitleid, denn ich bin es, und nicht sie, die Verständnis zeigen sollte.
„Es ist mittlerweile acht Monate her“, sage ich vorsichtig, als würde ich den Text für ein Theaterstück üben, und frage mich dabei, ob Marcus plötzlich den Kopf zur Tür hereinstecken und den Kopf schütteln wird, als wäre alles nur ein Scherz gewesen. „Sieh mich nicht so an, Lindy“, würde er lachend sagen und mich in eine enge Umarmung ziehen. Erst dann würde er sich zu den anderen Frauen umdrehen und auch ihnen gefallen wollen.
Marcus war immer ein großartiger Schauspieler. Ihm hätte es gefallen, Witwer zu sein. Ihm hätte die Rolle viel besser gelegen als mir. Er hätte diesem Publikum imponiert, als wäre es sein letztes, und sie wären ihm alle verfallen. In der darauffolgenden Woche würde er mit Einladungen zum Essen- und Trinkengehen überhäuft werden, jemand würde ihm einen Schal stricken und eine andere Witwe würde ihm einen Kuchen backen, woraufhin er ihr mitteilen würde, dass er nie besseres gegessen hätte. So war Marcus eben.
Ich erinnere mich daran, dass das hier weder eine Seifenoper noch die Marcus Bouchard Show ist, und mich überkommt erneut Nervosität, als mir wieder bewusst wird, dass Marcus wahrscheinlich doch tot ist. Wann immer ich mich daran erinnere, dass ich ihn verloren habe, wird es schlimmer. Zu jedem Morgen gehört beim Aufwachen die betäubende Erkenntnis, dass er nicht mehr da ist. Ich nehme an, dass es jeder Frau hier genauso geht. Selbst die Frau mit haarigen Beinen, großen Leberflecken und schütterem Haar weiß, wie es ist, jemanden zu lieben und zu begehren. Man sollte sich nie vom Aussehen anderer täuschen lassen; ich plumpe, alte Schachtel erst recht nicht.
„So machen wir Witwen das, oder?“, gebe ich zu und atme sichtlich tief ein und aus, damit sie verstehen, was ich da tue. „Uns immer auf den nächsten Angstschub einstellen.“ Ich atme erneut tief ein und spüre mein Zittern bis in die Zehen.
„Aber wie gesagt, ist es erst acht Monate her, dass ich meinen Mann verloren habe.“ Ich frage mich, ob es für diese Frauen eine Rolle spielt, wie lange es her ist, denn wir sitzen schließlich alle im selben Boot. Ich halte die Luft an und mache mich darauf gefasst, dass mir jemand widerspricht und sagt, dass meine acht Monate nichts im Vergleich zu dem sind, was sie gerade nach drei Monaten durchmacht. Ich weiß, dass ich am Abschweifen bin. Das mache ich immer, wenn ich nervös bin. Wie jetzt gerade. Bei dem Gedanken, über meine persönliche Lage zu sprechen. Über Marcus und mich. Als gäbe es noch immer ein „Wir“. Aus irgendeinem Grund, den ich mir selbst nicht erklären kann, hänge ich diesem innerlichen Gedanken ein kleines „ha“ an, doch dann spreche ich es laut aus, als wäre die Aussage wirklich ein Lachen wert. Das ist sie aber natürlich nicht.
Es fällt mir schwer, über das Geschehene zu sprechen, und ich möchte zwar keinen Wettbewerb aus meinem Dasein als Witwe machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anderes so sehr trauert wie ich. Ich will nicht Anführerin des Trauervereins sein, aber es gab nun mal schon immer nur einen Marcus. Man hatte mich allerdings gewarnt, dass die Gruppe für jeden offen ist, der irgendeine Art von Verlust erlitten hat. Nicht nur für diejenigen, die ihren Seelenverwandten verloren haben. Ich könnte quasi gerade jemandem mein Herz ausschütten, der gerade um seinen Hund trauert. Versteh mich jetzt nicht falsch. Ich liebe Hunde, aber das ist nicht dasselbe. Glaub mir. Obwohl mir im Traum nicht einfallen würde, das laut auszusprechen, weil manche Leute heutzutage gegen alles sind.
Wann ist das Leben so politisch korrekt geworden?, frage ich mich. Da ich die letzten dreieinhalb Jahre im Ausland verbracht habe, habe ich nicht bemerkt, wie sich diese ganze Ernsthaftigkeit bei uns Briten eingeschlichen hat. Doch jetzt, wo ich wieder im guten alten Großbritannien bin, ist es deutlicher geworden. Eigentlich Wahnsinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Anscheinend hat das etwas mit Millennials und Snowflakes zu tun, wurde mir gesagt, aber ich gebe nicht einmal vor zu verstehen, was das heißt.
Meine Töchter würden das natürlich verstehen. Rosie ist die Älteste, obwohl man das nicht denken würde, wenn man ihr zuhört. Abby gibt gern den Ton an. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Sicher nicht von mir oder Jim. Das ist wohl eher Gails Einfluss.
Aber es hat keinen Sinn, an die beiden zu denken, wenn sie mich nicht einmal sehen wollen. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, nicht nach meinem Verhalten, aber ich bin Witwe, um Himmels willen, und es würde nicht schaden, mir ein bisschen Mitgefühl zu zeigen. Ich bin immer noch ihre Mutter. Auch wenn ich sie verlassen habe, um ein neues und aufregendes Leben zu führen, in dem kein Platz für sie war. Ich dachte, sie würden sich für mich freuen, als ich mir endlich meinen Traum erfüllte und etwas von der Welt sehen ging – um zu leben, statt nur zu existieren, wozu ich die beiden auch immer ermutigt hatte –, aber da hatte ich mir umsonst Hoffnungen gemacht.
Sie hatten nur Augen dafür, wie sehr ich Jim verletzte – aber das tat ich gar nicht, nicht wirklich – und wie ich die beiden verletzte, indem ich sie im Stich ließ. Aber wenn du deine Kinder nicht zurücklassen kannst, wenn sie erwachsen sind, wann dann?
Mit einem schweren Seufzer setze ich mich auf den blauen Plastikstuhl, den ich mittlerweile als meinen betrachte, weil ich ihn jedes Mal direkt ansteuere, und senke den Kopf, weil ich nicht mehr weiterreden kann. Eine Frau mit Dreadlocks und großen Händen mit braunen Altersflecken klopft mir auf den Rücken und streichelt mir in beruhigenden Kreisen über meinen Pullover. Sue reicht mir indessen, obwohl ich trockene Augen habe, ein Taschentuch, bevor sie wieder ihren Platz in der Mitte von uns einnimmt, um die unangenehme Stille zu füllen. Ich weiß nicht, was danach passiert, denn ich kann nur daran denken, dass der blaue Stuhl dieselbe Farbe hat wie Marcus Augen, und ich wünschte, ich wäre wieder in meiner Wohnung, damit ich meinen Laptop aufklappen und wieder sein Foto anstarren könnte.
Kapitel 4
Hastig ziehe ich meinen klatschnassen Anorak aus und hänge ihn an den einzigen Haken in der ganzen Wohnung. Dann schnappe ich mir meinen klobigen Laptop. Ich nehme ihn mit ins Wohnzimmer, wo es immerhin ein Fenster gibt und eine Aussicht – mehr oder weniger – auf die graue Betonwand der Fisch-and-Chips-Bude gegenüber, die außerdem mein Arbeitsplatz ist. Dort angekommen, lasse ich mich auf den harten Sessel mit dem hässlichen, sonnengelbkarierten Bezug fallen. Sobald ich den Laptop aufklappe, sehe ich, dass er nur noch einundsechzig Prozent Akku hat. So alt wäre Marcus jetzt, hätte er überlebt. Ich bekomme die Website und Marcus den ganzen Tag schon nicht aus dem Kopf. Seine Stimme. Diese Worte. Dieses Bild. Sie folgen mir durch Stamford.
Immer wieder rede ich mir ein, dass ich mich vor allem deshalb bei der Welcome Back-Website angemeldet habe, weil ich mich meiner Trauer nicht mehr so hingeben wollte, aber so langsam bereue ich es. Der Suchverlauf meines Browsers bestätigt, dass ich alles über Verwitwung und Verlust gelesen habe, was ich finden konnte, und abgesehen von fünf Minuten Hoffnung, bin ich direkt wieder in meine übliche trostlose „Das Leben ist vorbei, es hat keinen Sinn, allein weiterzumachen“-Stimmung verfallen. Das war, bevor ich festgestellt habe, dass Kontakt zu Gleichgesinnten aufzusuchen ein Schritt in die richtige Richtung ist. An sich sollte ich es nicht als Datingwebsite nutzen, denn dafür bin ich bei bestem Willen nicht bereit. Das werde ich wahrscheinlich nie sein.
Mir war von Anfang an klar, dass die Seite darauf ausgelegt ist, ältere Leute wieder zueinander zu bringen. Den vielen grauen Haaren und tränenden Augen nach zu urteilen, die bei meinem ersten Log-in aufploppten, habe ich festgestellt, dass die meisten Stammnutzer älter sind als ich: Und ich konnte mich nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht war. Ich hatte die Befürchtung, dass ein siebzigjähriger Rentner und ich nicht auf der gleichen Wellenlänge sein würden. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass wir alle im selben Boot sitzen und ich andere nicht aufgrund ihres Alters diskriminieren sollte. Ich bin selber auch nicht gerade in der Blüte meines Lebens, aber siebenundfünfzig ist auch nicht unbedingt alt. Versuch das heutzutage mal den jungen Leuten zu sagen, die dich abschreiben, sobald du fünfzig bist. Eigentlich wirklich traurig. Aber andererseits erinnere ich mich auch noch daran, dass ich selbst mal eine dieser jungen Leuten war, die sich einbildeten, dass jeder über dreißig, und später vierzig, uralt ist. Aus heutiger Sicht lächerlich.
Die Seite ist einfacher zu bedienen als die meisten anderen, weil sie für eine Altersgruppe ausgerichtet ist, die, wie ich auch, nicht so gut mit Computern umgehen kann. Aber ich komme zurecht, wenn ich muss, und das muss ich auch. Von den Sozialgeldern, auf die ich Anspruch habe, könnte nicht mal ein Hund leben. Deshalb verdiene ich mir in der Frittenbude etwas dazu und der gute alte George, der zugleich mein Vermieter ist, gibt mir meinen Lohn auf die Hand, damit das Geld nicht offiziell registriert ist und ich es also nicht versteuern muss.
Abby, die als Büroleiterin in der Stadt im Arbeitsamt arbeitet, wäre wütend, wenn sie von dieser Vereinbarung wüsste und würde darauf bestehen, dass ich jeden Penny zurückzahle, und mir damit drohen, dass ich sonst im Gefängnis landen könnte. Sie weiß nicht, wie nah sie der Wahrheit kommt, wenn sie solche Sachen sagt. Ich muss nur an jene letzte Nacht am Strand zurückdenken und daran, was ich vielleicht oder vielleicht auch nicht getan habe, und schon weiß ich, was für ein Glück meine Freiheit ist.
Obwohl sie erst dreiundzwanzig ist, ist Abby knallhart, manchmal geradezu brutal, aber auch das hat sie weder von Jim noch von mir. Wir sind beide so mild und sanft wie ein Babypopo. So viel haben wir dann doch gemeinsam. Die gesamte Familie hat Angst vor Abby. Sogar unsere älteste Tochter Rosie, die fünfundzwanzig ist, aber alles mitmacht, was ihre Schwester will, weil es ihr das Leben erleichtert. In dieser Hinsicht ist sie genau wie Jim.
Abby wird bald heiraten, auch wenn ich nicht dabei sein darf. Das hat sie mehr als deutlich gemacht. Mir tut eher ihr zukünftiger Ehemann leid. Er klingt nach einem netten Kerl, laut Gail, aber meine Tochter ist sehr anspruchsvoll und ich bin mir nicht sicher, wie gut er damit zurechtkommen wird. Sie sind allerdings beide ehrgeizig, also ist es durchaus möglich, dass sie sich arrangieren können. Das hoffe ich für sie. Abby ist in ihrem Leben noch nie zurückgewiesen worden. Ich glaube, die Erfahrung würde sie umbringen.
In der Frittenbude gegenüber, in der ich freitags, samstags und montags hinten im Laden die schlechten Stellen von Kartoffeln abschneide und anschließend vorne im Laden hinter der Theke bediene, geht das Licht an. Sofort weiß ich, dass ich mich schuldig fühlen sollte, weil es meine Aufgabe ist, den Imbiss zu öffnen, aber wie immer fühle ich nichts. Nie fühle ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Emotionen. George nutzt eine Maschine, um die Kartoffeln in Form zu schneiden, aber er hat ungern schwarze Stelle in seinen Pommes und da komme ich ins Spiel. Der arme alte Kerl ist selbst Witwer und hat Verständnis für meine Situation, wenn auch nicht so viel, dass er meine Abwesenheit weiterhin tolerieren wird. Ich frage mich, was er sagt, wenn ihm klar wird, dass ich heute Abend nicht auftauchen werde. Schon wieder. Er wird sicher später vorbeikommen, laut klopfen und behaupten, dass er sich Sorgen um mich macht, aber in Wirklichkeit wird er sich darüber ärgern, dass die Kunden schwarze Stücke in ihren Pommes ertragen mussten.
Bis jetzt habe ich so getan, als würde ich heute Abend ganz normal zur Arbeit gehen und den Laptop, die Website und Marcus komplett vergessen, aber insgeheim wusste ich die ganze Zeit über, dass ich mich schon den ganzen Tag selbst belüge.
Anstatt nach dem Gruppentreffen heute Morgen nach Hause zu gehen, bin ich zu der Grundschule gegangen, in der Rosie als Lehrerin arbeitet. Dort stand ich dem Gebäude gegenüber im Regen herum, in der Hoffnung, sie in der Pause auf dem Spielplatz zu sehen, aber entweder war sie heute nicht da oder sie wollte den Regen meiden.
Danach setzte ich mich auf die Mauer vor dem Arbeitsamt. Bei meiner jüngeren Tochter hatte ich mehr Glück und konnte einen Blick auf sie erhaschen. Sie stapfte (Abby geht nie einfach nur) durch eine der charmanten, gepflasterten Seitenstraßen, für die Stamfords Altstadt bekannt ist. Auf ihrem Weg zu einem neuen türkischen Restaurant telefonierte sie und lugte ab und zu unter einem dunkelblauen und weinroten Regenschirm hervor. Sie hielt an, um nicht durchnässt zu werden, als ein Geländewagen durch die Pfützen fuhr, und ich beobachtete, wie sie ihr perfekt gerichtetes, platinblondes Haar verärgert zurückwarf, als ihr ein Regentropfen im Haar landete.
Während ich sie beobachtete, sah sie mich kein einziges Mal. Aber werden Witwen je wahrgenommen? Sind wir nicht unsichtbar? Der Tod tut Menschen das an. Niemand will sich mit uns abgeben, schließlich könnte unser Pech und Elend ansteckend sein. Leute hassen es, an ihre eigene Sterblichkeit erinnert zu werden.
Zum Glück bin ich heute keinem meiner alten Bekanntschaften begegnet, nicht einmal, als ich wie üblich auf der Bank in der Flussaue Platz nahm, die der „Liebsten Ivy“ gewidmet ist, „die hier gerne saß und das Treiben beobachtete“. Ich komme jeden Tag hierher und füttere die Enten und, wenn sie es zulassen, auch die Schwäne. Ich bringe jedes Mal altes Brot mit, obwohl mich eine erzürnte Person mit hochnäsigem Akzent einmal dafür geschimpft hat, dass ich die Tiere damit füttere, weil es wohl schlecht für sie sei.
Als ich der Weltverbesserin mitteilte, dass sich die Enten offensichtlich nicht beschwerten, stapfte sie davon, genau wie Abby es getan hätte, und versprach mir, dass es nicht gut enden würde. Nach dieser Begegnung hielt ich jeden Tag nach der Person Ausschau, aber ich sah sie nie wieder. Daraus konnte ich nur schließen, dass sie nicht die Entenkriegerin ist, als die sich ausgab, und ich fühlte mich enttäuscht, beinahe persönlich getroffen.
Vor ein paar Wochen – ist es schon so lange her? – habe ich Sadie und Rachel im Park gesehen. Sie schoben Enkelkinder in Kinderwagen vor sich hin und waren gekleidet wie Yummy Mummies, mit dem vollen Programm an Lederstiefeln, Wachsjacken und Designerschals, obwohl sie diesen Titel schon lange abgelegt hatten. Ich hatte noch nie viel mit den beiden gemeinsam, denn beide Frauen waren auf das Gymnasium gegangen und hatten Bürojobs. Dennoch verbrachten Gail und ich Zeit mit ihnen – zusammen als Vierergespann und mit unseren jeweiligen besseren Hälften. Jim und ich, Gail und Adam, Sadie und Charles, Rachel und John. Aber die Gruppe begann auseinanderzubrechen, als Adam Gail für eine andere Frau verließ, und dann verließ ich natürlich Jim, und danach war nichts mehr wie vorher.
An jenem Tag sahen mich die beiden eindeutig und ich nahm wahr, wie sie entsetzt zurückschreckten und näher zusammenrückten, bis sie einander beinahe berührten. Sie nahmen die alte Frau wahr, die mit ungewaschenen, zerzausten Haaren, zerknitterten Mum-Jeans und auseinanderfallenden Turnschuhen die Vögel fütterte und zweifellos nach Fett stank, da ich gerade von einer Schicht in der Frittenbude kam. Keine der beiden grüßte mich, wofür ich dankbar war. Was hätte ich sagen sollen? Oh, hi Ladys, ist es nicht schön, mich zu sehen, damit ihr betonen könnt, wie recht ihr hattet und wie falsch ich gelegen habe. Man kann schließlich nicht glücklich werden, indem man andere verletzt, stimmt’s?
Dieses verbitterte Gefühl ist wie Galle. Es bleibt dir im Hals stecken und du willst dich nur noch übergeben, über dich selbst und alle anderen. Also vergrub ich an jenem Tag meinen Kopf in den Händen und ließ sie vorbeigehen, ohne ihnen Schuld zuzuweisen, denn sie hatten nichts falsch gemacht. Im Gegensatz zu mir.
Ich habe den heutigen Tag, wie die meisten anderen auch, damit verbracht, von einem vertrauten Ort zum anderen zu ziehen und unterwegs meine und Jims Kindheit und die frühen Jahre unseres Familienlebens wieder aufleben zu lassen, indem ich die Kirche besuchte, in der wir heirateten, und unser erstes Haus in der Blackfriars Street, in dem Rosie geboren war. Man könnte meinen, dass ich keinen dieser Orte je wiedersehen wollen würde, weil dieser Teil meines Lebens vorbei ist, aber es ist tröstlich. So sehr ich Jim, Rosie und Abby auch verletzt habe, diese Jahre hatten sich sicher angefühlt.