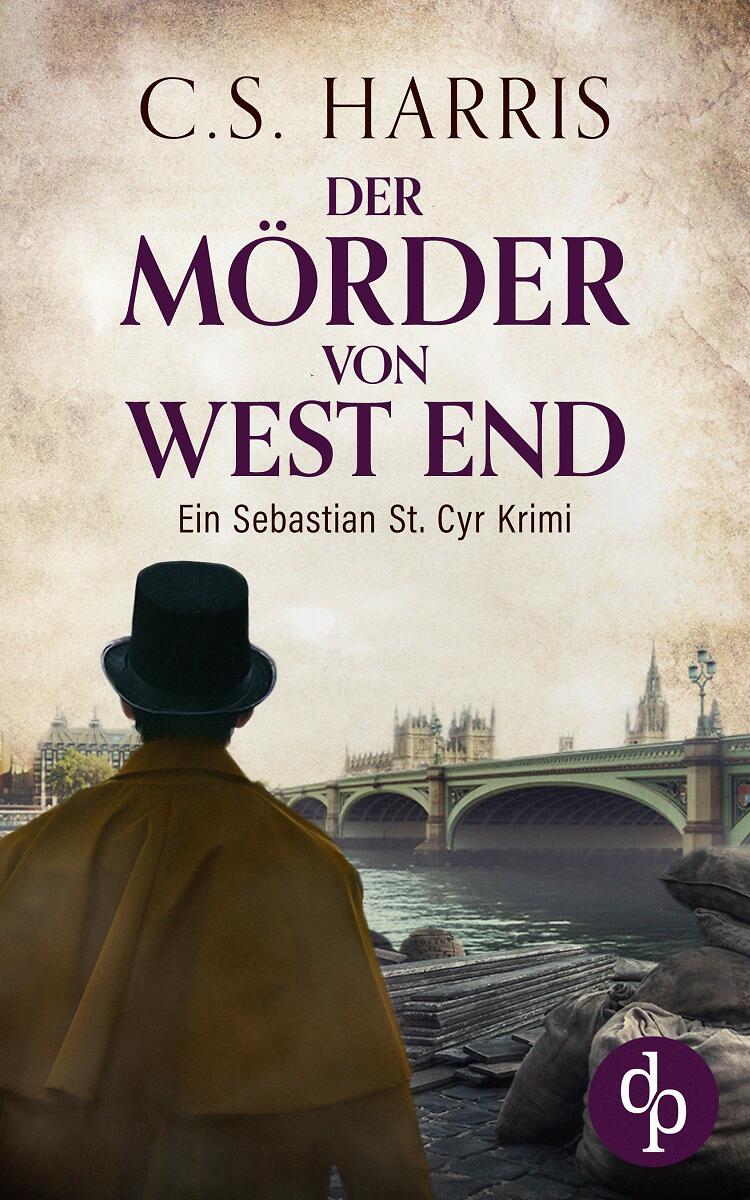Kapitel 1
Samstag, 14. September 1811
Auf der Straße zwischen Merton Abbey und London
Die Angst drehte Dominic Stanton den Magen um und presste seinen Brustkorb zusammen, bis sein Atem nur noch oberflächlich und schnell ging.
Er sagte sich, dass er ein Narr war. Ein Narr und ein Feigling. Er war ein Stanton, verdammt. In weniger als zwei Monaten würde er neunzehn Jahre alt werden. Männer seines Alters – sogar jüngere, viel jüngere – zogen in den Krieg. Und doch war er hier, nur wenige Meilen außerhalb von London, und benahm sich wie ein dummes Dorfmädchen. Jedes Mal, wenn der Donner grollte oder der auffrischende Wind das Eichenlaub über ihm zum Rascheln brachte, pinkelte er sich vor Angst fast in die Hosen.
Ein Wäldchen aus dichtstehenden Eichen und Kastanien umschloss ihn. Dominic trieb seine Stute mit den Knien zu leichtem Galopp an. Die Abenddämmerung würde bald hereinbrechen, aber schon jetzt sorgten die schweren, dichten Wolken und die Undurchdringlichkeit des Gehölzes für schauriges Zwielicht. Über den wehklagenden Wind hinweg konnte er das leise Hufklappern eines Pferds hören, das von irgendwo hinter ihm erklang. Oder bildete er sich das wieder nur ein? Er blickte über die Schulter auf den leeren Pfad, der sich in einer Kurve verlor. »Jesus Christus«, flüsterte er.
Es war die Schuld seiner Mutter, beschloss er für sich. Sie hatte darauf bestanden, dass er rechtzeitig zu ihrer dummen Abendgesellschaft zu Hause sein musste. Ohne ihren Wunsch wäre er mit Charlie und Burlington und dem ganzen Rest noch im Pub. Sie würden die nächste Runde bestellen und immer noch über jeden Hieb und Gegenhieb im Preisboxkampf sprechen, zu dem sie alle nach Merton Abbey geritten waren. Stattdessen war er hier alleine mit seinem Pferd auf der Rückkehr nach London unterwegs, dabei würde gleich ein Sturm losbrechen.
Er redete sich selbst ein, dass er sich nur so sputete, weil er spät dran war, und trieb seine Stute noch mehr zur Eile an … da begann sein Sattel zu rutschen.
Mist. Der dämliche Stallknecht hatte vergessen, den Gurt strammzuziehen.
Dominic zog die Zügel an, sein Antlitz war klebrig von kaltem Schweiß. Er warf einen raschen Blick um sich, dann sprang er aus dem Sattel. Seine Finger zitterten ungeschickt. Er warf den Riemen des Steigbügels zur Seite und fummelte an der Schnalle herum, da hörte er Zaumzeug klappern und Räder rattern, die sich näherten.
Er wirbelte herum, sein Pferd warf den Kopf hoch und tänzelte nervös zur Seite. Ein Pferd und eine Kutsche schälten sich aus der Dunkelheit heraus. »Oh mein Gott«, flüsterte Dominic, als der Fahrer zu ihm aufholte.
Kapitel 2
Sonntag, 15. September 1811, 6:45Uhr
Westminster
Sir Henry Lovejoy, der leitende Untersuchungsrichter am Queen Square in Westminster, stand am Rand des Old Palace Yards. Die Hände tief in den Taschen seines Herrenmantels vergraben, zwang er sich, den verstümmelten Leichnam zu betrachten, der ausgestreckt vor ihm lag.
Dominic Stanton lag auf dem Rücken, die Arme weit ausgebreitet, und seine blickleeren Augen starrten in den trüben Himmel. Tropfen hatten sich wie Perlen in dem hellen, sanft gelockten Haar des Jungen gesammelt, während die Regennässe der vergangenen Nacht tief in den feinen Stoff seines blauen Mantels eingedrungen war und diesen fast schwarz erscheinen ließ. Von den Hüften aufwärts schien der Körper keinerlei Auffälligkeiten aufzuweisen, abgesehen von den Blutspuren auf seinem Halstuch und dem Gegenstand, den man ihm in den Mund gerammt hatte.
Was allerdings mit seinen Beinen geschehen war, entzog sich jeder Beschreibung.
»Um Himmels willen, decken Sie ihn wieder zu«, sagte Lovejoy, dem sich der Magen umdrehte. Der Wachtmeister streckte die Hand nach dem Tuch aus, um es wieder über den Leichnam zu ziehen. »Jawohl, Sir.«
Der frühe Morgennebel, der vom nahegelegenen Fluss heranzog, fühlte sich in Lovejoys Antlitz kühl und feucht an. Lovejoy hob den Blick und starrte die alten, rußgeschwärzten Wände des House of Lords neben sich an.
»Glauben Sie, es war derselbe Mörder, Sir?«
Es war erst drei Monate her, dass sie einen anderen jungen Mann, einen Bankierssohn namens Barclay Carmichael, in St. James’s Park gefunden hatten. Sein Leichnam war auf die nahezu gleiche abscheuliche Weise verstümmelt gewesen. Lovejoy warf seinem stämmigen, rotgesichtigen Wachtmeister einen Blick zu. »Sie wollen nicht ernsthaft die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass zwei solche Killer in London ihr Unwesen treiben, oder?«
Wachtmeister Higgins verlagerte unbehaglich das Gewicht von einem Bein auf das andere. »Nein, Sir. Gewiss nicht.«
Henry Lovejoy ließ den Blick über den Hof schweifen. Sie hatten das Gebiet mit Seilen abgesperrt, um die Mengen neugieriger Gaffer fernzuhalten, die sich bereits in kleinen Grüppchen einfanden. Etwa ein halbes Dutzend Wachtmeister ging in einer langsam vorrückenden Reihe, die Köpfe gebeugt, den Platz ab, um den Boden abzusuchen. Lovejoy erwartete nicht, dass sie irgendetwas finden würden. Sie hatten zuvor, bei Carmichaels Sohn, auch nichts gefunden.
»Sind Sie sicher, dass der Bursche Dominic Stanton ist?«, fragte Lovejoy.
»Scheint so, Sir. In seiner Tasche haben wir eine gravierte Uhr gefunden, und der Hausmeister, der die Leiche entdeckt hat, hat ihn wiedererkannt. Sagte, er ist als kleiner Bub immer mit seinem Paps hergekommen.«
Lovejoy presste die Lippen zusammen. Alfred, Lord Stanton war aktives Mitglied des House of Lords und ein enger Vertrauter des Prinzregenten. Hatten die Dinge schon im Juni, nach dem Mord am jungen Barclay Carmichael, schlimm gestanden, so würde dieses Mal alles noch schlimmer werden.
Der körperlose Klang eines Nebelhorns waberte mit dem Nebel vom Fluss herüber. Lovejoy schauderte zusammen. Es war zwar erst September, aber die Morgen hielten bereits eine Kälte bereit, die den Winter ankündigte.
»Lord Devlin ist da, Sir.«
Lovejoy schwang herum. Ein großer, aristokratisch aussehender Gentleman überquerte den Platz und kam auf sie zu. Seine Beinkleider waren von feinstem Rehleder, sein Herrenmantel unnachahmlich geschneidert und seine Weste von weißer Seide. Doch ein Bartschatten des vergangenen Tages lag auf dem attraktiven, klar und scharf geschnittenen Antlitz, und eine unangenehme Vorahnung befiel Lovejoy. Allem Anschein nach hatte Devlin diese Nacht nicht den Weg in sein eigenes Bett gefunden. Und Lovejoy war keineswegs sicher, wie der junge Viscount auf das reagieren würde, was ihm der Untersuchungsrichter gleich vorschlagen würde.
»Vielen Dank für Euer kommen, Mylord«, sagte Lovejoy, als Devlin heran war. »Ich entschuldige mich für diese gottlose Uhrzeit.«
Sebastian St. Cyr, Viscount Devlin, der Erbe und einzige überlebende Sohn des Earl of Hendon, blickte auf die mit einem Tuch bedeckte Gestalt zu ihren Füßen hinunter, dann wieder auf. »Warum genau bin ich hier?«, fragte er und verengte die Augen, während er die Reihe der langsam vorrückenden Polizisten betrachtete.
Der Mann hatte seltsame, bernsteinfarbene Augen, die Lovejoy selbst jetzt noch, nachdem sie sich fast acht Monate kannten, Unbehagen zu bereiten vermochten. Lovejoy räusperte sich. »Wir haben die ermordete Leiche eines weiteren jungen Gentlemans, Mylord. Er wurde teilweise verstümmelt. Genau wie Barclay Carmichael.«
Die Brauen des Viscounts zogen sich zusammen. »Zeigen Sie her.«
»Ich fürchte, es ist ein grässlicher Anblick, Mylord.«
Devlin ignorierte ihn, ging neben dem Leichnam in die Hocke und zog das Tuch zur Seite.
Ein Anflug von Ekel glitt über die Züge Seiner Lordschaft, aber das war auch schon alles. Lovejoy, der ihn beobachtete, vermutete, dass der Viscount in seinen Jahren im Krieg viele solcher Anblicke – und schlimmere – gesehen haben musste.
Devlins Blick wanderte über den taunassen Mantel zu der Stelle, an der die Kniehosen des Jungen weggeschnitten worden waren. Was von den Beinen des Stanton-Jungen noch übrig war, glich dem, was man in einer Metzgerei zum Kauf dargeboten erwarten würde: gehacktes und rohes Fleisch, die freigelegten Knochen weißschimmernd.
»Carmichaels Körper war auch so zugerichtet?«
Lovejoy förderte ein Schnäuztuch zutage, um sich das Antlitz abzuwischen. »Ja. Nur in Carmichaels Fall waren es die Arme. Nicht die Beine.«
Devlin studierte die weiche Haut im Gesicht des Jungen, das von blonden Locken eingerahmt war. »Wer ist das?«
»Ein junger Mann namens Dominic Stanton. Der älteste Sohn von Alfred, Lord Stanton. Erst achtzehn Jahre alt.«
Devlin nickte. »Ich verstehe immer noch nicht, warum ich hier bin.«
Lovejoy zog die Schultern hoch, um sich gegen die feuchte Kälte zu schützen. Er hatte nicht erwartet, dass diese Angelegenheit einfach würde. »Ich hatte gehofft, Ihr könntet uns vielleicht helfen, zu verstehen, was hier vor sich geht.«
Devlin hielt seinen Blick fest. »Warum ich?«
»Die jungen Männer stammen aus Eurer Welt, Mylord.«
»Und Sie nehmen an, der Killer könnte ebenfalls aus meiner Welt stammen? Wollen Sie das damit sagen?«
»Wir wissen es nicht, Mylord. Der Junge wurde offenbar woanders getötet und dann hierhergebracht.«
»Und das weggeschnittene Fleisch?«
»Wurde nicht aufgefunden, Mylord.«
Devlin blickte über den Platz zur Westminster Abbey, deren Apsis sich aus dem Nebel erhob. Dahinter konnte man nur das alte gedrungene Gemäuer von Westminster Hall ausmachen. »Warum wurde der Körper hier abgelegt, was denken Sie?«
»Es ist ein öffentlicher Ort«, mutmaßte Lovejoy. »Der Täter wollte offensichtlich, dass die Leiche gesehen wird. Und dass sie schnell gefunden wird.«
»Vielleicht. Oder vielleicht wollte er damit eine Art Botschaft hinterlassen.«
Lovejoy kämpfte ein Schaudern nieder. »Eine Botschaft? An wen?«
Vom nebelverhangenen Fluss, der etwa hundert Yard entfernt war, erklang erneut ein Horn, gefolgt vom Gelächter im Nebel verborgener Männer auf einem vorbeifahrenden Kahn. Devlin erhob sich auf die Füße. »Was sagt Lord Stanton über den Aufenthalt seines Sohnes letzte Nacht?«
»Wir haben noch nicht mit Seiner Lordschaft gesprochen.«
Devlin nickte, und seine Stirn krauste sich, als er das entstellte Antlitz des entweihten Körpers vor sich betrachtete. »Was steckt im Mund des Jungen?«
Lovejoy musste sich erneut abwenden und mehrmals schlucken, bevor er antworten konnte. »Wir sind noch nicht sicher, aber es scheint ein abgetrennter Bocksfuß zu sein.«
Kapitel 3
Als er den Hof verließ, ging Sebastian hinter die massiven Steinmauern des House of Lords, wo eine Treppe hinunter zum Ufer der Themse führte. Im stärker werdenden Sonnenschein begannen die Nebel sich zu lichten, und das Wasser lag ruhig und silbern im hellen Morgenlicht.
Er wollte das nicht noch einmal, dachte er, als er oben auf der Treppe innehielt und über den Fluss blickte, auf dem ein Ruderer seine Paddel in langsamen, rhythmischen Schlägen durchzog. Er wollte nicht noch einmal in diesen Sog quälender Emotionen gezogen werden, die das Leben eines Menschen zerstören konnten. Mord schien immer weitere Morde nach sich zu ziehen, und Sebastian war der Morde müde. Des Todes müde.
Er hatte die letzte Nacht in den Armen der Frau verbracht, die er zu seiner Gattin machen wollte, wenn sie ihn nur ließe. Aber das wollte sie nicht, und so hatte er ihr Bett vor dem Sonnenaufgang verlassen. Er war gerade zu Hause in der Brook Street angekommen, als Lovejoys Wachtmeister ihn fand. Nun rieb er sich mit der Hand über das unrasierte Kinn und wünschte sich, er wäre in Kats Bett geblieben.
Er hörte den Untersuchungsrichter Sir Henry, der hinter ihm herkam. »Erzählen Sie mir von dem anderen, von Barclay Carmichael«, sagte Sebastian und hielt seinen Blick auf den Fluss gewandt.
»Seine Leiche wurde ebenfalls am frühen Morgen gefunden«, sagte Sir Henry. »Kopfüber an einem Baum im St. James’s Park hängend. Aber es war offensichtlich, dass er nicht dort getötet worden war.«
»Sie sagen, dass er auch verstümmelt war?«
»Ja. Seine Arme.« Sir Henry blieb in einiger Entfernung am Ufer stehen. »Die Nacht zuvor hatte er mit Freunden verbracht. Er verließ sie beim White’s und sagte, er werde nach Hause gehen. Seinen Freunden zufolge war er leicht angetrunken, aber nicht übermäßig.«
Sebastian blickte den Untersuchungsrichter an. »Das war vor fast drei Monaten. Was haben Sie herausgefunden?«
»Sehr wenig. Keiner erinnert sich, ihn gesehen zu haben, nachdem er das White’s verlassen hatte.« Sir Henry schlug den Mantelkragen hoch, um sich gegen die Brise, die vom Fluss her wehte, zu schützen. »Als wir ihn fanden, war Mister Carmichaels Kehle aufgeschlitzt und sein Körper vollends ausgeblutet. An den Armen war kein Fleisch mehr.«
»Wer hat die Untersuchung der Leiche durchgeführt?«
»Ein Dr. Martin vom St. Thomas. Ich fürchte, er hat uns über das Offensichtliche hinaus kaum etwas sagen können.«
»Sie werden eine Obduktion Stantons anordnen?«
»Natürlich.«
»Schicken Sie ihn am besten zu Paul Gibson im Tower Hill.« Wenn es an Dominic Stantons Leiche irgendwelche Geheimnisse zu entdecken gäbe, würde Paul Gibson sie finden.
Sir Henry nickte.
Sebastian starrte hinunter auf das Wasser der Themse, das gegen die algenbewachsenen Steinstufen unter ihren Füßen schwappte. Der Geruch des Flusses war hier stark. Der Gestank toter Fische vermischte sich mit dem Gestank der Gerbereien am Flussufer. »Sie sagen, Stanton war achtzehn. Wie alt war Mr. Carmichael? Sechsundzwanzig?«
»Siebenundzwanzig.«
»Neun Jahre Unterschied. Ich bezweifle, dass Sie bei den beiden viele Gemeinsamkeiten finden werden.«
»Nicht viele Gemeinsamkeiten, Mylord? Aber … beide waren wohlhabende, junge, aristokratische Männer aus dem West End.«
»Und Sie glauben, dass sie deshalb umgebracht wurden?«
»Ich befürchte, genau das werden die Leute sagen.«
Sebastian hob den Blick zur anderen Seite des Flusses, wo die wuchtigen Umrisse der Barge-Häuser gerade aus dem Nebel auftauchten. Tatsächlich waren die Vermögen beider Familien beträchtlich, aber es gab geringfügige Unterschiede. Denn während die Stantons eine der ältesten Familien Englands waren, war Sir Humphrey Carmichael als einfacher Sohn eines Webers geboren worden.
Sir Henry räusperte sich, und seine Stimme klang angespannt und besorgt. »Darf ich auf Eure Hilfe zählen, Mylord?«
Sebastian sah zu dem Untersuchungsrichter. Er war ein komischer kleiner Mann mit einer glänzenden Glatze, verkniffenen Gesichtszügen und einer fast lächerlich hohen Stimme. Ausgesprochen moralisch, aufrecht und anspruchsvoll, war er zugleich einer der ehrlichsten und engagiertesten Männer, denen Sebastian je begegnet war.
Der Drang, Nein zu sagen, war stark. Doch die Erinnerung an den Tau, der wie Perlen auf den hellen Locken des toten Jungen gelegen hatte, verfolgte ihn. Und die Art von Wiedergutmachung, die Sebastian diesem ernsten kleinen Untersuchungsrichter schuldete, würde er nie wirklich zahlen können.
»Ich werde darüber nachdenken«, sagte Sebastian.
Sir Henry nickte und wandte sich dem Hof zu.
Sebastians Stimme hielt ihn zurück. »Als Sie Barclay Carmichael fanden, hatte er da etwas im Mund?«
Der Magistrat drehte sich wieder um, und sein Adamsapfel bewegte sich sichtbar auf und ab, als er schluckte. »Wir haben tatsächlich etwas gefunden. Allerdings haben wir nie begriffen, was es bedeuten sollte.«
»Was war es?«
Der Mantelsaum des Untersuchungsrichters flatterte in der Brise, die vom Fluss her wehte. »Eine leere Seite, herausgerissen aus einem Schiffslogbuch. Datiert auf den 25. März.«
Kapitel 4
Als Sebastian an seinem Haus in der Brook Street ankam, fand er dort seinen Vater vor, Alistair St. Cyr, den fünften Earl of Hendon, der sich gerade von der Tür abwandte. Hendons eigenes Stadthaus lag am Grosvenor Square. Er suchte das Zuhause seines Sohnes nur selten auf, und niemals ohne einen Anlass.
Der Earl war ein großgewachsener Mann – größer als Sebastian und kräftiger gebaut. Seine Brust glich einem Fass, sein dicker Kopf erinnerte an einen Stier. Sein inzwischen weißes Haar war früher fast so dunkel wie das von Sebastian gewesen. »Nun«, sagte Hendon, und sein Blick wanderte von Sebastians unrasiertem Antlitz zu seinem nicht ganz tadellos geknoteten Halstuch, »ich dachte, ich erwische dich, bevor du ausgehst. Stattdessen sehe ich, dass ich zu früh dran bin. Noch ehe du heimgekommen bist.«
Sebastian spürte, wie seine Lippen in einem widerwilligen Lächeln zuckten. »Willst du mir beim Frühstück Gesellschaft leisten?«, fragte er und ging ins Esszimmer voraus.
»Danke, aber ich habe schon vor Stunden gefrühstückt. Ich nehme jedoch gern etwas Ale.«
Sebastian fing den Blick seines Hausmeiers Morey auf, der sich diskret verbeugte.
»Deine Schwester sagte mir, du hast eine Suche nach deiner Mutter in die Wege geleitet«, sagte Hendon und zog einen Stuhl neben dem Tisch hervor.
Sebastian, der gerade dabei war, mit dem Löffel Eier von dem Tablett auf der Anrichte auf seinen Teller zu heben, hielt inne. »Die gute Amanda. Wie hat sie das nur wieder in Erfahrung gebracht?«
»Dann stimmt es also?«
Sebastian brachte seinen Teller an den Tisch. »Es stimmt.«
Hendon wartete, bis Morey das Bier vor ihm abstellte und sich zurückzog. Dann beugte er sich vor, stützte die Arme auf dem Tisch ab und richtete seinen lebhaften und strengen Blick aus blauen Augen auf Sebastians Antlitz. »Warum, Sebastian? Warum tust du das?«
»Warum? Weil sie meine Mutter ist. Als ich das erste Mal die Wahrheit darüber herausfand, was in jenem Sommer in Brighton geschehen ist, war ich wütend. Auf dich, auf sie. Vielleicht auch auf mich selbst, weil ich all die Lügen geglaubt hatte, die man mir erzählte. Ich bin immer noch wütend. Aber ich habe auch begriffen, dass ich sie gern manches fragen möchte.«
»Aber sie hält sich auf dem Kontinent auf.«
»Und genau dort lasse ich nach ihr suchen.«
Hendons buschige weiße Augenbrauen zogen sich zusammen. »Dort herrscht immer noch Krieg, das weißt du.«
»Ich gebe zu, das ist eine Komplikation, aber kein unüberwindbares Hindernis.«
Hendon grunzte und griff nach seinem Ale. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn war noch nie einfach gewesen, auch vor Kat nicht, oder vor den Enthüllungen vom letzten Juni. Die Ehe des Earl of Hendon und seiner fröhlichen und schönen Countess Sophia hatte vier Kinder hervorgebracht: das älteste Kind, ein Mädchen namens Amanda, und drei Söhne – Richard, Cecil und Sebastian. Von ihnen allen glich der Jüngste, Sebastian, seinem Vater am wenigsten. Doch den größten Teil von Sebastians Kindheit war es der Earl zufrieden gewesen, seinen jüngsten Sohn seiner Wege ziehen zulassen. Er war sich sicher gewesen, dass der eigenartige Junge mit den wilden Augen und einer Leidenschaft für Poesie und Musik niemals in die Lage käme, die Ländereien sowie den hohen Stand, der daran gebunden war, zu erben.
Doch dann hatte der Tod zuerst Richard St. Cyr und danach Cecil geholt, und Sebastian hatte sich in der Rolle des neuen Viscount Devlin wiedergefunden. Es hatte Zeiten gegeben, besonders während des langen, heißen Sommers nach Cecils Tod und Lady Hendons mysteriösem Verschwinden, in denen es schien, als ob Hendon seinen jüngsten Sohn hasste. Als ob er ihn dafür hasste, dass er noch lebte und seine beiden Brüder gestorben waren.
»Deine Tante Henrietta sagte mir, du hättest ihre Einladung zu dem Ball, den sie morgen Abend gibt, abgelehnt«, sagte Hendon. Sein schwerer Kiefer schob sich auf eine Weise vor, die Sebastian verriet, wie kampfbereit sein Vater war.
»Ich hatte bereits zuvor eine Verabredung.«
Hendon lachte höhnisch. »Wo? Im Covent Garden Theatre?«
Sebastian atmete tief ein und aus und ließ den Seitenhieb seines Vaters unbeachtet. »Wenn Tante Henrietta den Wunsch hat, dass ich ihren Ball besuche, dann deshalb, weil irgendeine Bekannte von ihr eine heiratsfähige Tochter hat, die sie mir unbedingt vor die Nase halten will.« Die Bemerkung mochte arrogant klingen, war es jedoch nicht. Sebastian wusste genau, dass ihn, wäre er der jüngste von drei Söhnen, keine ehrgeizige Mutter in London in die Nähe ihrer Tochter ließe.
»Du hast auch jemanden nötig, der dir heiratsfähige junge Damen vor die Nase hält«, sagte Hendon säuerlich. »In einem Monat wirst du neunundzwanzig.«
»Das letzte heiratsfähige Fräulein, das meine liebe Tante mir vorgesetzt hat, war eine Dame, die nichts anderes tat, als endlos über Alcibiades und die Sizilianische Expedition zu schwafeln.«
»Das liegt daran, dass du, als sie dir die Tochter des Duke of Bisley vorstellte, das Mädchen anschließend als hübsche Ente mit mehr Haaren als Verstand bezeichnet hast.« Hendon räusperte sich. »Ich höre, die junge Frau, die Henrietta diesmal im Auge hat, sei ganz anders als das Übliche.«
Sebastian legte seine Gabel hin. »Ich habe bereits eine Frau in meinem Leben, wie du sehr wohl weißt.«
»Ein Mann kann eine Geliebte und eine Gattin haben, um Himmels willen.«
Sebastian begegnete dem grimmigen Blick seines Vaters und hielt ihm stand. »Nicht der Mann, der hier vor dir sitzt.«
Hendon knurrte einen groben Fluch und stieß sich von seinem Stuhl ab. Er war schon fast an der Tür, als Sebastian ihn mit den Worten aufhielt: »Anstatt deine Zeit mit dem Versuch zu vergeuden, eine Gattin für mich zu finden, wünschte ich, du würdest einen neuen Hausdiener für mich suchen.«
Hendon drehte sich um. »Was? Ich dachte, du hättest letzten Sommer einen neuen Mann eingestellt?«
»Das habe ich. Er hat gekündigt.«
»Gekündigt? Warum?«
Sebastian zögerte. In Wirklichkeit hatte der Diener gekündigt, weil er Sebastians ersten Laufburschen und Vertrauten dabei beobachtet hatte, wie der dem zweiten Burschen die Tricks eines Taschendiebs beibrachte. Sebastian hatte nicht vor, das Hendon zu erzählen. Stattdessen sagte er: »Kennst du jemanden?«
»Ich lasse meinen Mann nach einem suchen.«
Nachdem sein Vater gegangen war, versuchte Sebastian, sich wieder seinem Frühstück zu widmen, gab es jedoch bald auf. Er dachte darüber nach, den Stapel von Empfehlungsschreiben für Hausdiener in seiner Bibliothek durchzugehen oder sich vielleicht der überfälligen Korrespondenz zu widmen. Aber er wusste, dass er nichts davon tun würde.
Er würde in die City gehen, um zu hören, was ihm Dr. Paul Gibson über den Tod des jungen Mister Dominic Stanton sagen konnte.