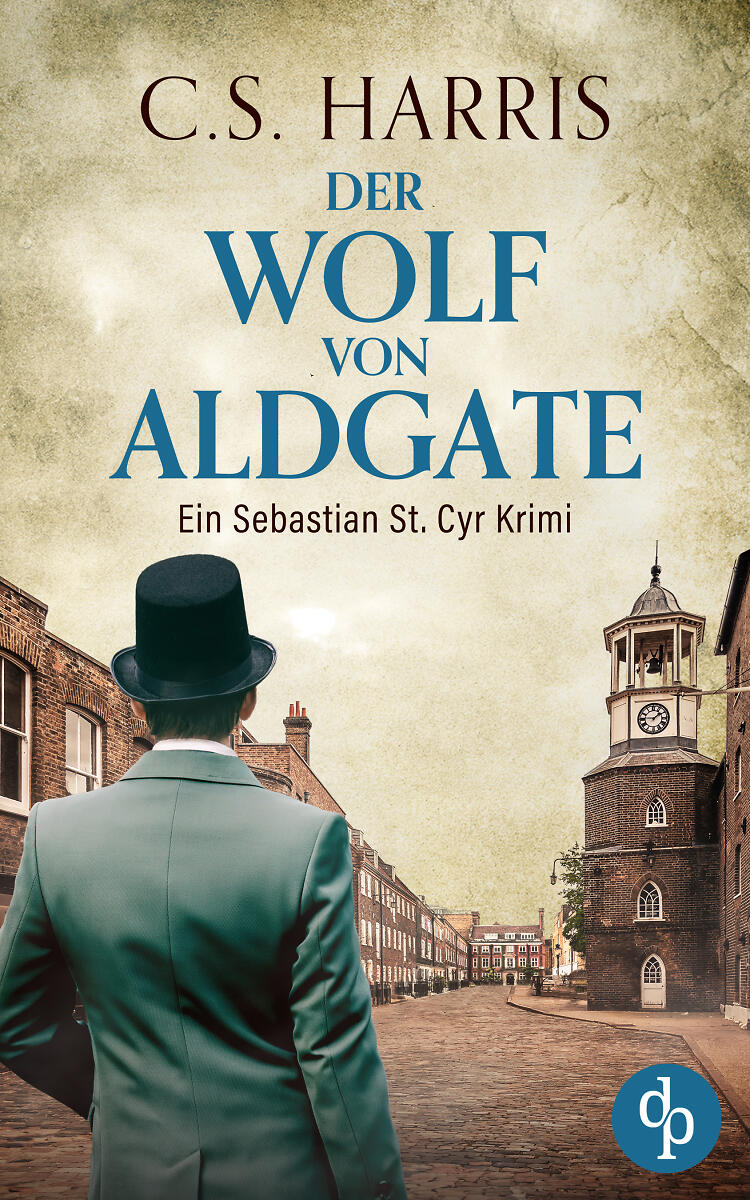Kapitel 1
London, Sonntag, 20. September 1812
Der Greis war so alt, dass all die unzähligen tiefen Falten, die sich in sein Gesicht eingegraben hatten, nach unten strebten. Durch sein dünnes weißes Haar konnte Jenny die rosige Kopfhaut schimmern sehen.
»Darin liegt eine feine Ironie, findest du nicht auch?«, sagte er und fuhr mit einer großen, blauen Glasscherbe, die in tausend Facetten funkelte, die Haut zwischen ihren schwellenden Brüsten entlang. Das Glas fühlte sich auf ihrer nackten Haut glatt und kühl an, aber seine Finger waren so knochig und kalt wie die eines Leichnams.
Sie zwang sich, still liegenzubleiben, obwohl sie nichts mehr wollte, als sich wegzudrehen. Auch wenn sie erst siebzehn Jahre zählte, arbeitete Jenny schon seit fast fünf Jahren in diesem Gewerbe. Sie wusste, wie sie das Lächeln auf ihrem Antlitz festkleben musste, auch wenn in ihr alles dagegen aufbegehrte und sie verzweifelt gern ausrufen würde: Können wir es nicht einfach hinter uns bringen?
»Denk darüber nach.« Er blinzelte, und sie bemerkte, dass seine kleinen, tiefliegenden Augen wimpernlos und seine Zähne so lang und gelb waren, dass sie unwillkürlich an das schäbige Maultier erinnert war, das den Karren des Müllmanns zog. Er sagte: »Einst hat dieser Diamant die Kronen von Königen geziert und am seidigen Busen einer Königin geruht. Und jetzt liegt er hier … zwischen den leicht schmuddeligen Brüsten einer billigen Londoner Hure.«
»Ach, geh weiter«, schnappte sie und äugte auf das hübsche Glas. »Nur weil ich ’ne Hure bin, bin ich noch lang nich blöd. Das is kein Diamant nich. Das Ding is blau. Und größer als n verdammter Pfirsichkern.«
»Viel größer als ein Pfirsichkern«, stimmte ihr der alte Mann zu. Im Glas fing sich das flackernde Licht eines in der Nähe stehenden Kerzenständers, und darin glühte es wie von einem inneren Feuer auf. Seine Augen glitzerten, und Jenny fragte sich nachgerade, wofür er überhaupt ein Freudenmädchen brauchte, da er von seinem Stück Glas angetaner war als von ihr. »Es hieß, dieser Stein war einst das dritte Auge eines Heiden…«
Er unterbrach sich und riss den Kopf hoch, als von der entfernten Eingangstür ein lautes Pochen erklang.
Unwillkürlich wand Jenny sich. Sie lag im gewölbeartigen, schäbigen Salon im Haus des alten Mannes auf einem verstaubten, kratzigen Pferdehaar-Sofa. Die meisten Männer nahmen ihre Nutten in die Hinterzimmer der Kaffeehäuser oder in eines der zahlreichen Unterkunftshäuser der Stadt mit. Dieser Mann nicht. Er hatte seine Huren immer schon hierher gebracht, in dieses alte, von Spinnweben bevölkerte Herrenhaus in St Botolph-Aldgate. Und er nahm sie auch nicht mit nach oben, sondern erledigte seine Geschäfte hier unten auf der Couch – was Jenny durchaus entgegenkam, da sie es schätzte, bei Schwierigkeiten immer schnell die Kurve kratzen zu können.
Er murmelte etwas, das sie nicht verstand, allerdings nahm sie aufgrund der Art, wie er es sagte, an, dass es ein Fluch war. Dann sagte er: »So früh sollte er nicht kommen.«
Er rappelte sich auf und richtete seine Kleidung. Jenny hatte er angewiesen, sich bis auf die Strümpfe und das Unterhemd auszuziehen, das er ihr fast bis zum Bauch aufgeschnürt hatte. Von seiner eigenen Kleidung hatte er nichts abgelegt, nicht einmal den muffig riechenden, altmodischen Mantel oder seine Schuhe. Er sah sich um, die blaue Glasscherbe fest in der einen Hand. »Hier«, sagte er, raffte ihr Korsett, den Unterrock und das Kleid zusammen und warf ihr alles in die Arme. »Nimm die und geh in …«
Es klopfte erneut, lauter dieses Mal, als sie von der Couch glitt und sich die zerknitterte Kleidung an die Brust drückte. »Ich kann raus…«
»Nein.« Er hastete zum altmodischen Kamin, der am einen Ende des Zimmers stand. Es war ein großartiges Gebilde aus rauchgeschwärzten, holzgeschnitzten Säulen mit Verzierungen aus Früchten, Nüssen und sogar Tieren. »Das dauert nicht lang.« Er drückte eine Stelle in dem Schnitzwerk, und Jenny blinzelte überrascht, als ein Teil der Wandverkleidung zur Seite glitt. »Geh einfach hier rein.«
Sie sah ein dunkles Kabuff von vielleicht zwei Quadratmetern Größe, das bis auf einen alten Korb und eine Reihe eisenbeschlagener Truhen, die an einer Wand aufgereiht standen, leer war. »Da rein? Aber …«
Er griff so fest nach ihrem Oberarm, dass sie »Autsch!« ausstieß.
»Halt einfach die Klappe und geh da rein. Wenn du einen Mucks von dir gibst, bekommst du kein Geld. Und wenn du irgendetwas anfasst, kostet es dich den Kragen. Klar?«
Sie nahm an, dass er die Antwort – oder auch nur ihre Angst – in ihrem Gesicht sehen konnte, denn er wartete nicht darauf, dass sie etwas sagte, sondern stieß sie in die kleine Kammer und schloss sie wieder. Sie wirbelte herum und hörte, wie ein Riegel einrastete. Die dichte Schwärze verschluckte sie. Sie unterdrückte einen Aufschrei.
Die Luft in diesem Kabuff war staubig und roch alt, wie der Mann und sein ganzes Haus, nur widerwärtiger. Es war so dunkel, dass sie sich wunderte, wie er auf die bekloppte Idee kam, sie könne etwas stehlen, wenn sie doch nichts sehen konnte als einen winzigen Lichtschimmer ungefähr auf Augenhöhe. Sie ging hin, drückte ein Auge an die Stelle und begriff, dass es ein Guckloch war, das dazu diente, einen guten Blick in den angrenzenden Raum zu gewähren. Sie sah, wie der Mann sein hübsches Glasstück in eine samtverkleidete, lederne Schatulle legte. Dann verstaute er die Schatulle in der Schublade einer Kommode und rief »Ich komme ja schon«, als es wieder an der Tür klopfte.
Jenny atmete zitternd ein. Sie hatte schon von alten Häusern gehört, in denen es verborgene Kammern wie diese gab. Man nannte sie Priesterloch. Sie hatten irgendwas mit den Papisten zu tun oder so, obwohl sie nie ganz begriffen hatte, was es genau damit auf sich hatte. Sie fragte sich, was passieren würde, wenn der alte Bock nicht zurückkäme, um sie wieder rauszulassen. Dann wünschte sie, sie hätte sich diese Frage nicht gestellt, denn nun schienen die Wände näher heranzurücken, und die Schwärze wurde so dicht und bedrückend, dass es sich anfühlte, als würde sie ihr den Atem rauben und das Leben aus ihr heraussaugen. Sie lehnte die Stirn an das Holz und versuchte, kleine Atemzüge zu machen. Sie sagte sich, dass die Papisten, wenn sie ihre Priester in solchen Löchern versteckt gehalten hatten, eine Möglichkeit eingeplant haben mussten, dass man die Verkleidung auch von innen öffnen konnte. Sie begann, nach einem Mechanismus zu tasten, dann erstarrte sie, als sie bemerkte, dass die Stimmen vom Flur her näherkamen.
Sie drückte das Auge wieder ans Guckloch und sah, wie der grässliche alte Kerl zurückkam. Er hatte die Hände komisch seitlich hochgehoben, als wolle er einen Geist oder so etwas abwehren. Dann sah sie die Pistole in den Händen des Besuchers und begriff.
Der alte Kerl redete jetzt ganz schnell. Jenny blieb mucksmäuschenstill, obwohl ihr das Herz in der Brust so wild pochte, dass es an ein Wunder grenzte, wenn die da draußen es nicht hörten.
Dann hörte sie wieder ein Poltern an der Tür, und jemand rief etwas. Der Besucher wirbelte mit der Waffe herum, und der alte Bock stürzte vorwärts.
Ein Schuss löste sich, spuckte Flammen und beißenden Rauch. Der alte Mann strauchelte, dann brach er zusammen.
Jenny spürte, wie es heiß und brennend an ihren Beinen hinunterlief und begriff, dass sie sich gerade nass gemacht hatte.
Kapitel 2
»Aber er sollte mir gehören«, heulte George, Prinzregent von Großbritannien und Irland, und verzerrte die weibisch anmutenden Gesichtszüge vor Wut, während er den marmorgefliesten Raum auf und abschritt. »Was hat sich Eisler bloß dabei gedacht, sich einfach so umbringen zu lassen, bevor er mir die Lieferung zukommen lassen konnte?«
»Empörend unbedacht von dem Mann«, stimmte ihm der mächtige Vetter des Königs, Charles Lord Jarvis, ohne den geringsten verräterischen Hinweis auf Belustigung in der Stimme zu. »Aber nun beruhigt Euch, Eure Hoheit; Ihr wollt doch nicht einen Eurer Krampfanfälle auslösen.« Er fing einen Blick des Leibarztes des Prinzen auf, der sich in der Nähe bereithielt.
Mit einer Verbeugung zog sich der Arzt zurück.
Jarvis’ große Macht beruhte nicht auf seiner Verwandtschaft mit dem König, die nur weitläufig war. Sie beruhte vielmehr auf der einzigartigen Kombination aus hellwacher Intelligenz, unbeugsamer Treue zur Monarchie und deren Fortbestand sowie einer entschlossenen Skrupellosigkeit. Das alles hatte ihn zuerst für George III und dann für den Prinzregenten zu einem unverzichtbaren Mann gemacht. Seit dreißig Jahren agierte Jarvis aus den Schatten heraus und kämpfte darum, den Schaden zu begrenzen, der aus gefährlicher königlicher Schwäche und Unfähigkeit entstand, zu der sich zusätzliche Gefahr aufgrund einer Neigung zu Geisteskrankheit gesellte. Ohne die fähigen Leistungen von Jarvis wäre die britische Monarchie vermutlich den gleichen Weg gegangen wie die französische, und das wussten die Hannoveraner sehr wohl.
»Habt Ihr eine Ahnung, wer hinter diesem Skandal steckt?«, verlangte der Prinz zu wissen.
»Noch nicht, Mylord.«
Sie waren im Rundsaal von Carlton House. George hatte einen musikalischen Abend gegeben, und irgendein Narr hatte in Hörweite des Prinzen gedankenlos ausgeplaudert, dass Daniel Eisler ermordet worden war.
Sie hatten den Saal rasch räumen lassen müssen.
Der Regent durchmaß noch immer den Raum. Seine Bewegungen waren überraschend schnell und energisch für einen Mann seiner Leibesfülle. Früher war er ein gutaussehender Prinz gewesen, beim Volk beliebt und gefeiert, wo auch immer er auftrat. Doch diese Tage waren schon lang passé. Der Prinz von Wales – oder Prinny, wie man ihn oft nannte – war inzwischen fünfzig und aufgrund seines ausschweifenden und verschwendungssüchtigen Lebensstils fettleibig. Die Nation verachtete ihn wegen seiner anwachsenden Schulden, seiner unendlichen, extravaganten Bauvorhaben und seiner zunehmenden Schwäche für teure, juwelenbesetzte Krüge.
»Ich habe Belmont schon den Auftrag erteilt, ein besonderes Stück nur dafür zu entwerfen«, sagte der Prinz. »Und jetzt sagt Ihr mir, der Diamant ist verschwunden? Einfach weg? Wo soll ich einen anderen blauen Diamanten von solcher Größe und Brillanz finden? Sagt mir das. Hm?«
»Wenn der Mörder erst ermittelt ist, wird der Diamant vermutlich auch rasch gefunden«, sagte Jarvis. Gerade betrat der Arzt wieder den Saal, eine kleine Phiole in der Hand. Hinter ihm kam einer von Jarvis’ Männern, ein großer ehemaliger Offizier mit einem Schnauzbart und damit der Typ Mann, mit denen Jarvis sich gern umgab.
»Nun?«, fragte Jarvis ihn.
»Sie haben den Mörder geschnappt«, sagte der Offizier und beugte sich vor, um Jarvis ins Ohr zu flüstern. »Ich glaube, Ihr werdet seine Identität interessant finden.«
»So?« Jarvis hielt den Blick auf den Prinzen gerichtet, der gehorsam den Trank seines Arztes schluckte. »Und warum dies?«
»Es ist Yates. Russell Yates.«
Jarvis legte den Kopf in den Nacken und lachte laut.
***
Jarvis hielt sich ein Duftsäckchen an die Nase, und die Absätze seiner Schuhe klapperten auf den durchgetretenen Steinfliesen, als er den kühlen, schlechtbeleuchteten Gefängnisflur entlangging. Für gewöhnlich ließ er Gefangene in seine Räume im Palast bringen. Aber unter den gegebenen Umständen erschien es ihm reizvoller, diesen speziellen Gefangenen in seiner Zelle aufzusuchen.
Der untersetzte Schließer blieb mit dem schweren Eisenschlüssel in der Hand vor einer nagelbeschlagenen Tür stehen und zog fragend eine Braue hoch.
»Nun, denn, öffnen Sie«, sagte Jarvis und sog den Duft von Nelken und Weinraute ein.
Der Mann schob den Schlüssel in das große Schloss und drehte ihn mit einem Klackern um.
Das schwache Licht einer einzelnen Talgkerze erzeugte tiefe Schatten in der schmalen Zelle. Vor dem vergitterten Fenster drehte sich abrupt ein Mann herum, und seine Ketten klirrten, als der Zug der offenen Tür die Kerzenflamme aufflackern ließ und beinahe löschte. Es war ein junger Mann um die dreißig mit einem starken, muskulösen Körper, und in seinem attraktiven Gesicht erlosch die freudige Erwartung, als er seinen Besucher erblickte.
Jarvis fragte sich, wen der Gefangene erwartet hatte. Vielleicht seine liebende Ehefrau? Der Gedanke brachte ihn zum Lächeln.
Die beiden Männer musterten einander über die Breite der schmalen Kammer hinweg. Dann zog Jarvis eine juwelenbesetzte Schnupftabakdose aus der Tasche. »Wir müssen miteinander sprechen.«
Kapitel 3
Montag, 21. September
Ein düsterer, wolkiger Morgen dämmerte herauf, und die kühle Luft brachte eine frühe Vorahnung bevorstehender Wintertage mit sich. Sebastian St Cyr, Viscount Devlin hielt seine Kutsche am Wendepunkt der Auffahrt an. Die Atemluft seiner eleganten, hochgezüchteten Füchse stieg als weiße Wolken aus ihren Nüstern, als sie schnaubten und die Köpfe hängen ließen. Es war fast sieben Uhr, und sie waren die ganze Nacht unterwegs gewesen.
Sebastian hielt inne und verengte den Blick, um eine Gruppe von Wachtmeistern neben dem Kanalufer zu betrachten. Sie waren im südwestlichen Teil des Hyde Parks, weit weg von den gepflegten und beliebten Reit- und Spazierwegen, die die Bewohner Mayfairs bevorzugten. Hier wuchs das Gras ungehindert, dichtes Unterholz wucherte unter den Baumgruppen, und die wenigen Pfade in diesem Teil waren schmal und kaum benutzt.
Sebastian übergab die Zügel seinem Leibburschen, dem Tiger. Der halbwüchsige Junge namens Tom kletterte von seinem hinteren Kutschbock. »Beweg sie«, sagte Sebastian und sprang leichtfüßig auf die Erde. »Der Wind ist schneidend, und sie sind müde.«
»Aye, Meister.« Die auf Toms bleicher Haut verstreuten Sommersprossen stachen hervor. Sein scharfgeschnittenes Gesicht war von Erschöpfung und unterdrückter Emotion gezeichnet. Er war dreizehn Jahre alt, ein ehemaliger Gossenjunge und Taschendieb, der seit fast zwei Jahren bei Sebastian war. Sie waren Herr und Diener, aber auch mehr als das, weshalb Tom sagte: »Es tut mir leid, was mit Euerm Freund passiert is.«
Sebastian nickte, drehte sich um und schritt durch die Wiese. Seine Hessischen Stiefel hinterließen eine kaum wahrnehmbare Spur heruntergetretenen Grases. Die letzten zehn Stunden hatte er mit der Suche nach seinem vermissten Freund verbracht, einem draufgängerischen, charmanten walisischen Taugenichts namens Major Rhys Wilkinson. Als dessen Ehefrau Sebastian um seine Hilfe bat, hatte er zuerst noch geglaubt, sie reagiere über, und Rhys wäre einfach auf ein Pint irgendwo eingekehrt, auf alte Freunde getroffen und hätte die Zeit vergessen. Aber Annie Wilkinson bestand felsenfest darauf, dass Rhys so etwas nie täte. Je weiter die Nacht in die Morgendämmerung übergegangen war, desto überzeugter war auch Sebastian gewesen, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste.
Als er sich der Eichengruppe am Kanal näherte, unterbrach ein kleiner, bebrillter Mann mittleren Alters, dessen Herrenmantel eher dem tiefsten Winter als einem kühlen Septembermorgen angemessen schien, sein Gespräch mit einem der Wachtmeister und kam zu Sebastian.
»Sir Henry. Danke, dass Sie mich benachrichtigen ließen.«
»Schlechte Nachrichten, fürchte ich«, sagte Sir Henry Lovejoy. Er war vor Kurzem von der Behörde am Queen Square zu einem der drei festangestellten Untersuchungsrichter in die Bow Street berufen worden. Er erfüllte seine Pflichten mit einer Ernsthaftigkeit, die aus persönlichen Tragödien und einer unnachgiebigen, religiösen Weltsicht folgte. Er und Sebastian mochten ein unwahrscheinliches Freundespaar sein, aber Freunde waren sie.
Sebastian blickte an dem Magistraten vorbei. Hinter ihm lag neben einer rustikalen Bank der leblose Körper eines großen, dunkelhaarigen Mannes Anfang dreißig zusammengekrümmt auf der Seite. »Was ist ihm zugestoßen?«
»Unglücklicherweise ist das nicht ohne Weiteres zu erkennen«, sagte Lovejoy, als sie sich dem Leichnam näherten. »Es sind keine Anzeichen von Gewaltanwendung zu erkennen. Er wurde so gefunden: als hätte er sich gesetzt, um auszuruhen, und wäre dann kollabiert. Ich hörte, er ist seit einiger Zeit krank gewesen?«
Sebastian nickte. »Das Walcheren-Fieber. Er hat so lange dagegen angekämpft, wie er konnte, aber am Ende wurde er vom Dienst freigestellt.«
Der Magistrat schnalzte leise mit der Zunge. »Ah, ja, das ist eine schreckliche Sache. Schrecklich.« Der Angriff auf die holländische Insel Walcheren im Jahr 1809 war ein militärisches Debakel gewesen, das die meisten Engländer zu vergessen suchten. Die größte britische Landungsoperation, die bis dahin je durchgeführt worden war, war mit dem ehrgeizigen Ziel aufgebrochen, zunächst Flushing, dann Antwerpen einzunehmen, um sich auf den Einmarsch in Paris vorzubereiten. Stattdessen waren die Besatzer gezwungen gewesen, sich nach nur wenigen Monaten von der Insel zurückzuziehen, und das in den Klauen einer medizinischen Katastrophe. Zuletzt verfielen mehr als ein Viertel der vierzigtausend Mann einem mysteriösen Fieber, von dem sich nur wenige erholten.
Sebastian ging neben der Leiche seines Freundes in die Hocke. Er war dem Mann vor fast zehn Jahren begegnet; sie waren beide Offiziere niederen Dienstgrades gewesen, als Sebastian sein erstes Patent als Fahnenjunker erworben hatte und Wilkinson gerade in den gleichen Rang befördert worden war. Der Sohn eines armen Priesters hatte drei lange Jahre als »Gentleman Volunteer« gedient, bevor ein entsprechender Rang für ihn frei wurde. Wilkinson hatte keinen Hehl aus seinem gutmütigen Zorn gemacht, dass der Wohlstand des jungen Erben des Earls diesen dazu befähigt hatte, stracks in einen Rang zu steigen, um den Wilkinson selbst Jahre hatte kämpfen müssen. Nur langsam hatte Sebastian den Respekt des Älteren gewonnen, und ihre Freundschaft war sogar noch später entstanden. Aber Freunde waren die beiden Männer dann doch geworden.
Wilkinson trug noch den stolzen, schweren Schnäuzer eines Kavallerie-Offiziers. Aber seine Kleidung war die eines Gentlemans, den das Glück verlassen hatte. Die Manschetten seines Hemds waren an den Kanten leicht abgestoßen, und sein Mantel war einmal zu oft gebürstet worden. Früher war er ein strammer Offizier gewesen, von der Sonne gebräunt und das blühende Leben. Doch die Jahre der Krankheit hatten seinen einst starken Körper ausgezehrt und seine Haut trocken und eingefallen werden lassen. Sebastian streckte die Hand aus, um die Wange seines Freundes zu berühren, dann legte er die Hand mit gekrümmten Fingern auf seinen Oberschenkel. »Er ist kalt. Er muss die ganze Nacht hier gelegen haben.«
»So scheint es. Ich hoffe, dass uns Paul Gibson nach der Leichenschau Gewissheit geben kann.«
Wie Sebastian und Wilkinson hatte auch Gibson einst die Farben des Königs getragen. Als Militärarzt hatte er sein Handwerk auf den Schlachtfeldern Europas verfeinert. Niemand konnte besser als er die Geheimnisse eines toten Körpers hervorlocken – ein Grund, weshalb Sebastian Gibson als Letzten wollen würde, seinen Leichnam zu untersuchen.
Sebastian rieb sich mit der Hand über sein stoppeliges Gesicht. »Ist das wirklich nötig? Ich meine, wenn er am Fieber gestorben ist …«
Lovejoy sah etwas überrascht drein. Für gewöhnlich war Sebastian entschiedener Befürworter der neuen und sehr umstrittenen Praxis der Autopsie von Leichen, die einem Mord oder zweifelhaften Tod erlegen waren. »Aber es ist das Beste, um Gewissheit zu erlangen – denkt Ihr nicht auch, Mylord? Obgleich ich nicht bezweifle, dass Ihr Unrecht habt. Wie es aussieht, hat er sich auf die Bank gesetzt, um auszuruhen, und dann irgendeinen Anfall erlitten. Armer Mann. Man fragt sich, was ihn dazu getrieben hat, so weit zu laufen. Und das am Abend, nach dem Abschluss des Parks.«
Sebastian fürchtete, dass er Wilkinsons Gründe, sich nach Stunden in den abgelegensten Teilen des Parks zu verlaufen, nur zu gut kannte. Doch es bestand keine Notwendigkeit, Lovejoy in diese Sorge hineinzuziehen.
Er erhob sich. »Wie nimmt seine Frau es auf?«
Lovejoy räusperte sich unbehaglich. »Nicht gut, fürchte ich. Wie ich hörte, hinterlässt er auch ein Kind?«
»Emma. Sie ist gerade vier geworden.«
»Tragisch.«
»Ja.« Sebastian fühlte sich plötzlich vollends erschöpft und hatte das Bedürfnis, seine eigene Frau in den Armen zu halten und sein Gesicht in ihrem duftenden, dunklen Haar zu bergen. Er war erst seit sechs Wochen verheiratet und hatte die ganze Nacht fern vom Bett seiner Gattin verbracht.
Er nickte dem Magistraten zu und drehte sich zu seinem wartenden Zweispänner um. In den Ulmen sangen lauthals die Lerchen, das Licht wurde stärker, und der Nebel begann sich zu heben. Aber als er die Wiesen durchquerte, bemerkte er eine vertraute Gestalt, die auf ihn zukam. Der Mann trug einen dunklen Zylinder und einen Herrenmantel, der vom morgendlichen Tau glitzerte.
Alistair St Cyr, fünfter Earl of Hendon und Schatzkanzler, war ein großer Mann mit einem fassförmigen Bauch. Mittlerweile Ende sechzig, hatte Hendon sich einst dreier kräftiger Söhne erfreut. Dann hatte sich der Tod den Ältesten, Richard, und den mittleren Sohn, Cecil, geholt und Hendon mit Sebastian, dem Jüngsten, zurückgelassen, der dem Earl am wenigsten ähnelte und ihn anscheinend immer nur verwirrt und enttäuscht hatte.
Tatsächlich war er nicht einmal Hendons Sohn, wenngleich diese Wahrheit erst kürzlich und auf desaströse Art enthüllt worden war.
Sebastian war immer noch der Erbe und, was die Welt anging, auch der Sohn des Earls. Die wenigen, die es besser wussten, hatten ihre Gründe, darüber zu schweigen. Doch seit der schmerzlichen Enthüllung der Wahrheit im Mai hatten Sebastian und Hendon sich in der Öffentlichkeit nur auf formellste und knappste Art gegrüßt. Privat hatten sie überhaupt nicht miteinander gesprochen. Dass Hendon nun nach Sebastian gesucht hatte, konnte nur Schwierigkeiten bedeuten. Unwillkürlich galten Sebastians Gedanken seiner jungen Frau und dem Kind, das sie trug.
»Was ist los? Was ist passiert?«, fragte er ohne Vorrede, als sie aufeinandertrafen.
Hendon rieb sich mit der Fläche seiner dicken Hand über den Kiefer, und erschrocken sah Sebastian, dass der Earl sich, wie er selbst, an diesem Morgen noch nicht rasiert hatte. »Sehe ich es richtig, dass du die Neuigkeiten noch nicht gehört hast?«
»Welche Neuigkeiten?«
»Russel Yates ist nach Newgate überstellt worden, wo er bis zur Verhandlung wegen Mordes inhaftiert ist.«
Sebastian stieß einen langen Atemzug aus und blickte über die im Wind wackelnden Baumwipfel hinweg. Er hatte Yates, einen gutaussehenden und etwas rätselhaften ehemaligen Freibeuter, der Londons Gesellschaft im Sturm erobert hatte, nur flüchtig kennengelernt. Aber Yates’ Frau …
Die schöne, talentierte, quirlige Frau, die mit Yates vermählt war, war einst die Liebe seines Lebens gewesen. So lange, bis Sebastian sie an die gewundene Spur von Hendons Lügen, Halbwahrheiten und vernichtenden Enthüllungen verloren hatte.
»Mord?«, sagte Sebastian. »An wem?«
»Einem Diamantenhändler namens Daniel Eisler.«
»Habe nie von ihm gehört.«
Hendon bewegte den Unterkiefer hin und her wie früher, wenn er über eine Schwierigkeit nachgrübelte oder mit jemandem zu tun hatte, der seinen sorgfältig gesteckten Moralvorstellungen nicht entsprach. »Dann kannst du froh sein. Er war ein übler Zeitgenosse.«
»Hast du Kat gesehen?«
Hendon nickte. »Sie ist sofort zu mir gekommen, in der Hoffnung, ich könnte irgendwie meinen Einfluss nutzen, um zu intervenieren. Aber ich fürchte, dies liegt außerhalb meiner Macht.« Er hielt inne, als müsse er seine nächsten Worte gründlich abwägen. »Ich habe nie vorgegeben, ihre Ehe mit Yates zu begreifen. Aber ich weiß sehr wohl, dass sie im vergangenen Jahr eine große Nähe zu diesem Mann gewonnen hat. Sie macht sich … Sorgen.«
»Kat?« Kat Boleyn war nicht so leicht in Angst zu versetzen.
Hendon sagte: »Mir ist klar, dass ich in letzter Zeit kritisch – vielleicht gar ablehnend – deiner Leidenschaft für Mord und Recht gegenübergestanden habe. Deshalb ist es gewissermaßen heuchlerisch, dich nun um Hilfe zu bitten. Aber soweit ich es einschätzen kann, ist der Fall gegen Yates relativ klar. Irgendwann diese Woche soll eine Leichenschau durchgeführt werden, aber es besteht kein Zweifel, dass die Ergebnisse die Erkenntnisse des Magistraten bestätigen werden.«
»Bist du sicher, dass er es nicht getan hat?«
»Kat besteht darauf, dass er unschuldig ist. Allerdings sieht es so aus, als ob seine einzige Hoffnung, der Schlinge des Henkers zu entgehen, darin besteht, dass du herausfindest, wer der wahre Mörder ist.« Hendon räusperte sich unbehaglich, und seine Stimme klang gepresst. »Wirst du das tun?«
»Für Kat würde ich alles tun, das weißt du.«
Für Kat. Nicht für dich. Die unausgesprochenen Worte hingen zwischen ihnen.
Hendon blinzelte. St Cyr-Augen wurden diese blauen Augen genannt, denn sie waren seit Generationen das Kennzeichen der Familie. Kat hatte die gleichen Augen.
Sebastians Augen waren hingegen von einem eigenartigen, katzenhaften Gelb.
Hendon sagte: »Ich muss klarstellen, dass sie mich nicht darum gebeten hat, dich zu fragen.«
»Warum denn nicht?«
»Das weißt du.«
Sebastian erwiderte den Blick des Earls. Er wusste, dass nicht nur Sebastians kürzlich geschlossene Ehe Kat schockiert hatte, sondern auch die Identität seiner Braut.
Und es tat ihm weh, als er erkannte, dass die Frau, die er schon fast sein gesamtes Erwachsenenleben liebte, das Gefühl hatte, nicht zu ihm kommen zu können, wenn sie ihn am allermeisten brauchte.
Kapitel 4
Russell Yates war einer jener seltenen Männer, die weder die Erwartungen noch die Konventionen ihrer Zeit erfüllten und dennoch ein Leben im Wohlstand führen konnten.
Er war als Sohn eines Adeligen in East Anglia in ein Leben von Wohlstand und Luxus hineingeboren worden. In einer frostigen, schrecklichen Winternacht jedoch hatte sich der kaum vierzehnjährige Yates aus dem von hohen Mauern umgebenen, weitläufigen Anwesen seines Vaters gestohlen, um sich zur See zu verdingen. Fragte man Yates nach dem Grund für diese kühne, aber unleugbar übereilte Tat, so lachte er meist auf und warnte seine Zuhörer davor, leicht zu beeindruckenden jungen Burschen zu viele mitreißende Abenteuergeschichten vorzulesen. Sebastian hegte allerdings schon seit Längerem den Verdacht, dass seine wahren Gründe viel düsterer waren. Gelegentlich glommen sie in den Tiefen der haselnussbraunen Augen auf, wenn Yates scheinbar spöttisch auflachte, wie Gesichte schlimmster Kindheits-Albträume.
Niemand wusste, was in den Jahren, die Yates zur See gefahren war, alles geschehen war. Es gingen geflüsterte Märchen von Schiffswracks, Piraten und Dolchen um, die vom Blut unschuldiger wie böser Menschen besudelt waren. Was mit Sicherheit stimmte, war Yates’ Aufstieg von seinen ärmlichen Anfängen als Kabinenjunge zum Kapitän eines Kaperschiffs, das Frachtschiffe der Feinde Englands zwischen dem spanischen Festland und den Ostindischen Inseln terrorisierte. Als er in die Londoner Gesellschaft zurückkehrte, um seinen Platz wieder einzunehmen, war er ein wohlhabender Mann.
Er erwarb ein eindrucksvolles Anwesen in Mayfair und machte es sich rasch zur Aufgabe, die frömmlerischen Angehörigen der feinen Gesellschaft, des Ton, zu schockieren. Breitschultrig, braungebrannt, das dunkle Haar etwas zu lang und einen goldenen Piratenohrring am linken Ohr, bewegte sich Yates durch Londons Gesellschaft wie ein geschmeidiger Tiger, der auf einer Gartenparty durchs Gebüsch streift. Regelmäßiges, hartes Training in Jackson’s Boxing Salon und Angelos Fechthalle sorgten dafür, dass seine Muskeln definiert blieben, und so strahlte Yates ungebremste Lebenskraft und geradezu aggressive Männlichkeit aus, wie sie unter den gebildeten und manierierten Herren des Ton selten zu finden waren. Die hochnäsigen Nörgler beäugten ihn immer misstrauisch, wohingegen Londons bekannteste Gastgeberinnen ihn liebten. Obgleich von guter Abstammung, war er ganz einzigartig, unglaublich amüsant – und sehr, sehr reich.
Trotzdem fragte sich Sebastian gelegentlich, was Yates nach so vielen Jahren nach London zurück verschlagen hatte. Eine Ruhelosigkeit trieb den Mann um, ein gewisser Leichtsinn, der sich aus Langeweile ebenso wie aus Verzweiflung speiste, und beides erkannte Sebastian wieder – und verstand es. War es auch Langeweile oder doch ein selbstzerstörerischer Drang, der Yates alles aufs Spiel setzen ließ, um unter der Nase der Marine Seiner Königlichen Majestät Rum und auch mal einen französischen Agenten zu schmuggeln? Da war sich Sebastian nie sicher. Doch was auch immer Yates dazu trieb, sich in Schmuggel und Spionage zu betätigen, so fanden seine gefährlichsten Aktivitäten im Boudoir statt. Denn in Wahrheit bevorzugte Londons männlichster, bekanntester Lebemann das sexuelle Vergnügen, das er bei seinem eigenen Geschlecht fand.
Seine Neigung war gefährlicher als das Schmuggeln, da sie sowohl in der Gesellschaft als auch im Gesetz als ein Verbrechen gesehen wurde, das dem des Hochverrats gleichrangig war. Denn in diesem Zeitalter, das sich dem Laster und der Ausschweifung hingab, galt die Liebe zum eigenen Geschlecht noch immer als die ultimative, unverzeihliche Sünde, die nur durch einen grässlichen Tod gesühnt werden konnte.
Die Angst vor diesem Tod – noch gesteigert durch die Feindschaft gegen den mächtigen Vetter des Königs, Lord Jarvis – hatte Yates in eine Zweckehe mit der schönsten, begehrenswertesten und gefragtesten Schauspielerin des Londoner Theaters getrieben: Kat Boleyn, der Frau, die Sebastian geliebt hatte. Und die er verloren hatte.
***
Yates’ Gefängniszelle war klein und kalt, und in der dicken Luft lag der Gestank von Ausdünstungen und Fäulnis. Vom vollen Hof unterhalb des winzigen, vergitterten Zellenfensters stiegen raue Stimmen und Gelächter herauf, aber Yates selbst saß reglos auf dem Rand seiner schmalen Pritsche, hatte die Ellbogen auf den gespreizten Knien abgestützt und barg den Kopf in beiden Händen. Er sah nicht auf, als der Schließer mit klappernden Schlüsseln die Tür öffnete und aufstieß.
»Klopft einfach an die Tür, wenn Ihr mich braucht, Euer Lordschaft«, sagte der Wärter schniefend.
Sebastian schnippte ihm eine Münze zu. »Danke sehr.«
Yates hob den Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch das lange, dunkle Haar, um sie anschließend im Nacken zu verschränken. Der Bartwuchs eines Tages beschattete sein dunkles, attraktives Gesicht; sein Mantel war zerrissen, die Krawatte verschwunden, und seine Hosen und das Hemd waren blut- und dreckverschmiert. Yates war offenbar nicht ohne Gegenwehr hierhergekommen.
»Ach, seid Ihr auch da, um Eure Schadenfreude auszukosten?«, fragte er mit heiserer Stimme.
»Tatsächlich bin ich hier, um zu helfen.«
Ein undeutbarer Ausdruck glitt über das Antlitz des Mannes, dann verbarg er ihn sorgfältig. »Hat Kat Euch gefragt …«
Sebastian schüttelte den Kopf. »Ich habe sie noch nicht gesehen.« Er zog den einzigen Stuhl in der Zelle heran, ein wackliges Ding mit gerader Lehne, das unter seinem Gewicht verdächtig schwankte. »Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Yates lachte bitter auf. »Ihr seid mit der Tochter meines schlimmsten Feindes verheiratet. Nennt mir nur einen guten Grund, Euch zu vertrauen.«
Sebastian zuckte die Achseln und stand auf. »Wie Sie wollen. Wenngleich ich darauf hinweisen möchte, dass Jarvis auch mein größter Feind ist. Nach allem, was ich so höre, und wie die Dinge jetzt liegen, bin ich Ihre einzige Hoffnung.«
Yates erwiderte seinen Blick lange. Dann atmete er mit schmerzverzerrtem Mund aus und beschattete seine Augen mit einer Hand. »Setzt Euch. Bitte.«
Sebastian nahm Platz. »Man sagte mir, Sie wären über Eislers Leiche gebeugt gefunden worden. Stimmt das?«
»Ja. Aber ich schwöre bei Gott, dass er schon tot war, als ich ihn gefunden habe.« Er rieb sich mit beiden Händen über das Gesicht. »Wie viel wisst Ihr über Daniel Eisler?«
»Nicht das geringste bisschen.«
»Er ist – oder ich sollte wohl sagen: war – einer der größten Diamantenhändler Londons. Prinny hat mit ihm Geschäfte gemacht, wie auch die meisten der königlichen Herzöge. Ich hörte einmal, dass er sogar an Napoleon das Diamanthalsband verkauft haben soll, das dieser der Kaiserin Marie Louise zur Hochzeit verehrt hat.«
»Er hat also noch mit den Franzosen Handel getrieben?«
»Aber gewiss. Das tun alle, müsst Ihr wissen. Die Kontinentalsperre und die Erlasse Orders in Council sind kleine Unannehmlichkeiten, mehr nicht.« Der Hauch eines Lächelns glitt über Yates’ Züge. »Das ist der Grund für Gottes Erfindung der Schmuggler.«
»Und an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel, schätze ich?«
Yates nickte. »Die meisten Diamanten, mit denen Eisler handelte, stammten aus Brasilien, aus einem speziellen Arrangement, das er mit den Portugiesen hatte. Aber er arbeitete auch mit Agenten in ganz Europa zusammen, die für ihn Edelsteine aufkauften. Viele ehemals wohlhabende Menschen sehen dem Ruin ins Auge, was bedeutet, dass sie auf jede erdenkliche Art versuchen, zu Geld zu kommen.«
»Und den Familienschmuck zu veräußern, ist eine dieser Arten?«
»Ja.«
Sebastian betrachtete das müde, erschöpfte Gesicht seines Gegenübers. »Was ist letzte Nacht geschehen?«
»Ich fuhr zu Eisler nach Hause, um die Einzelheiten einer bevorstehenden Transaktion zu besprechen. Ich hatte gerade angeklopft, da hörte ich von drinnen einen Pistolenschuss. Die Tür war nicht verschlossen, also schob ich sie auf und bin hineingeeilt, ich Narr!«
»Warum?«
»Was meint Ihr mit warum?«
»Warum haben Sie sich in Gefahr gebracht, auch erschossen zu werden?«
Yates betrachtete ihn mit verengten Augen, seine Kiefermuskeln arbeiteten. »Wenn Ihr auf der Schwelle eines Geschäftspartners stündet und von drinnen ein Schuss hörtet, würdet Ihr dann weglaufen?«
Sebastian lächelte. »Nein.«
»Seht Ihr.«
»Wo waren zu dem Zeitpunkt denn Eislers Bedienstete?«
»Der Kerl war ein Pfennigfuchser. Er hat in einem baufälligen alten Tudor-Haus gewohnt, das über ihm zusammengebrochen ist, und hat nur ein altes Ehepaar beschäftigt, das sich jeden Abend nach dem Dinner ins Bett zurückzog. Campbell heißen sie, glaube ich. Soweit ich weiß, haben sie alles verschlafen. Ich habe sie jedenfalls nicht gesehen.«
»Um welche Uhrzeit hat sich das Ganze abgespielt?«
»Gegen halb neun.«
»Also war es dunkel?«
»Ja. In der Eingangshalle hatte er nur eine mickrige Kerze auf einem Tisch brennen, aber vom Salon rechts der Treppe konnte ich Licht sehen. Dort habe ich ihn auch gefunden, vielleicht zweieinhalb Meter weit im Raum lag er auf dem Boden. Seine Brust war eine blutige Masse, aber ich bin trotzdem zu ihm gegangen, um zu schauen, ob er durch einen glücklichen Zufall überlebt hatte. Ich beugte mich gerade über ihn, da stürmte hinter mir ein Mann herein und heulte los: ›Was haben Sie getan? Großer Gott, Sie haben ihn umgebracht!‹ Ich sagte: ›Was zur Hölle sagen Sie denn da? Ich habe ihn so gefunden.‹ Aber der verfluchte Narr rannte schon raus, brüllte ›Mord‹ und rief nach der Wache. Dann habe ich die zweite dumme Sache an dem Abend gemacht: Anstatt zu bleiben, um dem Constable alles zu erklären, bin ich losgerannt. Mir war nicht klar, dass der Kerl wusste, wer ich war.«
»Und wer war er?«
»Es stellte sich heraus, dass er Eislers Neffe war – ein Mann namens Samuel Perlman.«
Nach einer Weile sagte Yates: »Sieht nicht gut für mich aus, oder?«
Sebastian erwiderte seinen Blick. »Um ehrlich zu sein, nein. Können Sie sich vorstellen, wer Grund gehabt haben könnte, Eisler zu töten?«
Yates lachte. »Meint Ihr das ernst? Es dürfte Euch verdammt schwerfallen, irgendjemanden zu finden, der je mit Eisler Geschäfte gemacht hat, und ihn nicht töten wollte. Er war ein gemeiner, niederträchtiger Scheißkerl, der es noch genoss, vom Pech der anderen zu profitieren. Ehrlich gesagt ist es erstaunlich, dass er überhaupt so alt geworden ist – und ich glaube, das liegt nur daran, dass die Menschen Angst vor ihm hatten.«
»Angst? Weshalb?«
Yates zog eine Schulter hoch und sah weg. »Er hatte einen üblen Ruf und galt als rachsüchtig. Ich sagte ja schon: Er war ein Scheißkerl.«
»Und hatten Sie Grund, ihn zu töten?«
Yates schwieg einen Augenblick und zog die Unterlippe zwischen die Zähne. Dann drehte er den Kopf herum und sah Sebastian in die Augen. Sebastian wusste noch bevor er den Mund öffnete, dass er log. »Nein, hatte ich nicht.«