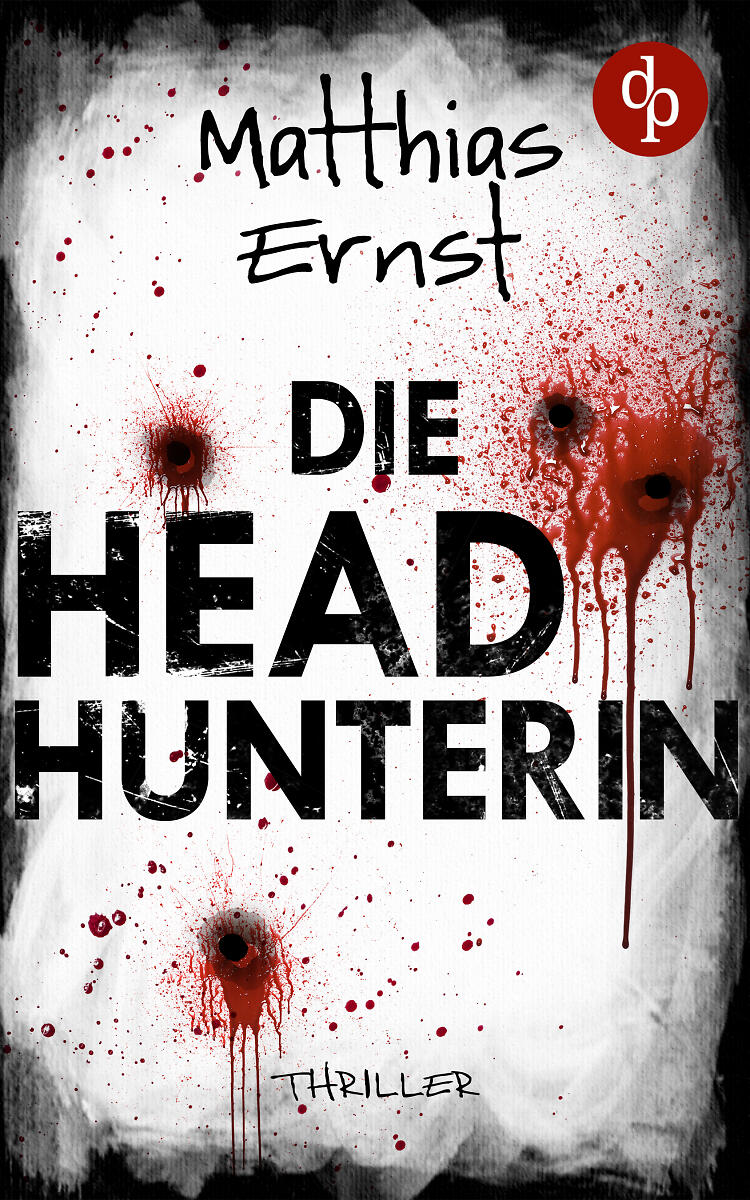Kapitel 1
Der Detective Chief Inspector drückte die Aufnahmetaste des Rekorders auf dem Tisch.
„Mein Name ist DCI Hecker. Heute ist der 30.11.2024. Mit mir anwesend im Raum ist Constable Omar Sharif-Holbrook. Befragt wird Rebecca Williams, geboren am 11.05.1992, verdächtigt der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Verschwörung zu schweren Straftaten und der Behinderung polizeilicher Ermittlungen. Hiermit kläre ich Sie darüber auf, dass Sie sich nicht selbst belasten müssen und dass Sie das Recht auf einen Anwalt haben.“
Omar sah gespannt zu Rebecca. Würde sie sich auf das Verhör einlassen, oder würde sie schweigen und es ihrem Rechtsbeistand überlassen, eine Erklärung für die gewaltigen Schwierigkeiten zu finden, in denen sie sich gerade befand?
Rebecca erwiderte seinen Blick. Ihr nicht zugeschwollenes Auge fixierte ihn kurz, dann wandte sie sich dem DCI zu.
„Wenn ich das richtig verstehe, habe ich das Recht, einen Anruf zu tätigen?“
Ihre Stimme klang stockend und schwer, und ein wenig verwaschen, so als ob sie alkoholisiert wäre. Ob sie sich mit Drogen zugedröhnt hatte, ehe sie zu Tony Bricks in den Ring gestiegen war? Offenbar hatte sie ja an der Quelle gesessen.
„Kennen Sie die Nummer auswendig?“, fragte Omar und schob ihr das Telefon hinüber, das auf dem Tisch stand. Ein altmodischer Apparat, dessen Hörer mittels eines Kabels mit einer Station verbunden war. Sie nickte nur und hob ab. Ihr Zeigefinger zitterte leicht, als sie die Tasten drückte. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis er sie sagen hörte: „Ja, ich bin’s Rebecca. Es ist so weit. Ja, Scotland Yard. Okay.“ Sie legte wieder auf.
„Sie scheinen damit gerechnet zu haben, dass wir Ihnen auf die Schliche kommen würden“, sagte Hecker.
Rebecca lehnte sich zurück und strich eine rotblonde Haarsträhne aus ihrer Stirn, die dort an verkrustetem Blut festgeklebt war. Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, das jedoch gleich darauf zu einer Grimasse des Schmerzes mutierte.
„Wenn mein Rechtsbeistand erst einmal eingetroffen ist, werden Sie sehr enttäuscht sein.“
Aus den Augenwinkeln sah Omar, dass der DCI schmunzelte.
„Alle Achtung“, sagte dieser. „Sie haben Mut … und Sie haben mich neugierig gemacht. Ich wüsste zu gerne, wie Sie sich aus dieser Misere herausreden wollen. Wir haben einen Berg an eindeutigen Beweisen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir beide bezeugen können, wie Sie zugegeben haben, dass Sie für Tony Bricks arbeiten.“
Rebecca winkte ab. „Glauben Sie mir, auf den ersten Blick erscheint manches anders, als es sich in Wirklichkeit darstellt.“
„Gestatten Sie mir eine Frage?“, mischte sich Omar ein. Sie wandte sich wieder ihm zu. Er versuchte, nicht auf die zugeschwollene Hälfte ihres Gesichts zu starren.
„Erinnern Sie sich noch daran, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind?“
Sie nickte und nun erschien so etwas wie ein Schmunzeln auf ihren rissigen Lippen.
„Natürlich, Sie haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.“
„Bereuen Sie Ihre damalige Entscheidung?“, fragte Omar.
Sie sah ihn lange an, dann schüttelte sie den Kopf.
„Nein. Sehen Sie mich doch an. Ich lag richtig. Mehr als richtig.“
Kapitel 2
„Guten Morgen!“, sagte DCI Laurel in einer Lautstärke, die Rebecca Williams zusammenzucken ließ. Sie unterdrückte ein Gähnen, kniff die Augen zu und öffnete sie sofort wieder weit, in der Hoffnung, ein wenig wacher zu werden.
„Ich darf Sie zum dritten und letzten Tag des Trainee-Auswahlprogramms für den gehobenen Dienst bei der Metropolitan Police begrüßen“, fuhr Laurel fort. „Heute steht noch eine weitere Aufgabe an, ehe wir uns beraten und Ihnen mitteilen, wer aus Ihrer Mitte unseren Kriterien entspricht.“
Er nickte Rebecca zu. Sie ließ ihren Blick über die fünf Bewerber und drei Bewerberinnen schweifen. Nur zwei von ihnen würden einen der begehrten Plätze als Trainees ergattern. Sie hatten ausführliche Interviews, Intelligenz- und Persönlichkeitstests sowie knifflige Gruppenaufgaben hinter sich gebracht, die ihre Fähigkeiten erfassen sollten, flexibel auf unerwartet auftretende Probleme zu reagieren.
„Die letzte Herausforderung, die Sie bewältigen müssen, ist ein Rollenspiel“, sagte sie jetzt.
Rebecca rechnete es den Anwesenden hoch an, dass sie nicht laut aufstöhnten oder die Augen verdrehten. Rollenspiele gehörten zu den unbeliebtesten Aufgaben in Assessment-Centern, aber korrekt durchgeführt konnten sie sehr gut geeignete von ungeeigneten Bewerben trennen.
„Bilden Sie einen Halbkreis“, sagte Rebecca. Das Kreischen und Knirschen, als acht Stühle über den Betonboden gezogen wurden, fuhr ihr durch Mark und Bein. Sie winkte CI Capaldi zu. Der Beamte stellte sich neben sie. Er trug eine Markenjeans, die mehr aus Löchern als aus Stoff zu bestehen schien, und ein blütenweißes Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren und einen Blick auf die muskulösen Unterarme des Inspektors erlaubten.
„Ich darf Ihnen Steve Elwood vorstellen“, sagte Rebecca. „Steve dealt mit Drogen. Nicht mit Gras oder mit Ecstasy, bei ihm bekommen Sie das richtig gute Zeug. Er ist auf hochwertiges Kokain und LSD spezialisiert. Aber seien Sie gewarnt, Steve ist wählerisch, was seine Kundschaft angeht. Ihre Aufgabe besteht darin, ihn zu einem Geschäft zu bewegen. Wie Sie das anstellen, bleibt Ihnen überlassen. Constable Marston, Sie beginnen.“
Sie nickte dem Bewerber zu, der am linken Rand des Halbkreises saß. Constable Marston war hochgewachsen und schlank. Ein gepflegter Schnurrbart schmückte sein kantiges Gesicht. Seine braunen Augen musterten CI Capaldi aka Steve Elwood aufmerksam. Mit demselben Blick hatte er auch Rebecca gescannt, als sie einen Intelligenztest mit ihm durchgeführt hatte. Mit einem IQ von 124 hatte das Ergebnis klar im überdurchschnittlichen Bereich gelegen. Ebenfalls extrem waren allerdings die Werte in den Persönlichkeitstests ausgefallen, insbesondere der niedrige Score auf der Skala Verträglichkeit, der darauf hindeutete, dass Marston ein eher unbequemer Zeitgenosse war. Rebecca war gespannt, wie er sich in einer Situation schlagen würde, die ein hohes Maß an Empathie und Menschenkenntnis erforderte.
Der Bewerber trat auf Steve Elwood zu.
„Guten Abend“, sagte er, stellte sich neben den Dealer und holte ein Päckchen Zigaretten aus seiner Brusttasche hervor. Er bot seinem Gegenüber eine an, die dieser jedoch dankend ablehnte. Marston zündete sich eine Kippe an, nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch langsam aus den Nasenlöchern.
Ob er es genoss, die Regel zu brechen, dass in öffentlichen Gebäuden nicht geraucht werden durfte?
Rebecca notierte sich diese Frage auf ihrem Beobachtungsformular.
„Ich habe schon viel von Ihnen gehört“, sagte Marston zu Elwood. Dieser zog eine Augenbraue nach oben, übertrieb dabei aber, sodass es unfreiwillig komisch wirkte. Rebecca kniff die Lippen zusammen. Das war das Problem mit Laiendarstellern. Sie neigten zum Overacting. Leider war der Metropolitan Police das Auswahlverfahren nicht so viel wert gewesen, dass sie professionelle Schauspieler hatten engagieren können.
„Ich hoffe, nur Gutes“, sagte Elwood.
Marston schmunzelte. „Es heißt, dass ich bei Ihnen an der richtigen Adresse bin, wenn ich auf der Suche nach dem wirklich guten Stoff bin.“
Rebecca hob das Klemmbrett und erneut huschte ihr Stift über den Protokollbogen. Der Bewerber wählte die direkte Route. Nun, da würde er rasch auf Hindernisse stoßen.
„Was meinen Sie damit?“, fragte Elwood.
„Kommen Sie schon. Mir brauchen Sie nichts vorzuspielen. Sie haben das, was ich möchte, und ich habe Bares. Eine Menge davon. Da lässt sich doch sicher etwas arrangieren.“
Elwood trat einen Schritt beiseite und ließ seinen Blick von Marstons Schuhen bis hoch zu seinem Gesicht wandern.
„Mal abgesehen davon, dass Sie nicht wie jemand aussehen, der über erhebliche Geldmittel verfügt … können Sie mir verraten, was ich haben sollte, das Sie möchten? Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, wovon Sie reden.“
Das Schmunzeln verschwand von Marstons Lippen. Nun wurde es spannend. Da war das Hindernis. Würde er seine Strategie anpassen?
„Okay, dann reden wir mal Klartext“, sagte er daraufhin. „Ich habe tausend Pfund, die ich in reines Kokain investieren möchte.“
Nun war es Elwood, der schmunzelte. „Tausend Pfund? Hatten Sie nicht behauptet, dass Sie über eine Menge Bares verfügen würden? Für einen Tausender mache ich mir nicht die Hände schmutzig.“
Auf Marstons Wangen bildeten sich dunkelrote Flecken. Sein Brustkorb hob und senkte sich schneller als zuvor. Eine emotionale Reaktion. Würde er diese in den Griff bekommen? Der Bewerber atmete schwer, und seine rechte Hand zitterte ein wenig. Er öffnete gerade den Mund, als ein Glöckchen ertönte.
„Die Zeit ist um“, sagte DCI Laurel.
„Aber ich war noch nicht fertig“, protestierte Marston.
„Wir haben genug gesehen“, erwiderte Laurel. „Der Nächste bitte.“
Marston ließ die halb gerauchte Zigarette auf den Boden fallen und drückte sie aus. Dann nahm er Platz, verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte den DCI wütend an. Sein Nachbar erhob sich. Er war gut einen Kopf kleiner und sein rundes Gesicht strahlte eine frische Jugendlichkeit aus. Dafür war sein glänzend schwarzer Schnurrbart größer und eindrucksvoller als der seines Vorgängers.
„Constable Sharif-Holbrook“, sagte Rebecca. „Auch Ihre Aufgabe ist es, Steve Elwood dazu zu bewegen, Ihnen Drogen zu verkaufen.“
Sie sah, dass der Adamsapfel des Bewerbers nervös auf und ab hüpfte. Er zwirbelte sich die Schnurrbartspitzen und trat auf den Laiendarsteller zu. Während der wenigen Meter, die er dabei zurücklegte, verwandelte sich seine Körperhaltung extrem. Er schob die Hände in die Hosentaschen und wippte mit den Schultern im Takt des Liedes hin und her, das er leise vor sich hin pfiff. Rebecca kannte die Melodie, der Titel des Stücks wollte ihr aber partout nicht einfallen.
Wie Marston zuvor stellte sich auch Sharif-Holbrook neben den Dealer. Er sprach ihn jedoch nicht sofort an, sondern pfiff fröhlich weiter. Was war das für ein Song? Es ärgerte Rebecca, dass sie nicht darauf kam.
„Was pfeifen Sie denn da?“, fragte Elwood, dem es ähnlich zu ergehen schien.
„Ach, nur was von den Beatles.“
„Lucy in the Sky with diamonds“, sagte Elwood.
„Ah, ein Kenner“, erwiderte Sharif-Holbrook.
Der Dealer nickte. „Das war noch Musik“, erwiderte er.
„Das können Sie laut sagen. So etwas wird es nie wieder geben.“
„Oasis waren nah dran“, gab Elwood zu bedenken.
Sharif-Holbrook verzog das Gesicht.
„Ist das Ihr Ernst? Die Gallaghers haben oft genug behauptet, Lennon und McCartney das Wasser reichen zu können, aber nah dran waren sie nie. Der Alkohol stand ihnen immer im Weg.“
Elwood zuckte mit den Achseln. „Das Problem hatten die Beatles nicht.“
„Die haben sich anderweitig berauscht. Wussten Sie, dass Lucy in the Sky with Diamonds einen LSD-Trip beschreibt?“
„Tatsächlich?“, fragte Elwood.
„Ja. Also, das wird zumindest gemunkelt. Leider kann man John Lennon ja nicht mehr fragen, ob das stimmt. Das muss schon ein Wahnsinnserlebnis sein, so ein LSD-Rausch, wenn so ein großartiger Song dabei herauskommt.“
Rebecca fertigte eifrig Notizen an. Der Bewerber war clever vorgegangen. Er hatte auf eine zwanglose Weise Kontakt aufgenommen und den Dealer in eine Unterhaltung verwickelt, deren zunächst unverfängliche Inhalte dessen Interesse geweckt hatten. Nun lenkte er auf den eigentlichen Zweck des Gesprächs um.
„Haben Sie schon einmal LSD genommen?“, fragte Elwood.
Sharif-Holbrook winkte ab. „Nein, ich bin ein viel zu großer Angsthase. Ich habe gehört, dass nicht jeder Trip in einem meisterhaften Kunstwerk enden soll. Manche Leute bleiben hängen und kommen gar nicht mehr in der Realität an. Denken Sie nur an Syd Barret, den früheren Sänger von Pink Floyd.“
Elwood schüttelte den Kopf. „Der hatte größere Probleme als einen endlosen Horrortrip. Es kommt nur darauf an, den richtigen Stoff einzuwerfen, dann ist das Ganze so sicher wie ein Glas spanischer Rotwein. Ich habe gelesen, dass Psychiater LSD inzwischen sogar schon zur Therapie von Depressionen einsetzen, und das kann ich absolut nachvollziehen.“
Rebecca unterdrückte ein Lächeln. Anerkennend notierte sie, dass es dem Bewerber gelungen war, die Rollen zu vertauschen. Nun war es nicht mehr er, der den Dealer darum anbetteln musste, ihm Drogen zu verkaufen. Stattdessen warb Elwood für seine Ware. Das Glöckchen läutete wieder.
„Und fertig“, sagte DCI Laurel. „Die Nächste bitte.“
Kein Einziger der verbliebenen sechs Kandidaten schaffte es, den Laiendarsteller so weit zu bringen, dass er einem konkreten Geschäft zugestimmt hätte. Aber darum ging es auch gar nicht.
Als die letzte Bewerberin ihr Rollenspiel beendet hatte, sagte DCI Laurel: „Sie können nun wieder im Wartebereich Platz nehmen. Wir besprechen uns und werden Sie dann einzeln zu uns rufen, um Ihnen mitzuteilen, ob Sie es in das Trainee-Programm geschafft haben.“
Erneut kratzten Stühle über den Boden, aber Rebecca war inzwischen so wach, dass es ihr nicht mehr durch Mark und Bein drang. Sie nahm ihr Klemmbrett und folgte DCI Laurel in das Besprechungszimmer.
Kapitel 3
Der Rauch kitzelte Omar in den Nebenhöhlen. Er räusperte sich und kniff sich in die Nasenspitze, um nicht niesen zu müssen.
„Das ist eine Farce“, knurrte Marston und zog so fest an seiner gerade erst entzündeten Zigarette, dass diese beinahe bis zur Hälfte verglühte. „Als ob die uns irgendwann einmal losschicken würden, um bei einem Edel-Dealer zwei Kilo Koks zu kaufen.“
„Ich schätze, das werden wir herausfinden, wenn wir das Trainee-Programm durchlaufen.“
Marston winkte ab. „Die werden uns nicht nehmen.“
Omar runzelte die Stirn. „Warum denn nicht?“
„Wegen der Frauenquote ist einer der Plätze schon geblockt. Bleibt also noch einer übrig. Ich bin denen zu geradeheraus. Ist so ein Zug von mir. Kann ich nichts dagegen tun. Leider ist das nicht förderlich, wenn man bei Scotland Yard Karriere machen will. Da kann man noch so begabt sein. Ehrlich seine Meinung zu sagen, ist anscheinend ein No-Go. Genauso wie deine Hautfarbe. Sorry, ich weiß, dass man das nicht sagen sollte, aber es ist leider so. Schau dir doch mal die Führungsriege der Met an. Die sind alle blütenweiß.“
„Das wird sich ändern“, sagte Omar, „und einen Leitungsposten will ich ja gar nicht. Mir reicht der gehobene Dienst.“
„Constable Marston?“
Die Psychologin stand in der Tür.
„Ich komme schon“, erwiderte Marston. Er drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und folgte ihr. Omar blieb sitzen, obwohl inzwischen ein leichter Nieselregen eingesetzt hatte. Der letzte Rest des Zigarettenqualms verflüchtigte sich. Er atmete tief ein und aus.
Ob sein Mitbewerber recht hatte? Hatten sie wirklich keine Aussichten auf die Traineestelle? Marstons Chancen waren wohl tatsächlich gering. Omar hatte zwar wenig Ahnung von Personalauswahlverfahren, aber dass der Constable sich mit seiner ruppigen Art nicht so präsentiert hatte, wie man es von den Bewerbern erwartete, war trotzdem offensichtlich. Aber wie hatte er selbst abgeschnitten? Reichte es aus, um DCI Laurel und die Psychologin dazu zu bewegen, einen Jungen aus dem East End, dessen aus dem Punjab stammende Familie seit nunmehr drei Generationen in England lebte, in den gehobenen Polizeidienst vorrücken zu lassen?
Der Nieselregen wurde stärker. Omar kehrte in den Vorraum zurück, wo die anderen Bewerber auf die Entscheidung warteten. Eine blonde Frau kaute an ihren Fingernägeln. Soweit er es beurteilen konnte, hatte sie sich sehr gut geschlagen, vor allem bei der Aufgabe, in der sie gemeinsam einen möglichst hohen Turm hatten bauen sollen. Die Tür, hinter der die Psychologin und DCI Laurel die Urteile verkündeten, schwang auf und Marston trat heraus. Omar sah auf den ersten Blick, dass dieser eine Absage kassiert hatte. Seine Kiefer mahlte und seine rechte Hand zitterte heftig.
„Vollidioten“, zischte er, als er die Tür mit einem gewaltigen Knall zuschlug und ohne ein weiteres Wort an ihnen vorbei rauschte. Die Tür öffnete sich wieder und die Psychologin sah heraus. Eine rotblonde Strähne hing ihr über die Stirn. Ihr schweifender Blick fand nun Omar.
„Constable Sharif-Holbrook?“
Er schloss für einen Moment die Augen und atmete tief ein, dann ging er auf die Tür zu. Er kannte das Büro schon vom ersten Tag des Auswahlverfahrens her. Hier hatte Mrs. Williams ihn getestet. Er hatte mehrere Fragebögen ausfüllen und logische Aufgaben bewältigen müssen, die zusehends schwieriger geworden waren. DCI Laurel bot ihm einen Platz an und er setzte sich. Sein Blick blieb an den buschigen Augenbrauen des hochrangigen Polizisten hängen. Sie waren wohl mal schwarz gewesen. Nicht so schwarz wie Omars Schnurrbart, aber doch satt schwarz. Nun waren sie grau und an manchen Stellen sogar weiß.
„Wie schätzen Sie Ihre Leistung ein?“, fragte Laurel und riss Omar aus seinen Gedanken.
Er entschloss sich für eine offene und ehrliche Antwort. „Ich kann es schwer einschätzen. Die Fragebögen habe ich ausgefüllt, ohne viel darüber nachzudenken. Bei diesen Denksportaufgaben habe ich wohl einiges richtig, und die Gruppenübungen fand ich spannend. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was Sie daraus machen.“
Er sah, dass die Psychologin schmunzelte. „Dann fangen wir mal mit den Fragebögen an“, sagte sie. „Ihr Antwortmuster deutet darauf hin, dass Sie eine emotional stabile, offene, verträgliche, gewissenhafte Person sind, die nicht zu extravertiert aber auch nicht zu introvertiert ist.“
„Ich dachte immer, es heißt extrovertiert“, sagte Omar.
Das Schmunzeln verbreiterte sich zu einem Lächeln. „Ja, das hat sich leider eingebürgert. Ursprünglich geht die Unterscheidung zwischen Extra- und Introversion auf C. G. Jung zurück. Dieser war in klassischen Sprachen wie Altgriechisch und Latein ebenso gut bewandert wie in Philosophie, Kunst und Literatur. Versuchen Sie einmal, die beiden Wörter auszusprechen. Bei Extraversion öffnet sich der Mund weit, bei Introversion hingegen wird der Luftstrom zurückgehalten. Diese Lautmalerei unterstreicht sehr schön, worum es bei den jeweiligen Konzepten geht.“
„Die nach außen gewandte Rampensau und das zurückhaltende, verinnerlichte Mauerblümchen?“
„Ganz genau. Deshalb finde ich es bedauernswert, dass dieses poetische Detail verloren geht, wenn man aus Bequemlichkeit das a durch ein o ersetzt.“
„Ich werde es mir merken“, sagte Omar und lächelte die Psychologin an.
„Können wir vielleicht wieder zum Thema zurückfinden?“, fragte DCI Laurel brummend.
Sie räusperte sich und fuhr fort: „Bei dem kognitiven Leistungstest haben Sie einen IQ-Wert von 132 erzielt mit besonderen Stärken in den Bereichen logisches Denken, Arbeitsgedächtnis und räumliches Vorstellungsvermögen.“
„132?“, sagte Omar. „Wow.“
Die Psychologin lächelte. „Wichtiger als der Wert ist, was Sie praktisch mit Ihrer Intelligenz anstellen“, erklärte sie. „Das bringt uns zu den Gruppenaufgaben. Ihre Selbstvorstellung war originell und auf den Punkt. Bei der Aufgabe, in der es darum ging, einen Turm zu bauen, haben Sie die anderen unterstützt, ohne sich je in den Vordergrund zu drängen. Und Ihre Kontaktaufnahme mit dem Drogendealer war ein Paradebeispiel dafür, wie man in kürzester Zeit Sympathie bei seinem Gegenüber weckt.“
Omars Herz schlug schneller. Er hatte nicht mit so viel Lob gerechnet. „Das … das klingt gut“, sagte er.
„Warum haben Sie sich für die Traineestelle beworben?“, fragte DCI Laurel.
Omar schluckte. Was sollte das denn jetzt? Diese Frage hatte er doch schon mindestens drei Mal beantwortet.
„Ich war gerne Streifenpolizist“, sagte er. „London ist eine großartige Stadt. Ich habe es geliebt, in Wandsworth unterwegs zu sein, mit den Leuten zu sprechen, Probleme zu lösen und der Gerechtigkeit unter die Arme zu greifen. Doch in letzter Zeit hatte ich immer häufiger das Gefühl, dass ich noch mehr leisten könnte, wenn ich an der richtigen Position sitzen würde.“
„Hat das etwas mit dem Fall des Putney Slashers zu tun?“, fragte Laurel.
Omar spürte, wie sein Mund austrocknete. „Daran war ich nur am Rande beteiligt“, sagte er.
„Und doch hat Ihre ehemalige Vorgesetzte, DCI Jenner, Sie in ihrem Abschlussbericht mehr als nur lobend erwähnt. Ist es das? Haben Sie Feuer gefangen? Wollen Sie Serienkiller zur Strecke bringen?“
Omar atmete tief durch. „Wenn Sie so direkt fragen … ja!“
Laurel lehnte sich zurück. „Ihnen ist schon klar, dass das Durchlaufen unseres Traineeprogramms nicht bedeutet, dass Sie automatisch bei einem Sonderdezernat landen, das öffentlichkeitswirksam Mordfälle aufklärt? Sie werden alle Abteilungen kennenlernen und am Ende werden wir Ihnen eine Stelle anbieten. Das kann bei der Mordkommission sein, oder beim Drogendezernat oder bei der IT. Wir könnten Sie auf die Straße schicken, oder an einen Schreibtisch in einem fensterlosen Büro im Keller von Scotland Yard, sodass Sie im Winter wochenlang keine Sonne mehr sehen werden. Ist Ihnen das bewusst?“
Omar erwiderte den Blick des DCI. „Ja, das ist mir bewusst.“
„Und Sie wollen trotzdem in das Traineeprogramm einstiegen?“
„Warum hätte ich mich sonst bewerben sollen?“
Laurels Stirn legte sich in Falten. „Ich will offen mit Ihnen sein“, sagte er. „Mrs. Williams, unsere externe Beraterin hier, scheint einen Narren an Ihnen gefressen zu haben. Sie will mich dazu bewegen, Ihnen eine der beiden freien Stellen zu geben. Ihre Testergebnisse sind hervorragend und auch die praktischen Aufgaben haben Sie problemlos gemeistert. Das stimmt, da gebe ich ihr vollkommen recht. Aber was, wenn ich Sie einstelle, und Sie kündigen nach zwei Jahren, weil Sie sich bei dem Schreibtischjob, den wir Ihnen anbieten, zu Tode langweilen?“
Omar lehnte sich zurück. Er zwirbelte die Spitzen seines Schnurrbartes. „Nun, das ist Ihr Risiko, Sir“, sagte er.
Laurel kniff die Augen zusammen. „Wie bitte?“
„Ich will Mrs. Williams ihre Kompetenz nicht absprechen, aber sie kann nicht in die Zukunft sehen. Was in zwei Jahren sein wird, weiß keiner von uns. In letzter Zeit sind auf dieser Welt Dinge passiert, die sich niemand auch nur im Ansatz hätte vorstellen können. Natürlich könnte ich eine Fehlbesetzung für die Stelle sein, die Sie mir anbieten wollen. Aber ich kann Ihnen versichern, an meinem Willen, Leistung zu erbringen und Aufgaben zu bewältigen, gleichgültig, worum es sich dabei handelt, wird es nicht liegen.“
Laurel verzog das Gesicht. Er wirkte noch immer nicht überzeugt.
„Wenn ich etwas anmerken darf“, sagte Mrs. Williams und schob sich eine widerspenstige Strähne aus der Stirn. „Lassen wir einmal alle Fragebögen, alle Tests und das ganze Assessment-Center beiseite und betrachten nur das, was uns Constable Sharif-Holbrook in den letzten Minuten gezeigt hat. Wenn Sie ihn einstellen, werden Sie einen intelligenten, hoch motivierten und leidenschaftlichen Mitarbeiter gewinnen, gleichgültig, ob Sie ihn mit der Jagd nach einem Serienkiller oder mit der Neuorganisation der Mülltrennung von Scotland Yard beauftragen.“
Omar spürte, wie sich ein Grinsen auf seinen Lippen ausbreiten wollte, schaffte aber, es zu unterdrücken. DCI Laurel seufzte.
„Okay, genug der Schauspielerei. Constable, Sie haben auch die letzte Prüfung bestanden. Ich hätte Ihnen den Job sofort gegeben, aber Mrs. Williams wollte noch herausfinden, wie Sie damit umgehen, wenn Sie auf die Folter gespannt werden.“
Omar sah die Psychologin verblüfft an. Dann dämmerte ihm die Bedeutung der Worte, die Laurel gerade an ihn gerichtet hatte. „Heißt das, ich habe den Job?“
Rebecca Williams lachte.
„Für jemanden mit einem IQ von 132 sind Sie erstaunlich schwer von Begriff.“
Kapitel 4
Rebecca streifte sich die Schuhe von den Füßen und hängte die Handtasche an die Garderobe. Sie schlüpfte in ihre Clogs im Camouflage-Stil und ging ins Wohnzimmer. Marc saß auf dem schwarzen Ledersofa und sah sich ein Fußballspiel an.
„Hi, Schatz“, sagte er. „Wie war dein Tag?“
„Gut. Wir haben heute das Assessment-Center bei der Met zu Ende gebracht.“
„Habt ihr dieses Mal die Richtigen ausgewählt?“
Er zwinkerte ihr zu. Sie schmunzelte. „Na, du scheinst ja viel Zutrauen in meine Fähigkeiten zu haben.“
„Ich weiß, dass du die Beste bist. Deshalb liebe ich dich.“
„Ich dich auch, mein Herz. Wer spielt denn?“
„Arsenal gegen West Ham. Ein ziemlich einseitiges Spiel. Soll ich in den Pub gehen und es mir dort ansehen, damit du ein bisschen Ruhe hast?“
„Ich fürchte, mit der Ruhe wird es nichts heute Abend. Genauso wie mit der zweiten Halbzeit deines Spiels“, erwiderte sie. Er sah sie irritiert an.
„Wir sind bei Vicky eingeladen. Schon vergessen?“
Marc stöhnte. „Oh nein, das hatte ich voll verdrängt. Muss das sein?“
„Ja, muss es. Es wird ganz bestimmt nett werden. Komm schon, das letzte Mal haben wir doch viel gelacht.“
Marc verdrehte die Augen. „Ihr habt gelacht. Ich habe das Geschwätz ihres Influencer-Freundes über mich ergehen lassen müssen. Als ob mich interessieren würde, welches Sonnenstudio in der City den besten Bräunungsgrad zu bieten hat.“
Sie legte ihm eine Hand auf den Arm. „Das war keine Anspielung auf deine Hautfarbe. Du weißt doch, dass Georgios immer nur über sich selbst spricht. Das ist eine Berufskrankheit erfolgreicher Influencer. Auf YouTube haben seine Videos regelmäßig mehr als eine Million Views.“
Marc schüttelte den Kopf. „Das werde ich nie verstehen … und dann noch der bescheuerte Name seines Accounts: Der Tanfluencer. Aber egal, ich sollte mich wohl frisch machen, bevor wir bei unseren Nachbarn aufschlagen.“
„Lass dir Zeit.“
Rebecca ging ins Bad, zog sich aus und stellte sich unter die Brause. Sie duschte ausschließlich kalt, weil es sie wach machte und weil sie es hasste, wenn der Badspiegel anlief, ganz im Gegensatz zu Marc, der es liebte, viel Dampf zu produzieren.
Eine Stunde später traten sie ins Treppenhaus. Die riesige Glasfront zur Leman Street bot einen freien Blick auf die untergehende Sonne, die hinter den Hochhäusern der City in einem blendenden Streifen aus Orange und Purpur versank. Keine Wolke stand am Himmel. Rebecca blieb einen Augenblick stehen, um das Schauspiel zu genießen.
„Wir hätten am Themseufer spazieren gehen können“, brummte Marc.
„Das können wir später immer noch. Der Abend ist lau.“
„Ich fürchte, dass ich dazu nicht mehr in der Lage sein werde, wenn ich mir das Geschwätz von Georgios schöngetrunken habe.“
Rebecca knuffte ihn in die Seite. Sie gingen zur gegenüberliegenden Wohnung und Marc drückte den mit Victoria Bricks & Georgios Megalopoulos beschrifteten Klingelknopf. Schnelle Schritte waren zu hören, dann öffnete sich die Tür.
„Hi, schön, dass ihr da seid“, rief Vicky, breitete die Arme aus und stürzte sich auf Rebecca. Diese musste sich ein wenig bücken, um die Umarmung der kleineren Frau zu erwidern. Sie roch ein süßliches Parfüm. Wahrscheinlich Vivienne Westwood, das war die Lieblingsdesignerin ihrer Nachbarin. Sie löste sich von ihr. Vicky wiederholte das Begrüßungsritual bei Marc, der es mit zusammengekniffenen Lippen über sich ergehen ließ.
„Kommt rein“, sagte sie.
Im Wohnzimmer wartete Georgios auf sie. Braun gebrannt, ein muskulöser Schrank von einem Mann, der sogar Marc noch um einen halben Kopf überragte. Mit Zähnen so weiß, dass man glauben konnte, sie wären mit Photoshop bearbeitet worden. Vicky sah daneben eher unscheinbar aus mit ihren mausbraunen, schulterlangen Haaren, dem sommersprossigen, bleichen Gesicht und den blassblauen Augen.
„Was wollt ihr trinken?“, fragte die Gastgeberin. „Martinis?“
„Gern“, sagte Marc.
„Ich nehme einen Orangensaft, wenn das okay ist“, sagte Rebecca.
„Einen Orangensaft? Mit Wodka?“, fragte Georgios.
„Nein, bitte nur einen Orangensaft.“
„Was ist denn mit dir los?“, fragte Vicky. „Bist du den Anonymen Alkoholikern beigetreten?“
Rebecca lächelte. „Nein, aber … okay, ich … wir versuchen, schwanger zu werden und ich verzichte deswegen auf Alkohol.“
Auf Vickys Gesicht erschien ein breites Grinsen.
„Die meisten Schwangerschaften, von denen ich weiß, sind durch zu viel Alkohol zustande gekommen.“
Sie lachten. Vicky schenkte Rebecca einen Orangensaft ein, während Georgios Marc einen Martini mixte.
„Wir haben draußen gedeckt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Der Abend ist so himmlisch, da wollten wir nicht hier drinnen versauern.“
Sie gingen auf den geräumigen Balkon, der Platz für einen enormen Barbecue-Grill, einen Tisch mit zwölf Stühlen und zwei Sonnenliegen bot. Die tief orangefarbenen Strahlen der Abendsonne spiegelten sich in den Glasfassaden der Hochhäuser rings umher wider.
„Das hat schon was, findet ihr nicht?“, fragte Vicky. „Ich lebe wirklich gern in London. Auch wenn die Abende, an denen es nicht regnet und kalt ist, eher selten sind.“
„Dafür verbringen wir ja den halben Sommer in deinem Haus in Mykonos“, sagte Georgios. „Da können wir genügend UV tanken.“
„Ziehst du echte Sonne der Solarium-Bräune vor?“, fragte Marc. Rebecca biss die Zähne zusammen, um zu verhindern, dass sie angesichts Marcs vollkommen ernsthafter Miene laut loslachte.
„Freiluftbräunung setzt ein solides Fundament“, meinte Georgios. „Im Studio kann man dann die Feinjustierung vornehmen. Der Schlüssel liegt in einer gleichmäßigen Bestrahlung aller Hautpartien.“
„Also ein bisschen wie bei einem Brathähnchen, oder?“, fragte Marc. Georgios sah ihn irritiert an, wobei er seine Stirn in Falten legte. Er glättete sie jedoch gleich wieder, offenbar darum bemüht, keine bleibenden Vertiefungen zu hinterlassen.
Vicky klatschte in die Hände.
„Das ist ein gutes Stichwort“, sagte sie. „Habt ihr Hunger?“
Der Catering-Service hatte ganze Arbeit geleistet. Nach einem üppigen Teller Pasta mit Meeresfrüchten und einem fabelhaften Tiramisu war Rebecca voll bis oben.
„Pflaumen-Raki?“, fragte Georgios nun. Er hielt ein Tablett mit vier Schnapsgläsern in der Hand.
Marc nickte eifrig, doch Rebecca lehnte ab.
„Ein Espresso wäre super“, sagte sie.
„Wie laufen die Geschäfte, Marc?“, fragte Vicky.
Marc, der gerade nach dem Shot hatte greifen wollen, den Giorgios ihm reichte, hielt inne und erwiderte: „Nicht so besonders, ehrlich gesagt. Der Brexit hat uns ganz schön zugesetzt.“
„Ihr müsst euch neue Handelspartner suchen“, sagte Vicky. „Das war von Anfang an der Fehler … diese Konzentration auf die EU.“
„Na ja“, erwiderte Marc und nahm einen Schluck von seinem Raki. „Wir importieren nun einmal spanischen Schinken und belgische Pralinen. Unsere Kundschaft wäre bestimmt nicht erfreut, wenn wir stattdessen südkoreanische Süßigkeiten anbieten würden.“
Vicky winkte ab. „Das wird schon wieder werden. Irgendwann werden diese Bürokraten in Brüssel erkennen, dass sie nicht ohne uns können.“ Sie prostete Marc zu und beide leerten ihre Gläser. Dann wandte sich Vicky an Rebecca: „Hast du kurz Zeit für mich?“
„Natürlich“, erwiderte diese. Sie standen auf. Marc warf seiner Freundin einen Blick zu, der wohl aussagen sollte: Hilf mir!, als Georgios in einen seiner Monologe über die korrekte Pflege sonnengebräunter Haut ausbrach. Die beiden Frauen gingen ins Wohnzimmer und setzten sich auf das wie neu aussehende, makellos weiße Ledersofa.
„Wie lief dein Assessment-Center?“, fragte Vicky. Trotz der Martinis, einer halben Flasche Weißwein und des Rakis wirkte sie stocknüchtern.
„Gut“, erwiderte Rebecca. „Wir haben zwei kreuzbrave Bewerber für das Traineeprogramm ausgewählt.“
Vicky grinste. „Ganz im Sinne deines Auftraggebers.“
„Von welchem meiner Auftraggeber sprichst du jetzt?“, fragte Rebecca.
Vicky lachte. „Die Kreuzbraven sind also aus dem Weg geräumt. Was hast du für uns?“
Rebecca befeuchtete sich mit der Zungenspitze die Lippen. „Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der sich perfekt für eure Zwecke eignet.“
Sie griff nach ihrer Tasche, holte eine Akte heraus und reichte sie Vicky. Diese begann, das Schriftstück durchzublättern.
„Tom Marston“, murmelte sie. „Kannst du mir eine grobe Zusammenfassung geben? Aus deinen Tabellen und Schaubildern werde ich einfach nicht schlau.“
„Klar. Marston hat von uns ein klares Nein bekommen. Er ist der Typ, der sich für den Allerschlausten hält und stolz darauf ist, unangepasst zu sein. Er drückt jedem seine Meinung rein, ob dieser es nun will oder nicht. Wenn etwas schiefläuft, sind immer die anderen schuld. Er ist ein rücksichtsloser, vollkommen auf seinen eigenen Vorteil bedachter Narzisst. Damit weist er genau das Persönlichkeitsprofil auf, das euren Anforderungen entspricht. Er könnte als Manager in einem großen Konzern bestehen, als Präsident einer Weltmacht, oder in einer Organisation wie der deines Vaters.“
Vicky sah sie direkt an. „Das klingt nach einem ziemlich unangenehmen Zeitgenossen“, sagte sie.
Rebecca zuckte mit den Achseln. „Privat würde ich mit Marston ganz bestimmt nichts zu tun haben wollen. Er ist der Typ, wegen dem man in einen anderen Pub geht, weil er einen so nervt.“
„Aber wenn er so selbstbezogen ist, ist er dann auch loyal? Du weißt, dass das meinem Vater am wichtigsten ist.“
„Ja, das weiß ich natürlich. Marston ist wie ein Hundewelpe. Er braucht viel Zuwendung und regelmäßige Leckerli. So könnt ihr ihn zum anhänglichsten Wesen dressieren, das sich dein Vater nur wünschen kann.“
„Mit Leckerli meinst du Geld, das ist mir schon klar. Aber was verstehst du unter Zuwendung?“
„Wenn ihr ihm regelmäßig sagt, wie toll er ist, wie wichtig die Informationen sind, die ihr von ihm bekommt, und dass er der beste Informant ist, den ihr jemals hattet, wird er euch aus der Hand fressen.“
Vicky legte den Kopf schief. „Kann das nicht auch nach hinten losgehen? Ich meine, wenn wir ihn zu sehr pampern, bildet er sich vielleicht irgendwann ein, Forderungen stellen zu können.“
Rebecca nickte. „Ja, das kann natürlich passieren. Das ist dann der Zeitpunkt, an dem ihr ihn wieder loswerden müsst. Aber das fällt glücklicherweise nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.“
Vicky brach in schallendes Gelächter aus. „Super, Becca, ich liebe deinen Sinn für Humor. Lass uns zu den Jungs rausgehen und unser kleines Geschäft feiern. Marc weiß doch nichts davon, oder?“
Rebecca schüttelte den Kopf.
„Gut“, sagte Vicky. „Sieh zu, dass das so bleibt. Es ist besser für ihn.“
Kapitel 5
Omar trat in die Küche und ging auf Gwyneth zu, die am Herd stand und Porridge anrührte. Er umarmte seine Frau von hinten und sie schmiegte ihren Kopf an seinen.
„Na, aufgeregt?“, fragte sie, ohne im Rühren innezuhalten. Sie gab einen weiteren Schuss Hafermilch in den Brei, der einen himmlischen Duft nach Zimt verströmte.
„Ein bisschen“, gab Omar zu und drückte ihr einen Kuss auf die Wange, ehe er sie wieder losließ und zwei Tassen aus dem Küchenschrank holte, um Tee zu kochen.
Sie sah ihn an und lächelte. „Das wird schon. Das Schlimmste hast du doch schon hinter dir. Dieses Auswahlverfahren war bestimmt kein Zuckerschlecken.“
Omar zuckte mit den Achseln. Er gab zwei Beutel in die Tassen und schaltete den Wasserkocher ein.
„Das Assessment-Center hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht“, sagte er. „Ich finde es spannend, was diese Psychologin alles über uns Bewerber herausbekommen hat. So einen Job könnte ich mir auch vorstellen.“
„Oh je“, sagte Gwyneth und verzog das Gesicht zu einer Grimasse. „Du weißt, wie schwer es mir als Nachfahrin eines noblen walisischen Schmugglergeschlechts fällt, mit einem Cop verheiratet zu sein. Und jetzt willst du auch noch zum Seelenklempner umsatteln?“
Er lachte. „Nein, ich will niemanden behandeln. Aber wenn mich die gehobene Laufbahn in die Personalabteilung führen würde, hätte ich auch nichts dagegen.“
„Jetzt bring erst mal dein halbes Jahr Praktikum hinter dich, und dann sehen wir weiter.“
Sie nahm den Topf vom Herd und schöpfte Porridge in zwei Schüsseln. Omar entsorgte die Teebeutel und trug die Tassen zum Tisch, dann setzten sie sich.
„Ich dachte nur …“, sagte Omar, während er auf seinen Löffel blies, um den dampfenden Brei etwas abzukühlen. „… eine Stelle in der Personalabteilung ist garantiert familienfreundlicher als eine in einer Soko.“
Gwyneth sah ihn an. „Wir haben doch darüber gesprochen, dass wir beide uns keine Beschränkungen auferlegen. Ich weiß, wie wichtig dir ein Job in der Mordkommission wäre. Ich will auch irgendwann einmal meine eigene Anwaltskanzlei gründen. Wie wir das mit einem halben Dutzend Kindern und einem Hund unter einen Hut bringen, werden wir noch sehen. Aber dafür müsste ich erst einmal schwanger werden.“
„Daran können wir ja arbeiten“, sagte Omar und zwinkerte ihr zu.
Sie grinste. „Heute Abend gern, aber jetzt sieh zu, dass du rechtzeitig zu deinem Praktikum kommst!“
Eine Stunde später betrat Omar das Hauptgebäude der Metropolitan Police am Themseufer. Seit seinem ersten Tag als Streifenpolizist auf dem Revier in Wandsworth hatte er davon geträumt, hier zu arbeiten. DCI Laurel erwartete ihn bereits am Empfang.
„Guten Morgen, Constable“, sagte er und nickte Omar zu. „Ich werde Sie zu Ihrem Einsatzort begleiten und Sie mit Ihren Kollegen bekannt machen.“
Omar spürte, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte. Er hatte keine Ahnung, in welcher Abteilung er die ersten vier Wochen seiner sechsmonatigen Trainee-Zeit verbringen würde. Sie gingen zu den Aufzügen und als Laurel auf den Knopf mit der Nummer 3 drückte, realisierte Omar, dass es nicht die Mordkommission sein würde, denn diese war im fünften Stock untergebracht. Das wusste er von Olivia Jenner, seiner ehemaligen Chefin, die dort einmal gearbeitet hatte.
Sie stiegen in der dritten Etage aus, und Laurel führte ihn einen langen Korridor entlang. Schließlich stoppte er von einer Tür. Auf dem Schild daneben stand Drogendezernat. Das war es also. Nun, es gab Schlimmeres. Laurel trat ein und Omar folgte ihm. Sie fanden sich in einem Großraumbüro wieder. Ein gutes Dutzend Augenpaare richteten sich auf sie und Omar spürte, wie seine Handflächen feucht wurden. Ein hoch gewachsener, ziemlich bulliger Mann mit einem roten Gesicht und flachsblonden Haaren kam auf sie zu.
„DCI O’Brien“, sagte Laurel, als er dem Hünen die Hand drückte. „Das ist Constable Omar Sharif-Holbrook, der Trainee.“
O’Brien streckte ihm seine Pranke hin. Der Händedruck glich einem unfreiwilligen Kontakt mit einem Schraubstock und Omar hoffte inständig, dass er sich dabei nichts gebrochen hatte. Laurel verabschiedete sich und O’Brien begann damit, Omar seine neuen Kollegen auf Zeit vorzustellen. Die vielen Namen und Gesichter überforderten sein von der Aufregung ohnehin wenig aufnahmebereites Gehirn. Er war froh, als sich die gesamte Mannschaft in Richtung des Besprechungsraumes bewegte.
„Kopf hoch, das wird schon“, hörte er eine Stimme hinter sich. Er wandte sich der Sprecherin zu, einer Frau, die kaum älter sein konnte als er. Ihr braunes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, der hin und her wippte, als sie mit ihrem federnden Gang neben ihm herlief.
„Inspector Wallis, nicht wahr?“, fragte er.
„Fast richtig. Willis. Wie Bruce, nur ohne Hoden.“
Omar riss die Augen auf und sie lachte. „Wir haben einen etwas derberen Humor hier.“
Sie setzten sich in die letzte Stuhlreihe des Besprechungsraumes. DCI O’Brien startete einen an einem Tisch neben einer Leinwand bereitstehenden Laptop, ehe er mit einer Fernbedienung hantierte, offenbar, um einen Beamer anzuschalten. Das schien jedoch nicht zu funktionieren und der Leiter des Drogendezernats stieß ein paar äußerst unanständige Flüche aus.
„Drücken Sie mal Strg und F5“, rief Inspector Willis.
O’Briens riesige Finger versuchten sich an der Tastenkombination und kurz darauf erschien ein leuchtendes weißes Viereck auf der Leinwand.
„Danke“, knurrte der Polizist.
Er öffnete einen Ordner auf dem Desktop und klickte auf eine Bilddatei. Das Foto eines Mannes poppte auf. Er musste etwa Mitte fünfzig sein. Sein pockennarbiges Gesicht wurde von einem fleischigen Mund und einer krummen Nase dominiert. Wahrscheinlich hatte es mehrerer Schlägereien bedurft, um sie in diese Form zu modellieren. Am beeindruckendsten fand Omar jedoch die Augen des Mannes. Diese waren hellblau und absolut klar. Mit einer eisigen Härte blickten sie in die Kamera.
„Das ist Tony Bricks“, sagte O’Brien. „Der Chef der Bricks Bande, wie sein Vater und sein Großvater vor ihm.“
Er klickte auf ein weiteres Bild. Ein Kartenausschnitt des Londoner East Ends erschien. Ein Teil davon war rot schraffiert. Zu seinem Entsetzen stellte Omar fest, dass auch die Straße, in der er und Gwyneth lebten, zu dem markierten Bereich gehörte.
„Das ist das Territorium, das Bricks beherrscht“, führte O’Brien aus. „Dort geschieht nichts ohne sein Wissen. Kein Drogendeal, kein Waffengeschäft, nicht einmal ein Taschendiebstahl. Bricks ist effizient und grausam. Wir vermuten, dass er hinter mindestens vierzehn Morden steckt. Bislang konnte ihm jedoch nichts nachgewiesen werden.“
O’Brien klickte auf eine weitere Datei. Wieder war der Kartenausschnitt zu sehen, doch dieses Mal waren zwei Bereiche eingefärbt. Bricks rotes Territorium, das näher zur City lag und ein blaues Gebiet, das sich in Richtung der olympischen Spielstätten befand. An den Rändern überlappten sich die beiden Flächen.
„Wer kann mir sagen, was das ist?“, fragte O’Brien.
„Das Revier der Skanderberg-Bande“, rief Inspector Willis.
„Exakt“, sagte O’Brien.
„Skanderberg-Bande?“, fragte Omar.
„Benannt nach einem albanischen Widerstandskämpfer gegen die Osmanen. Das sind hippe Jungs, die dem alten Bricks gehörig die Hölle heißmachen“, raunte die Kollegin ihm zu.
„Wie Sie sehen, stoßen die beiden Territorien direkt aneinander und überlappen sich bereits“, sagte O’Brien. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu offenen Revierkämpfen kommt. Ich bin mir mit dem Superintendenten einig, dass wir dem vorbeugen müssen.“
„Und wie sollen wir das genau anstellen?“, fragte Inspector Willis.
„Wir werden beide Seiten so sehr beschäftigen, dass sie keine Zeit mehr haben werden, sich gegenseitig zu bekämpfen.“
Willis grunzte. „Tolle Strategie“, murmelte sie.
O’Brien fuhr fort: „Als Erstes schlagen wir bei Bricks Organisation zu. Die haben wir schon seit einiger Zeit mit einer verlässlichen Quelle infiltriert. Morgen Früh wird eine größere Menge Kokain in einer Lagerhalle im East End erwartet. Offenbar ist der Deal so bedeutend, dass eine ganze Reihe von Bricks besten Leuten zur Sicherung abgestellt werden. Auch der Chef seiner Drogen-Abteilung soll dann vor Ort sein. Das ist unsere Chance, Bricks einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Wenn er keine Leute mehr hat, kann er auch keinen Krieg gegen die Skanderberg-Bande führen.“
Inspector Willis meldete sich. O’Brien bemerkte sie erst nicht. Vielleicht wollte er sie aber auch nicht sehen.
„Sir!“
Er wandte sich ihr zu. „Ja, was gibt es?“
„Wenn wir Bricks so sehr schwächen, hat dann nicht die Skanderberg-Bande freies Spiel, sein Territorium zu übernehmen?“
O’Brien warf ihr einen genervten Blick zu. „Nein, denn wir werden natürlich auch gegen die Skanderberg-Leute vorgehen. Leider haben wir bei denen noch keinen brauchbaren Informanten. Deshalb werden wir uns erst einmal mit Bricks beschäftigen.“
Er öffnete eine Powerpoint-Präsentation, in der ausführlich der Schauplatz der Kokainlieferung und der Einsatzplan dargestellt wurden.
Willis knuffte Omar in die Seite.
„Das könnte heiß hergehen“, sagte sie. „Ich hoffe, Sie haben Ihr Schießtraining schon absolviert.“