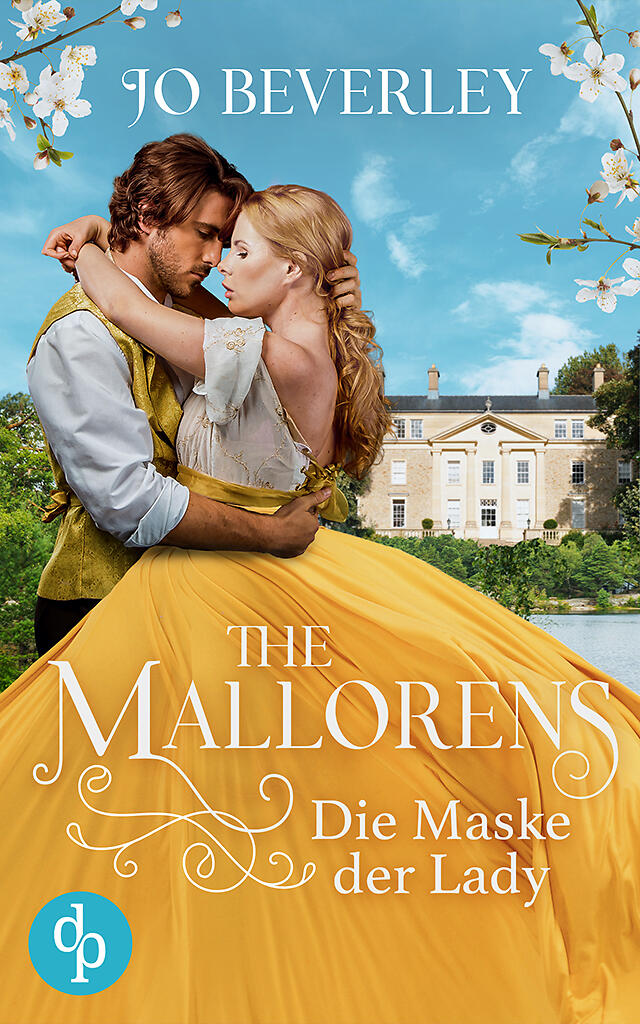Erstes Kapitel
Die große wappengeschmückte Kutsche holperte durch vom scharfen Novemberfrost steinhart gefrorene Fahrrinnen über die Straße nach Shaftesbury. Drinnen, die glänzend polierten Stiefel auf den Sitz gegenüber gelegt, hatte es sich ein junger Herr mit trägem Blick in einem dunkelblauen, mit silberner Spitze abgesetzten Anzug bequem gemacht. Seine Züge waren glatt, braun gebrannt, männlich-hübsch, doch für aufwendige Kleidung hatte er offenbar nicht viel übrig. Die silberne Spitze zierte nur die Knopfleiste seiner Jacke, sein Schmuck bestand lediglich in einem Saphirring an seiner entspannten rechten Hand und einer Tuchnadel mit Perle und Diamant in den weichen Falten seiner Halsbinde. Sein ungepudertes rotbraunes Haar war natürlich gewellt, aber in einem ordentlichen, oben und unten mit schwarzen Schleifen versehenen Zopf gebändigt. Diese Frisur war das Werk seines Kammerdieners, eines Mannes mittleren Alters, der, ein kleines Schmuckkästchen fest umklammert auf dem Schoß haltend, aufrecht neben seinem Herrn saß.
Als die Kutsche wieder einmal ächzend schwankte, seufzte Lord Cynric Malloren und beschloss, an der nächsten Station ein Pferd zu mieten. Er musste dieser verdammten Enge entkommen.
Ein Rekonvaleszent zu sein, war die Hölle.
Es war ihm endlich gelungen, seinen fürsorglichen Bruder, den Marquis von Rothgar, davon zu überzeugen, dass er reisefähig war, allerdings war ihm lediglich eine zwei Tage dauernde Fahrt nach Dorset zu seiner Schwester und ihrem neugeborenen Baby gestattet worden. Und nur in diesem monströsen Gefährt samt Decken für seine Beine und heißen Steinen für die Füße. Jetzt reiste er wie eine gebrechliche alte Großmutter wieder zurück in die Obhut seines Bruders. Der laute Befehl brach als willkommene Abwechslung in seine Langeweile ein. Es dauerte einen Moment, bis Cyn klar wurde, dass er doch tatsächlich überfallen werden sollte. Sein Kammerdiener erblasste, bekreuzigte sich und stammelte französische Gebete. Cyns Augen verloren den trägen Ausdruck.
Er straffte sich und warf einen raschen Blick auf seinen Degen samt Scheide auf dem Sitz gegenüber. Der kam nicht infrage. Er glaubte nicht an Geschichten von Straßenräubern, die mit ihren Opfern ums Gold fochten. So zog er lieber eine doppelläufige schwere Pistole aus dem Polster neben sich und prüfte eilig, ob sie auch geladen war. Der Degen war die elegantere Waffe, doch in dieser Situation leistete die Pistole bessere Dienste.
Die Kutsche stellte sich quer und hielt an. Cyn sah hinaus und betrachtete die Szene. Es war schon spät, und die Tannen am Straßenrand warfen im Licht der tiefrot untergehenden Sonne lange Schatten, dennoch konnte Cyn die beiden Straßenräuber deutlich sehen. Einer drückte sich weiter hinten unter die Bäume und stand, eine Muskete im Anschlag, Schmiere. Der andere, in unmittelbarer Nähe der Kutsche, war mit zwei eleganten Duellpistolen bewaffnet. Diebesgut? Oder handelte es sich um einen echten Gentleman der Landstraße? Sein dampfendes Pferd war ein edles Tier. Cyn beschloss, zunächst noch niemanden zu erschießen. Das Abenteuer kam ihm so gelegen, dass er es nicht unnötig abkürzen mochte, und außerdem stellte der weiter entfernte Schurke im schwindenden Licht zugegebenermaßen selbst für Cyn ein unsicheres Ziel dar.
Beide Räuber trugen weite schwarze Mäntel, Dreispitze und hatten mit weißen Tüchern die untere Gesichtshälfte verdeckt. Sie zu beschreiben würde im Falle ihres Entkommens nicht einfach sein, doch tief im Herzen war Cyn ein Spieler, wenngleich er selten Geld zum Einsatz brachte. Und das Spiel hatte begonnen.
„Steig ab“, befahl der Mann an der Kutsche grob. Kutscher und Pferdeknecht kletterten gehorsam vom Bock. Auf einen weiteren Befehl hin legten sie sich bäuchlings ins gefrorene Gras am Straßenrand. Der zweite Räuber näherte sich, um sie in Schach zu halten.
Die Kutsche schwankte, als die sich selbst überlassenen Pferde zu tänzeln begannen. Cyns Kammerdiener Jerome schrie erschrocken auf. Ohne den Blick von den beiden Räubern zu wenden, streckte Cyn die Hand aus, um sich abzustützen. Das Gespann war jedoch zu erschöpft, um durchzugehen, wie sich herausstellte.
„Und jetzt ihr da drinnen“, bellte der erste Schurke, beide Pistolen auf den Schlag gerichtet. „Raus. Und keine Mätzchen.“
Cyn erwog, den Mann zu erschießen – aus dieser Entfernung hätte er mit Sicherheit sein rechtes Auge getroffen –, doch er hielt sich zurück. Dadurch würden andere gefährdet, und weder sein Stolz noch seine Wertsachen wogen ein unschuldiges Leben auf.
Er legte seine Pistole neben sein Schwert, öffnete den Schlag und stieg aus. Er wandte sich seinem Kammerdiener zu, um ihm behilflich zu sein, denn dieser hatte ein schlimmes Bein, dann ließ er seine Tabaksdose aufschnappen, warf das Spitzengeriesel an seinem Handgelenk zurück und nahm eine Prise. Er schloss die Dose und wandte sich den Pistolen des Räubers zu. „Wie kann ich Euch behilflich sein, Sir?“ Diese Reaktion schien den Mann zu überraschen, doch er erholte sich rasch. „Zunächst einmal könnt Ihr mir das hübsche Döschen aushändigen.“
Cyn hatte Mühe, ernst zu bleiben. Der Dieb hatte, vielleicht aufgrund seiner stoischen Reaktion auf den Überfall, vergessen, seine Stimme zu verstellen. Jetzt klang sie gebildet und ziemlich jung, wie die eines halbwüchsigen Jungen. Der Wunsch, den Burschen hängen zu sehen, verflüchtigte sich, dafür gewann Cyns Neugier die Oberhand. Er ließ die Dose erneut aufschnappen und trat näher. „Möchtet Ihr meine Marke versuchen? Eine angenehme Mischung …“
Er hatte nicht beabsichtigt, dem Räuber den Büchseninhalt ins Gesicht zu werfen, doch der Junge war nicht dumm und wich auf seinem Pferd nach rückwärts aus. „Keinen Schritt näher. Ich will die Dose – samt der angenehmen Mischung und Euer Geld sowie den Schmuck und andere Wertgegenstände.“
„Gewiss“, sagte Cyn mit lässigem Schulterzucken. Er nahm Jerome das Kästchen aus den Fingern, das Tuchnadeln, Manschettenknöpfe und anderen Schnickschnack enthielt, und legte auch die Tabaksdose hinein. Aus seinen Taschen kramte er noch ein paar Münzen und Scheine hervor und gab sie hinzu. Mit mildem Bedauern streifte er den Saphirring ab und löste die Nadel aus der Halsbinde; beides hatte einen gewissen ideellen Wert für ihn. „Ihr braucht diesen Plunder eindeutig nötiger als ich, guter Mann. Soll ich das Kästchen an den Straßenrand stellen? Dann könnt Ihr es Euch holen, sobald wir fort sind.“
Es folgte verdutztes Schweigen. Dann: „Legt Euch verdammt noch mal zu Eurem Diener in den Dreck!“
Cyn zog die Augenbrauen hoch und schnippte einen Fussel von seinem Jackenärmel. „Ach, lieber nicht. Ich möchte mich nicht schmutzig machen.“ Er blickte dem Mann gelassen ins Gesicht. „Wollt Ihr mich dafür umbringen?“
Der Finger des Mannes krümmte sich um den Abzug, und Cyn fürchtete schon, zu weit gegangen zu sein, doch kein Schuss ertönte. Nach kurzem verblüfftem Schweigen sagte der junge Mann: „Legt Eure Wertsachen in die Kutsche und steigt auf den Bock. Ich nehme den Wagen, und Ihr dürft mein Kutscher sein, Mr. Großkotz.“
„Das ist neu“, bemerkte Cyn mit hochgezogenen Brauen. „Aber sind gestohlene Kutschen nicht ein bisschen zu auffällig?“
„Maul halten oder ich stopf es Euch!“
Cyn hatte das sichere Gefühl, dass der Straßenräuber allmählich die Geduld verlor – eine Reaktion, die er seit jeher provozierte.
„Tut, was ich Euch sage!“, bellte der Schurke. „Und sagt Euren Leuten, sie sollen sich auf der Suche nach Hilfe viel Zeit lassen. Werden wir eingeholt, seid Ihr als Erster tot.“ Cyn wandte sich gehorsam an seine Diener. „Geht weiter nach Shaftesbury und sucht Unterkunft im Crown. Wenn ihr nach ein, zwei Tagen nichts von mir hört, schickt Nachricht zum Familiensitz, dann kümmert mein Bruder sich um euch. Macht euch wegen dieser Sache hier keine Sorgen. Der Junge erlaubt sich bloß einen Spaß, und ich habe Lust, mich daran zu beteiligen.“ Er richtete das Wort an den Kutscher. „Hoskins, wenn Jeromes Bein ihm zu schaffen macht, musst du vorangehen und dafür sorgen, dass er abgeholt wird.“ Dann wandte er sich wieder dem Straßenräuber zu. „Ist es erlaubt, dass ich meinen Mantel und meine Handschuhe anziehe, Sir, oder habt Ihr eine Art Folter im Sinn?“ Der Mann zögerte, bevor er sagte: „Nun macht schon. Aber glaubt nicht, dass ich Euch auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse.“
Cyn holte seinen Mantel aus der Kutsche und zog ihn an, dann streifte er die schwarzen Handschuhe aus weichem Leder über, wobei er bedauernd feststellte, dass eine längere Betätigung als Kutscher ihr Ruin sein würde. Eine Sekunde lang erwog er, zur Pistole zu greifen, besann sich jedoch eines Besseren. Er wollte diesen Streich noch ein Weilchen genießen.
So stieg er auf den Kutschbock und nahm die vier Zügelpaare in seine erfahrenen Hände. Schnell hatte er an den verschiedenen Mustern erkannt, welches Paar zu welchem Pferd gehörte. „Und jetzt, guter Mann?“ Der Wegelagerer blickte ihn aus schmalen Augen böse an. „Ihr seid ganz schön dreist.“ Als Cyn nichts darauf erwiderte, band der Junge sein Pferd hinten an die Kutsche und stieg zu Cyn auf den Bock. Eine Pistole steckte er in seine Tasche, die andere richtete er auf Cyn. „Ich weiß nicht, was Ihr im Schilde führt, aber Ihr legt mich nicht herein. Fahrt los.“ Cyn trieb die Pferde an. „Ich lege Euch nicht herein“, versprach er. „Aber ich hoffe inbrünstig, dass der Abzug Eurer Pistole nicht übermäßig empfindlich ist. Diese Straße ist ausgesprochen holperig.“
Einen Augenblick später zielte die Pistolenmündung nicht mehr auf seine Brust. „Fühlt Ihr Euch jetzt sicherer?“, höhnte der Bursche.
„Aber ja. Wohin fahren wir?“
„Das geht Euch nichts an. Ich sag Bescheid, wenn Ihr abbiegen sollt. Und jetzt haltet erst einmal den Mund.“ Cyn gehorchte. Er spürte die Wut und Verblüffung seines Widersachers und hatte keine Lust, ihn zum Schießen zu reizen. Nein, er wollte den Dummkopf überhaupt nicht reizen. Viel lieber hätte er ihn auf beide Wangen geküsst, als Dank dafür, dass er Abwechslung in die Eintönigkeit seiner Tage gebracht hatte. Er hatte es satt, in Watte gepackt zu werden.
Er blickte vorsichtig um sich und stellte fest, dass der zweite Schurke vorausgeritten war. Das war riskant, aber vermutlich dachten beide, dass er schon stillhalten würde, solange eine Pistole auf ihn gerichtet war. Schon möglich. Er war in Gönnerlaune. Von seinen Geschwistern bemuttert zu werden, wäre vielleicht erträglich gewesen, wenn er sich seine Verletzung im Kampf zugezogen hätte, aber wegen eines albernen Fiebers…! Und jetzt wollten sie ihm einfach nicht glauben, dass er sich ausreichend erholt hatte, um wieder zu seiner Truppe stoßen zu können. Er hatte mit dem Gedanken gespielt, den vorgefassten Plan umzuwerfen und Hoskins zu befehlen, den Weg nach London einzuschlagen, wo er einen Militärarzt hätte konsultieren können. Das jedoch hätte wenig Sinn gehabt, denn auf ein Wort von Rothgar hätte dieser bestimmt noch Nachwirkungen seiner Krankheit festgestellt. Genauso wie auf ein Wort von Rothgar rascher Transport zum Familiensitz gewährleistet war, samt erstklassiger medizinischer Betreuung auf der Reise, während bessere Männer ihr Fieber in überfüllten Krankenhäusern in Plymouth ausschwitzten oder dort gar starben. Oder auch unter primitivsten Bedingungen in Akadien. Vielleicht steckte Rothgar sogar dahinter, dass er von Halifax nach Hause verschifft worden war.
Zum Teufel mit Rothgar und seiner übertriebenen Fürsorglichkeit!
Kein vernünftig denkender Mensch käme auf die Idee, den furchterregenden Marquis, Cyns ältesten Bruder, als Glucke zu bezeichnen, doch nach dem Tod der Eltern hatte er seine fünf Geschwister unter die despotischen Fittiche genommen, und Gott stehe jedem bei, der versuchen sollte, ihnen ein Härchen zu krümmen. Das galt sogar für die Schicksalsmacht des Krieges.
Rothgar schien zu glauben, Cyn ganz besonders streng behüten zu müssen. Das lag zum Teil daran, dass er das Nesthäkchen der Familie war, zum Teil aber auch an seiner verdammten äußeren Erscheinung. Obwohl Cyn das Gegenteil zu Genüge unter Beweis gestellt hatte, bestand man darauf, ihn als zart zu bezeichnen – selbst seine Angehörigen, die es doch zweifellos besser wussten.
Als Einziger in der Familie hatte er die Zartgliedrigkeit seiner Mutter geerbt, die grüngoldenen Augen, das rotbraune Haar und die langen, dichten Wimpern. Seine Schwestern, allen voran seine Zwillingsschwester, hielten dies für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Cyn ebenfalls. Als Junge hatte er gehofft, mit zunehmendem Alter etwas grobschlächtiger zu werden, doch mit vierundzwanzig, als Veteran von Quebec und Louisbourg, war er immer noch abscheulich hübsch. Mit nahezu jedem neuen Offizier im Regiment musste er sich duellieren, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen. „Biegt da drüben ab.“ Die Stimme des Wegelagerers riss Cyn aus seinen Gedanken. Gehorsam lenkte er die Pferde in die schmale Straße, direkt in den Sonnenuntergang hinein. Er blinzelte in das grelle Licht. „Ich hoffe, wir haben es nicht mehr so weit“, bemerkte er. „Bald wird es dunkel, und heute Nacht ist kaum mit Mondlicht zu rechnen.“
„Es ist nicht weit.“
In der zunehmenden Kälte dampften die Pferde. Cyn ließ die Peitsche knallen, um die müden Tiere anzutreiben. Der Junge lehnte sich zurück und streckte die gespreizten Beine lässig von sich, um älter und gefährlicher zu erscheinen. Das war ungeschickt. Sein Mantel hatte sich geöffnet, und die auffällig schlanken Beine bestätigten Cyns Verdacht, dass er es mit einem Halbwüchsigen zu tun hatte. Er sah allerdings auch, dass die Pistole nach wie vor schussbereit gehalten wurde, und musste dem Jungen im Stillen sein Lob aussprechen. Dumm war er nicht.
Was mochte den Burschen zu dieser Eskapade veranlasst haben? Eine Wette? Spielschulden, die er Papa nicht eingestehen mochte?
Cyn glaubte sich nicht ernsthaft in Gefahr, und für ernsthafte Gefahr hatte er ein feines Gespür entwickelt. Seit seinem achtzehnten Lebensjahr war er Soldat und hatte in Kriegen gekämpft.
Er dachte an den Aufruhr in seiner Familie, als er ausgerissen war, um sich freiwillig zu melden. Rothgar hatte sich geweigert, ihm ein Offizierspatent zu kaufen, und so hatte Cyn sich anwerben lassen. Der Marquis hatte ihn schließlich wieder nach Hause geschleift, doch nach Kämpfen, die alle Anwesenden schockiert zurückließen, hatte Rothgar schließlich nachgegeben und seinem Bruder den Fähnrichsrang in einem guten Regiment gekauft. Cyn hatte es nie bereut. Ihn verlangte nach Abenteuern, doch im Gegensatz zu zahlreichen anderen Sprösslingen der Aristokratie fand er keinen Geschmack an sinnlosem Gemetzel.
Er warf seinem Widersacher einen Blick zu. Vielleicht täte die militärische Laufbahn diesem jungen Lümmel gut. Ein merkwürdiger Gedanke kitzelte sein Unterbewusstsein, als er den Burschen musterte. Dann wüsste er es. Er bezwang das Zucken seiner Lippen und konzentrierte sich auf die Pferde, während er seine neue Erkenntnis auf sich wirken ließ. Der fehlenden Ausbuchtung an der Schnittstelle der Schenkel nach zu urteilen, war Cyns Widersacher eine Frau. Er begann zu pfeifen. Weiß Gott eine vielversprechende Situation.
„Hört auf mit dem Unfug!“
Cyn war folgsam und betrachtete seinen Gefährten nachdenklich. Frauen bedienten sich selten eines so barschen Tons, und der ordentliche Haarbeutel dieses Wesens sowie der Dreispitz ließen keine hochgesteckten langen Locken zu. Ob er sich doch irrte?
Wie zufällig ließ er den Blick wieder tiefer schweifen und fand seinen Verdacht bestätigt. Sie trug modisch enge Kniehosen, unter denen sich keine männliche Ausstattung verbarg. Und obwohl die Beine der Frau schlank und muskulös waren, zeichneten die Hosen und die feinen Strümpfe doch eindeutig weibliche Rundungen ab.
„Wie weit noch?“, fragte er und ließ das müde Leitpferd leicht die Peitsche spüren, damit es sie alle heil über eine besonders schwierige Wegstrecke brachte. „Diese Straße ist verteufelt schlecht.“
„Bis zu dem Haus dort drüben. Lenkt die Kutsche in den Obstgarten, wo sie nicht zu sehen ist. Die Pferde können dort grasen.“
Cyn betrachtete die Tordurchfahrt, wo die Wagenspuren tief wie Gräben waren, und fragte sich, ob seine Kutsche das schaffte. Er schob seine Besorgnis beiseite. Die Frage, was dieses Abenteuer als Nächstes bereithielt, war viel zu verlockend.
Mit Peitsche und Zurufen drängte er das erschöpfte Gespann weiter durch die Toreinfahrt. Nur mit Mühe konnte er sich auf dem Bock halten, als das Gefährt in die Fahrrinnen geriet und wieder hinaus holperte. Die gequälte Achse kreischte bedrohlich, brach aber nicht. Mit dem Gefühl, etwas geleistet zu haben, hielt er die Pferde unter den Bäumen an und hätte gern gewusst, ob das Weib wohl eine Vorstellung von seiner ungewöhnlichen Geschicklichkeit hatte. Seine aus Schultagen datierende Leidenschaft fürs Kutschieren hatte sich endlich einmal bezahlt gemacht. „Nicht schlecht“, sagte sie undankbar. Alles, was er über dem Tuch von ihrem Gesicht ausmachen konnte, waren die harten grauen Augen. Wahrscheinlich bildeten ihre Lippen einen verkniffenen, schmalen Strich. „Warum starrt Ihr so?“, fuhr sie ihn an. „Es empfiehlt sich, mir Euer Gesicht einzuprägen, damit ich es den Behörden beschreiben kann.“
Sie richtete den Lauf ihrer Pistole auf sein Gesicht. „Ihr seid ein Narr, wisst Ihr das? Was sollte mich daran hindern, Euch zu erschießen?“
Völlig entspannt sah er ihr in die Augen. „Fairness. Oder seid Ihr der Typ, der einen Mann ohne Grund niederschießt?“
„Wenn es um Kopf und Kragen geht, ist das für mich Grund genug.“
Cyn lächelte. „Ich gebe Euch mein Wort, dass ich nichts unternehmen werde, um den Behörden bei Eurer Verhaftung behilflich zu sein.“
Die Pistole senkte sich, und sie starrte ihn an. „Wer zum Teufel seid Ihr?“
„Cyn Malloren. Und wer zum Teufel seid Ihr?“ Ihm entging nicht, dass sie beinahe in die Falle getappt wäre und ihren richtigen Namen genannt hätte, aber im letzten Moment besann sie sich. „Ihr könnt mich Charles nennen. Cyn, was ist das für ein Name?“
„Die Abkürzung von Cynric. Cynric war ein angelsächsischer König.“
„Von den Mallorens habe ich gehört …“ Sie erstarrte. „Rothgar.“
„Der Marquis ist mein Bruder“, bestätigte er. „Ich kann nichts dafür.“ Wahrscheinlich wünschte sie sich jetzt inbrünstig, sie hätte ihn am Straßenrand liegengelassen. Rothgar war ein Mann, den man sich besser nicht zum Feind machte. Sie erholte sich jedoch rasch. „Ich beurteile Euch nach Eurem eigenen Handeln, Sir, das schwöre ich Euch. Schirrt jetzt die Pferde aus.“
Cyn salutierte ironisch. „Aye, Aye, Sir.“ Er stieg vom Kutschbock und zog den Mantel und die eng auf Taille gearbeitete Jacke aus. Bevor er sich an die Arbeit machte, stopfte er das Spitzengeriesel an seinen Handgelenken in den Ärmel, damit es keinen Schaden nahm. Die Sonne war untergegangen; das Licht war spärlich. Trotz der schweren Arbeit spürte Cyn die feuchte Kälte. Das Ausschirren dauerte eine Weile, und sie kam ihm nicht zu Hilfe, sondern saß nur da, die Pistole im Anschlag. Einmal nur blickte sie über seine Schulter hinweg und sagte: „Geh zurück ins Haus, Verity. Hier ist alles in Ordnung. Wir kommen gleich nach.“ Cyn blickte sich um und sah den Schimmer eines hellen Gewands, das sich auf das Häuschen zubewegte. Er hätte wetten mögen, dass es sich um den zweiten Straßenräuber handelte. Die Situation faszinierte ihn mehr und mehr. Was trieben zwei junge Frauen, offenbar von guter Herkunft, in diesem Pächterhäuschen?
Warum überfielen sie Kutschen?
Und was um alles in der Welt wollten sie mit seiner Kutsche? Er rieb die Pferde mit Büscheln von trockenem Gras ab und legte die Decken über ihre Rücken, die Hoskins für eventuelle Wartezeiten bereithielt. „Sie könnten Wasser gebrauchen“, sagte er.
„Hinter der Obstwiese fließt ein Bach. Sie werden ihn schon finden. Wir gehen jetzt ins Haus. Ihr tragt die Beute.“ Cyn griff nach seinem Mantel und seiner Jacke, machte sich aber nicht die Mühe, sie wieder anzuziehen. Dann ging er zur Kutsche und holte das Schmuckkästchen. Nachdenklich musterte er die Pistole. Es wäre lächerlich einfach gewesen, sie zu ergreifen und seinen Widersacher zu erschießen. Doch er ließ die Waffe liegen und überlegte, ob er diesen Entschluss wohl würde bereuen müssen.
Binnen einer halben Stunde wusste er, dass die Antwort Ja lautete.
Er lag mit gespreizten Armen und Beinen, Hände und Füße sorgfältig an massive Pfosten gefesselt, auf einem Messingbett und sah wütend zu den drei über ihn geneigten Frauen auf. „Wenn ich mich befreit habe, drehe ich Euch allen den Hals um.“
„Deswegen seid Ihr ja gefesselt“, sagte die Frau, die immer noch vorgab, ein Mann zu sein. „Wir hätten keinen Augenblick Ruhe, wenn Ihr frei wärt.“
„Ich habe Euch mein Wort gegeben, dass Ihr von mir nichts zu befürchten habt.“
„Nein, das habt Ihr nicht. Ihr habt gesagt, Ihr würdet uns nicht den Behörden ausliefern. Aber womöglich führt Ihr anderes im Schilde – zum Beispiel etwas gegen meine Schwester und ihre Kinderfrau.“
Cyn musterte sie versonnen. ‚Charles‘ erwies sich als faszinierendes Rätsel. Sie hatte Mantel, Hut und Mundtuch abgelegt, als sie das Häuschen betrat. Kurz darauf hatte sie sich gedankenverloren auch der Perücke entledigt. Das verstand er. Er mochte auch keine Perücken; sein eigenes Haar war ihm lieber.
Auch ohne das Mundtuch wirkte sie einigermaßen überzeugend als junger Mann. Ihr Anzug aus braunem Samt saß gut, und falls darunter ein Busen schwoll, war er angemessen unter den Rüschen ihres Hemds verborgen. Ihr Kopf war nicht geschoren, doch ihr Haar, nur leicht gewellt, lag wie eine glatte goldbraune Kappe an ihrem Schädel an. Das war eine außergewöhnliche Frisur für eine Frau, sah aber nicht so schockierend aus, wie man vermutet hätte – vielleicht, weil die Dame nicht eben über weiche Züge verfügte. Sie war ein hübscher Junge.
Ihre Haut war natürlich glatt, was ihr das Aussehen eines Sechzehnjährigen verlieh, wenngleich sie wohl eher Anfang Zwanzig sein mochte. Ihre Stimme war von Natur aus ziemlich tief. Falls sie einmal entspannt lächelte, waren ihre Lippen gewiss hinreißend, doch jetzt war ihr Mund verkniffen und böse. Cyn hatte keine Ahnung, warum sie so verflixt böse auf ihn war.
Ihre Gefährtinnen waren ähnlich rätselhaft. Verity, vermutlich ihre Schwester, hatte langes, welliges, glänzend honigblondes Haar und einen weichen, femininen Mund. Im Gegensatz zu Charles verfügte sie über eine üppige Figur. Wahrscheinlich hatte Charles ihre Brüste gewickelt, doch nicht einmal Eisenbänder hätten Veritys großzügige Formen verborgen, die in einem weiten Ausschnitt und lockerem Brusttuch offenherzig zur Schau gestellt wurden. Ihr Kleid allerdings war eher einer Dienstmagd angemessen als einer hochgeborenen Dame.
Verity war offenbar der Inbegriff der femininen Frau. Zum Beweis war sie entschieden nervöser und weichherziger als ihre Schwester. „Wir können ihn nicht ewig so liegen lassen“, sagte sie.
„Natürlich nicht, aber ich will, dass wir vor ihm sicher sind, solange wir essen und die Abreise vorbereiten.“
„Aber La… Aber Charles“, wandte die Kinderfrau ängstlich ein. „Ihr dürft nicht fort, wie Ihr wisst.“ Diese Frau war alt, sehr alt. Sie war klein und etwas gebückt, trug eine Brille mit Halbgläsern und hatte weiches, silbriges Haar. Und sie war Cyns Untergang gewesen. Als Charles ihm befohlen hatte, sich aufs Bett zu legen und sich fesseln zu lassen, hatte er sich geweigert. Die alte Frau folgte jedoch dem Befehl, ihn aufs Bett zu werfen, und die Angst, er könnte ihre zarten Vogelknochen brechen, hatte ihn hilflos gemacht.
Der Versprecher war ihm nicht entgangen. Die alte Dame hätte das Mädchen beinahe Lady Soundso genannt. Also tatsächlich hochgeboren, und doch war die eine überzeugend als Mann verkleidet und die andere als Dienstmädchen.
„Es ist mir völlig gleichgültig, ob ich fort darf oder nicht“, sagte Lady Charles. „Bisher hatte ich keinen Anlass, von hier fortzugehen, dafür aber jeden Grund, mich zu verstecken. Das hat sich inzwischen geändert. Wahrscheinlich komme ich irgendwann hierher zurück. Wohin sonst sollte ich mich wenden?“
„Du kannst bei Nathaniel und mir wohnen“, sagte Verity. „Vielleicht“, antwortete Charles, und ihre Züge wurden etwas weicher. „Aber er wird genug damit zu tun haben, auf dich und William aufzupassen, Liebste.“ Von oben ertönte eine quäkende Stimme. „Da ist er schon wieder. Furchtbar hungrig, der Kleine, wie?“
Verity hastete eine enge Treppe hinauf, und Cyn machte sich bewusst, dass eine seiner beiden Wegelagerinnen Mutter war, und zwar, wie es schien, noch nicht lange. Das erklärte auch ihre überaus üppigen Formen. Unbehagen und Ärger wichen erneuter Faszination. Er freute sich darauf, diese Geschichte seinen Offizierskollegen zu erzählen. Im Winterquartier war Seemannsgarn stets hochwillkommen.
Die ältere Frau verschwand in der Küche, dem einzigen zusätzlichen Raum im Erdgeschoss. Cyn vermutete noch ein Zimmer unter dem Dachgiebel, in dem die Schwestern und das Baby schliefen. Dieser Raum, das Schlafzimmer der alten Dame, wurde als behelfsmäßiger Salon genutzt und beherbergte zudem eine Anzahl von Bündeln, Kisten und Portmanteaus.
Warum waren die Schwestern hier, und warum durfte Charles nicht fort?
Das Mädchen kramte in einer Truhe und beachtete ihn nicht.
„Bekomme ich etwas zu essen?“, fragte Cyn.
„Irgendwann.“
„Was habt Ihr mit mir vor?“
Sie richtete sich auf und trat ans Bett. Dort stellte sie einen Fuß auf die Bettkante und stützte den Ellbogen aufs Knie. Cyn hatte das sichere Gefühl, dass sie ihre Machtposition genoss.
„Vielleicht lassen wir Euch einfach so hier liegen.“ Er sah ihr in die wütenden grauen Augen. „Warum?“
„Warum nicht?“
„Ich habe Euch nicht das Geringste getan. Vielmehr habe ich nach Möglichkeit vermieden, dass meine Leute Zeter und Mordio schreien.“
„Warum?“
Inzwischen erschreckte es ihn, dass sie ihm so sehr misstraute und so große Angst vor ihm hatte. Aus diesem Grund war er auch gefesselt worden. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus Angst. Dank seiner täuschend zarten Erscheinung war Cyn nicht gewöhnt, dass Frauen Angst vor ihm hatten. Er wählte seine Worte mit äußerster Sorgfalt. „Ich hatte das Gefühl, Ihr seid nicht schlecht und wolltet mir nichts ernsthaft Böses. Ich will Euch nicht am Galgen sehen. Nein, ich möchte Euch vielmehr helfen.“
Sie setzte den Fuß wieder auf den Boden und wich auf verräterische Art zurück: „Warum?“
„Vermutlich habt Ihr einen guten Grund für Euer Tun, und ich bin überreif für ein Abenteuer.“
Sie sah ihn voller Empörung an. „Ihr seid überreif fürs Irrenhaus.“
„Das glaube ich nicht. Ich halte nur nicht viel von Langeweile.“
„Langeweile hat auch ihre guten Seiten, glaubt mir.“
„Ich habe sie bislang nicht kennengelernt.“
„Dann könnt Ihr Euch glücklich schätzen.“ Zum ersten Mal fragte er sich, ob sie ernsthaft in Schwierigkeiten stecken mochte. Er hatte eigentlich eher einen mädchenhaften Streich vermutet, bezweifelte nun jedoch, dass diese energische junge Frau angesichts von Kleinigkeiten so bitter wirken würde. „Ihr seid in Gefahr, nicht wahr?“ Ihre Augen weiteten sich, aber sie sagte nichts. „Umso mehr Grund habt Ihr, mir zu vertrauen und Euch helfen zu lassen.“
Sie hob ruckartig den Kopf. „Ich traue keinem M…“ Sie fing sich und vollendete den Satz: „Menschen.“ Er aber wusste, dass sie hatte sagen wollen: „Ich traue keinem Mann.“
„Mir könnt Ihr trauen.“ Sie lachte kurz und bitter.
Er wartete, bis er Gelegenheit hatte, in ihre verhangenen Augen zu blicken. „Auf dem Sitz in der Kutsche liegt eine geladene Pistole. Anfangs habe ich sie nicht benutzt, weil Eure Schwester meine Leute mit der Waffe bedrohte. Als ich Eure Beute holte, habe ich die Waffe nicht benutzt, weil ich es nicht wollte. Ich bin ein hervorragender Schütze. Ich hätte Euch mit Leichtigkeit entwaffnen, zum Krüppel schießen oder töten können.“
Sie blickte ihn finster an, machte auf dem Absatz kehrt und ging. Er hörte die Haustür schlagen und wusste, dass sie zur Kutsche ging, um sich zu vergewissern.
Wenig später trat auf Zehenspitzen die alte Frau ein, eine Schnabeltasse in der Hand. „Ihr könnt sicher etwas zu trinken vertragen, Mylord“, sagte sie und ließ ihn behutsam von dem erschreckend starken, süßen Tee trinken. So mochte er ihn gewöhnlich nicht, aber er war trotzdem dankbar. Als er fertig war, tupfte sie mit einem schneeweißen Tuch ein paar Tröpfchen ab. „Macht Euch keine Sorgen“, sagte sie und tätschelte seine gefesselte Hand. „Niemand wird Euch etwas zuleide tun. Ch… Charles ist in letzter Zeit ein wenig gereizt.“ Sie schüttelte den Kopf, und Angst trübte ihre Augen. „Das alles war so schrecklich …“
Wieder hatte er das Gefühl, dass es hier nicht um Kleinigkeiten ging.
„Wie soll ich Euch nennen?“
„Ach, einfach Nana. So nennen mich alle, warum nicht auch Ihr? Tun Euch die Hände weh? Ich habe Euch doch nicht zu stramm gefesselt, oder?“
„Nein“, versicherte er ihr, obwohl seine Hände kribbelten wie von tausend Nadelstichen. Er wollte nicht, dass Charles zurückkam und ihn frei vorfand, denn dann würde sie vermuten, dass er sie lediglich aus dem Haus hatte haben wollen. Er versuchte, Nana weitere Informationen zu entlocken. „Und wie soll ich Miss Verity nennen?“
„Oh“, sagte die alte Dame, die weiß Gott nicht auf den Kopf gefallen war, „Verity reicht, meint Ihr nicht? Ihr müsst mich jetzt entschuldigen, Mylord, das Essen steht auf dem Feuer.“
Chastity Ware eilte durch den dunklen Obstgarten zu der schattenhaften Kutsche. In der Küche hatte sie im Vorbeigehen nach den Duellpistolen und der Muskete gegriffen. Es war höchste Zeit, diese und die Pferde zurückzugeben. Doch in erster Linie, das musste sie sich eingestehen, ging es ihr darum, die Behauptung ihres Gefangenen zu überprüfen.
In ihrem Kopf brodelten düstere Gedanken. Was war nur in sie gefahren, dass sie ausgerechnet Cyn Malloren entführen musste?
Die Kutsche zu behalten war vernünftig, auch wenn der Einfall ihr ganz plötzlich gekommen war. In einem Privatfahrzeug würden Verity und der Säugling bedeutend angenehmer reisen als in der Postkutsche.
Und es war auch sinnvoll gewesen, ihn zum Kutschieren zu zwingen. Sie hatte nicht selbst lenken können, weil sie den Mann nicht aus den Augen lassen durfte. Darauf, dass Verity ganz gleich, in welcher Notsituation, auf einen Menschen schoss, konnte sie sich nicht verlassen. Trotzdem hätte es gereicht, ihn ein kleines Stückchen kutschieren zu lassen, um ihn dann in der Einöde abzusetzen. Sie konnte ein Gig lenken. Einen Vierspänner zu dirigieren war bestimmt nicht sehr viel anders.
Ein dreistes Mannsbild war das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte.
Im Grunde war es gerade seine unerträgliche männliche Arroganz gewesen, die sie so reizte.
Da hatte er gestanden, in Blau und Silber und schäumender Spitze, unanständig schön und von ihren Pistolen nicht im Geringsten beeindruckt. Als er ihr eine Prise Schnupftabak anbot, hatte es sie gedrängt, seiner Selbstsicherheit einen Schlag zu versetzen, ihn im Dreck liegen zu sehen. Doch wie er richtig vermutet hatte, wäre sie nicht in der Lage gewesen, ihn niederzuschießen. Dann hatte er ihr auch noch allen Wind aus den Segeln genommen, indem er diese freundlichen Worte zu seinen Dienstboten sprach. Wenn sie seinen Befehlen gehorchten, würde ihre Verfolgung sich verzögern oder sogar überhaupt nicht stattfinden. Zu gern hätte sie gewusst, was für ein Spielchen er trieb, aber immerhin hatte sie ihn für eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und das ging ihm gewaltig gegen den Strich! Mit einem grimmigen Lächeln öffnete sie den Schlag der Kutsche. Im Inneren war es dunkel, und Chastity musste nach der Waffe tasten, doch sie fand sie auf dem Sitz, wie Cyn gesagt hatte. Sie nahm die Pistole an sich und sah im fahlen Licht des Viertelmondes, dass beide Läufe geladen und schussbereit waren. Natürlich hatte der Mann nur aufgeschnitten mit seiner Behauptung, er hätte sie entwaffnen, verwunden oder töten können – schließlich war sie selbst bewaffnet –, doch sie musste zugeben, dass er im Falle eines Versuchs eine Chance gehabt hätte.
Die Einsicht, dass sie ihm durch ihre Unvorsichtigkeit diese Chance eingeräumt hatte, ließ sie erzittern. Voller Verzweiflung schloss sie die Augen. Vielleicht war sie der Aufgabe, die sie sich gestellt hatte, doch nicht gewachsen. Aber sie musste ihre Schwester und ihren Neffen in Sicherheit bringen. Verity war erst gestern eingetroffen, wenngleich ihre Probleme schon viel früher eingesetzt hatten. Ihr Gatte, Sir William Vernham, ein Mann mittleren Alters, war vor knapp zwei Monaten, nur wenige Tage nach der Geburt seines Sohnes, gestorben. Sein Tod hatte zwischen dem Onkel des Kindes, Henry Vernham, und dem Großvater – Veritys und Chastitys Vater, dem Earl of Walgrave – einen erbitterten Kampf um die Vormundschaft für das Kind ausgelöst. Henry hatte das erste gerichtliche Scharmützel für sich entscheiden können und war nach Vernham Park gekommen, um das Heft in die Hand zu nehmen. Schon bald war in Verity die Angst erwacht, dass ihrem Kind Gefahr drohen könnte, denn Henry war nicht zu trauen. Würde Veritys kleiner Sohn sterben, stünden ihm Titel und Vermögen zu. Ihre Ängste hatten sich noch gesteigert, als Henry versucht hatte, sie von ihrer Familie und ihren Freunden zu isolieren. Da hatte sie mit dem Säugling die Flucht ergriffen und war in dieses Häuschen gekommen.
Jetzt fürchtete sie Henry und wagte es nicht, bei ihrem Vater Schutz zu suchen. Earl Walgrave würde sie zwar gewiss behüten, aber gleichzeitig flugs eine neue Ehe arrangieren, die ihm zum Vorteil gereichte. Nachdem sie das erbärmliche Leben mit William hatte ertragen müssen, war Verity nun entschlossen, keinen anderen als ihren Freund aus Kindertagen zu ehelichen, nämlich Major Nathaniel Frazer. Chastity war entschlossen, ihr dabei zu helfen. Das Problem war nur, dass die Schwestern praktisch über keinen roten Heller verfügten und dass bereits intensiv nach Verity gesucht wurde.
Vor zwei Tagen hatte Henry Vernham das Pächterhäuschen aufgesucht, um Chastity und Nana zu verhören – Chastity hatte kaum Zeit gehabt, wieder in ihre Frauenkleider zu schlüpfen. Sie hatten ihn ohne Schwierigkeiten davon überzeugen können, dass sie nichts von Veritys Aufenthaltsort wussten, denn zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht eingetroffen. Ihre Bestürzung und Sorge waren echt gewesen. Unter dem Eindruck der Erinnerung an diese Konfrontation mit Henry Vernham ballte Chastity die Hände zu Fäusten, denn er war nicht nur der Albtraum ihrer Schwester, sondern zudem der Mann, der ihr eigenes Leben zerstört hatte und schuld daran war, dass sie nun mit geschorenem Kopf und in Männerkleidern liiert leben musste. Sie hatte sich geweigert, auch nur ein Wort mit ihm zu sprechen – wäre sie ihm gegenübergetreten, hätte sie ihm zweifellos den Hals umgedreht –, doch zum Abschied hatte er einen Spruch angebracht, der ihr beinahe jegliche Entschlusskraft geraubt hätte.
„Gewiss bereut Ihr inzwischen, dass Ihr meinen Antrag abgelehnt habt, Lady Chastity, doch nun ist es zu spät, Euch eines Besseren zu besinnen. Wisst Ihr, inzwischen seid Ihr einfach nicht mehr tragbar.“
Sie hatte gekocht vor Wut; hätte sie in diesem Moment eine Pistole zur Hand gehabt, wäre der Mann jetzt tot. Als Verity ankam und ihre Geschichte erzählte, war Chastitys Zorn dann abgeklungen und hatte nüchterner Überlegung Platz gemacht. Vernham durfte nicht auch noch Verity ruinieren. Ihnen blieb keine Zeit, um ausgeklügelte Pläne zu schmieden oder gründlich zu überlegen, denn Vernham konnte jeden Augenblick zurückkommen. Allerdings wussten sie, dass sie zum Überleben Geld benötigten und es sich beschaffen mussten. Die Entführung der Kutsche war das Ergebnis eines spontanen Entschlusses gewesen. Jetzt erkannte Chastity, dass es ihrer aller Tod bedeuten konnte. Zum Teufel mit Cyn Malloren. Warum war er nicht der dicke, ängstliche Kaufmann gewesen, den sie sich erhofft hatten?
Chastity betrachtete das prächtige vergoldete Wappen auf dem Kutschenschlag und wünschte dem Besitzer die Hölle an den Hals. Dann lächelte sie und löste einen scharfen Stein aus der Mauer des Obstgartens. Es bereitete ihr große Befriedigung, die Farbe und Vergoldung auf beiden Türen abzuschaben.
Kaum war sie fertig, verließ sie das Gefühl der Zufriedenheit allzu abrupt, und sie schleuderte den Stein von sich. Es war schon richtig gewesen, das Wappen zu entfernen – schon morgen würde man im ganzen Land Ausschau nach der Kutsche der Mallorens halten –, doch was sie fühlte, war nicht recht. Sie lehnte den Kopf an das Gefährt, kämpfte mit den Tränen und fluchte stumm auf die Männer, die die Ursache für ihre Verbitterung waren.
Ihr Vater, ihr Bruder und Henry Vernham.
Ein Fluch entfuhr ihr in die dunkle ländliche Nacht: „In die tiefste Hölle mit allen Männern!“
Doch dann riss sie sich zusammen. Sie brauchte einen kühlen Kopf und musste wachsam sein, um sie alle zu besiegen. Sie vergewisserte sich, dass die Pistole gesichert war, und schob sie in ihre Manteltasche. Sie überlegte, ob sie den Degen auch an sich nehmen sollte, tat es dann aber doch nicht.
Die Reitpferde am Zügel näherte sie sich ihrem eigentlichen Zuhause, Walgrave Towers. Das große Haus lag in vollkommener Dunkelheit, denn von ihrer Familie war niemand in der Residenz. Ihr Vater und ihr älterer Bruder verbrachten den Großteil ihrer Zeit in London und suchten jetzt wahrscheinlich nach Verity; ihr jüngerer Bruder, Victor, ging noch zur Schule. Sie brachte die Pferde in den Stall und schlüpfte durch eine Seitentür ins Haus.
Hier herrschte Stille, bis auf das Ticken der Uhren in den verlassenen Räumen, doch für Chastity schrie es in diesem Haus von Schmerz und bitteren Erinnerungen. Frischen Erinnerungen. Als Kind war sie hier nicht unglücklich gewesen. Ihr Vater war gewöhnlich nicht zu Hause, und ihre verschüchterte Mutter war allem Ärger aus dem Weg gegangen. Doch vor wenigen Monaten hatte ihr Vater Chastity hierhergebracht. Hier hatte er versucht, sie in die Ehe mit Henry Vernham zu zwingen.
Ohne Licht fand Chastity in die Waffenkammer, wo sie mithilfe von Feuerstein und Zunder eine Kerze anzündete. Sie entlud und reinigte die Duellpistolen und legte sie zurück in den mit Samt ausgeschlagenen Kasten. Ihr älterer Bruder würde außer sich sein vor Zorn, wenn er erfuhr, dass seine gönnerhafte Ausbildung der kleinen Schwester sie zu ihrem Plan befähigt hatte. Chastitys Hände hielten inne, als sie sich an ihre letzte Begegnung mit Fort erinnerte – an seinen Zorn, an seine grausamen, verletzenden Worte … Sie presste die Lippen zusammen und fuhr in ihrer Arbeit fort, reinigte die Muskete und stellte sie zurück in den Ständer. Sie war nicht sonderlich vorsichtig. Die Diener wussten zweifellos, dass sie im Hause war und was sie hier trieb, doch sie würden es ignorieren, wenn sie konnten. Sie bildete sich gern ein, es läge daran, dass sie sie wenigstens ein bisschen mochten. Zynisch sagte sie sich jedoch, dass sie lieber nicht in den erbitterten Kampf ihrer Herrschaft hineingezogen werden wollten.
Die Atmosphäre in diesem Haus war bedrückend, sie musste schnellstens nach draußen. Sie blies die Kerze aus und hastete die dunklen Flure entlang zur Tür im Westturm, hinaus an die frische Luft und in die Freiheit. Auf den Männergang achtend, den sie eingeübt hatte, schritt sie zurück zum Pächterhäuschen.
Sie musste sich beeilen, um rechtzeitig zurück zu sein, bevor ihre weichherzige Schwester und deren Kinderfrau sich wegen dieser hübschen, freundlich wirkenden Viper, die ihr in die Falle gegangen war, zum Narren machten.
Zweites Kapitel
Chastity fand Nana unschuldig in der Küche beschäftigt. „Das Essen ist gleich fertig, meine Liebe“, sagte die alte Kinderfrau. „Wirst du ihn losbinden oder muss ich ihn füttern?“
Obwohl Nanas Tonfall freundlich klang, hörte Chastity doch den Tadel heraus. „Wir können ihm nicht trauen, Nana, und wir alle haben zu viel zu tun, um ihn ständig im Auge behalten zu können. Er könnte fliehen und die Beamten geradewegs hierherführen.“
Nana hob den Blick von ihrem Kochtopf. „Das hättet Ihr Euch vielleicht überlegen sollen, bevor Ihr ihn herbrachtet.“ Chastity hob das Kinn. „Ich brauche einen Kutscher.“
„Ah.“ Die alte Frau nahm Teller von der Anrichte und fing an, den Tisch zu decken. Chastity bemerkte, dass sie vier Gedecke auflegte, und Veritys Kind, gerade erst zwei Monate alt, war wohl kaum in der Lage, am Tisch Platz zu nehmen. „Ich denke, Ihr könnt ihm trauen, Lady Chastity“, sagte Nana.
Chastity seufzte. „Vergiss nicht, ich heiße Charles.“ Sie verließ die Küche, um sich mit ihrer Schwester zu beraten. Auf dem Weg durch das zweite Zimmer würdigte sie ihren Gefangenen keines Blickes, legte nur seine Pistole auf eine Kiste und eilte dann leichtfüßig die steile Treppe hinauf. Verity hatte gerade ihr Baby trockengelegt und kleidete es nun unter zärtlichem Geplapper und Kitzeln wieder an.
Chastity fuhr sie an: „Ich verstehe nicht, wie du dich so benehmen kannst, wenn du bedenkst, wer sein Vater ist.“
„Ich denke nicht an seinen Vater“, sagte Verity schlicht. Sie knüpfte das letzte Bändchen des Schlafanzugs, hob das Baby hoch und legte es ihrer Schwester in den Arm. „Schau ihn dir an. Er hat nicht das Geringste mit Sir William Vernham zu tun.“
Das weiche Bündel im Arm geriet Chastity unwillkürlich in den Bann des Babys. „Er ist Sir William Vernham“, betonte sie und schnitt Grimassen, die dem Kind zu gefallen schienen.
Verity hielt in ihrer Aufräumarbeit inne. „Ich weiß. Aber er ist anders.“ Grimmig fügte sie hinzu: „Er wird ein völlig anderer Mann sein. Dafür sorge ich. Und nachdem Sir William nun tot ist, dürfte das entschieden einfacher sein.“ Chastity blickte ruckartig auf. „Sprich so etwas niemals in Gegenwart anderer aus, Verity, sonst könnte dein Schwager auf die Idee kommen, von Mord zu reden.“ Verity erbleichte. „Wie könnte er das tun? William starb an einem Herzanfall in den Armen seiner Geliebten.“
„Schon, aber um ihre Ziele zu erreichen, sind Männer zu allem fähig, und Vernham ganz besonders. Die Behörden würden dir wahrscheinlich einen Giftanschlag unterschieben, mit einem Mittel, das sich nicht nachweisen lässt.“
„Nicht alle Männer sind grausam“, wandte Verity sanft ein, „Nathaniel ist ein guter Mensch.“
„Das mag sein, aber wenn es eine Gerechtigkeit auf der Welt gäbe, hättest du ihn heiraten dürfen.“
„Ach, Chastity …“
„Vater wusste, dass du Nathaniel liebst, und hat dich trotzdem gezwungen, Sir William zu heiraten – einen fetten alten Gutsherrn mit einem Haufen Geld und keiner Spur von Stil.“ Sie lehnte das Baby an ihre Schulter und klopfte ihm sacht den Rücken.
Verity nagte an ihrer Unterlippe. „Es ist die Pflicht einer Tochter, den Mann zu heiraten, den der Vater vorgesehen hat.“
„So heißt es, aber es wäre doch schön, in einem solchen Opfer wenigstens einen Sinn erkennen zu können. Vater hat nicht nur dich mit Sir William verheiratet, sondern auch versucht, mich zur Ehe mit dessen Bruder zu zwingen. Was hätte er durch eine solche Verbindung gewonnen?“ Verity warf die schmutzigen Windeln und Tücher in einen Eimer. „Ich weiß es nicht“, gab sie zu. „Eines ist klar“, sagte Chastity. „Du hast deine Pflicht getan. Nicht einmal im Traum solltest du daran denken, Vater noch einmal zu Willen zu sein. Du sollst Nathaniel heiraten.“ Verity nickte. „Dazu bin ich fest entschlossen, wenngleich mich mein Gewissen plagt. Ich wollte, ich hätte deine Entschlusskraft.“
„Glaub mir“, sagte Chastity und schauderte. „Das Wissen um deine unglückliche Ehe gab mir damals die Kraft, mich Vater zu widersetzen. Sir William war ein niederträchtiger Kerl, und sein Bruder ist, wenn auch nach außen hin glatter und geschliffener, aus demselben Holz geschnitzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er plant, einen Säugling umzubringen.“
„Aber ich verstehe nicht, woher du den Mut genommen hast, Vater zu widersprechen. Schau mich doch an. Ich kann mich seinem Willen nur entziehen, indem ich weglaufe.“ Chastity stand auf, legte das schläfrige Kind behutsam in sein Bettchen und deckte es zu. Dann ging sie hinüber zu dem winzigen Giebelfenster und sah blicklos in den vom Küchenfenster her beleuchteten Garten hinunter. „Ich weiß ehrlich nicht, ob ich mutig genug gewesen wäre, Verity, wenn ich gewusst hätte … Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er so weit gehen würde. Aber als ich einmal angefangen hatte, mich zu wehren, konnte ich irgendwie nicht wieder aufhören …“
Verity nahm ihre Schwester in die Arme, und die beiden jungen Frauen klammerten sich aneinander. „Noch vor zwei Jahren“, sagte Verity, „waren wir glücklich und voller Hoffnung. Was ist nur geschehen?“ Doch dann riss sie sich zusammen. „Wir müssen jetzt zum Essen hinuntergehen.“ Sie griff nach dem Eimer und warf einen Blick auf ihre Schwester. „Findest du nicht, dass du ein Kleid anziehen solltest, Liebste? Schließlich ist ein Mann im Haus.“
Chastity wischte sich die Tränen ab und straffte sich. „Ganz sicher nicht. Es wäre nicht klug, ihn wissen zu lassen, dass er es mit drei Frauen zu tun hat.“
„Ach, Chastity“, protestierte Verity, „er ist ein Gentleman.“ „Wieso zum Teufel glaubst du, dass das zu seinen Gunsten spricht? Sir William war ein Gentleman. Henry Vernham und Vater sind angeblich Gentlemen. Und abgesehen davon, dass er ein Gentleman ist, handelt es sich bei unserem Gefangenen auch noch um einen Malloren. Das sind schöne, faszinierende Männer, die dir aber eher die Kehle durchschneiden würden, als dir auf der Straße Platz zu machen. Lass dich bloß nicht von Cyn Mallorens schönen Wimpern einlullen.“ Verity lachte leise. „Aber sie sind wirklich erstaunlich, wie? Vor einem Mann, der so aussieht, kann ich eigentlich keine Angst haben.“
Chastitys Ton war barsch. „Bestimmt haben schon zahlreiche andere diesen Fehler begangen. Und es ist ein tödlicher Fehler.“
„Wirklich, Chastity. Du kannst ihn nicht für so gefährlich halten. Fasanenschießen ist wahrscheinlich die einzige Art von Blutvergießen, die er bisher erlebt hat.“ Chastity schüttelte den Kopf. „Er ist gefährlich, Verity. Ich fühle es. Versuch bitte, mich stets Charles zu nennen oder wenigstens Chas. Und gib niemals unseren vollen Namen preis. Rothgar und Vater sind seit Jahren Todfeinde. Wenn Cyn Malloren erfährt, dass wir Ware heißen, bricht die Hölle los.“
Verity schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr. Sie sah nach William, blies die Kerze aus und ging voran zur Treppe. Dort blieb sie zögernd stehen. „Chas, was ist, wenn er noch einmal versucht, dich zu verheiraten?“
„Vater?“ Chastity lachte rau. „Das ist das einzig Gute an der Geschichte. Durch meinen Widerstand hat er sich dazu hinreißen lassen, mich gründlich zu ruinieren. Kein Mann wird jemals die berüchtigte Chastity Ware heiraten wollen.“
Cyn sah ihr nach, als sie den Raum durchquerte und die Treppe hinaufstieg. Sie hatte die Pistole gefunden, und so nahm er an, dass sie nun von seinen guten Absichten überzeugt war. Doch sie wirkte nicht eben sanftmütiger. Er wollte sie so gern lächeln sehen. Er wollte, dass sie mit ihm sprach, ihm ihre Probleme anvertraute, damit er ihre Bürde schultern konnte. Zu seiner Verwunderung hatte er innerhalb kürzester Zeit ein sehr warmes Gefühl für die mutige junge Frau und ihre unkonventionelle Erscheinung entwickelt.
Die Frisur, die an glattes Otterfell erinnerte, war ausgesprochen merkwürdig, zeigte jedoch ihren wunderschön geformten Kopf. Warum war ihm nie aufgefallen, wie schön so ein Kopf sein konnte? Er genoss die Vorstellung, diesen glatten Schädel zu streicheln, genauso wie die, mit der Hand durch üppige, seidenweiche Locken zu fahren. Dieser Haarschnitt betonte außerdem die klaren, kräftigen Linien ihres Gesichts – die glatte, hohe Stirn, die feine, gerade Nase, das feste Kinn. Selbst diese unauffälligen grauen Augen waren als Bestandteil des Gesamtbildes unvergesslich. Sie entsprach eindeutig nicht dem landläufigen Schönheitsideal der Frauen, aber er selbst ging auch selten mit dem landläufigen Geschmack konform.
Ihre Haltung war die eines geschmeidigen, stolzen Mannes gerade Schultern, fester Schritt. Das fand er erstaunlich erotisch, und er bedauerte, dass sie die Männerkleider wahrscheinlich nur zum Zweck des Überfalls angezogen hatte. Wie sie wohl in einem Kleid aussah?
Er sollte es nicht erfahren. Als sie die Treppe wieder hinunterkam, trug sie immer noch Hosen.
Die beiden Schwestern durchquerten sein Zimmer, und er sagte: „Charles, habt Ihr Euch jetzt davon überzeugen können, dass ich Euch nichts Böses will?“
Sie wandte sich ihm zu. „Solange Ihr aufs Bett gefesselt seid, Mylord, bin ich überzeugt davon.“
„Dann hättet Ihr wohl Angst vor mir, wenn ich frei wäre?“
Sie stemmte die Hände in die Hüften. „Ganz gewiss nicht. Aber warum sollte ich es darauf ankommen lassen?“
Sie war herrlich. „Aus Gründen der Fairness“, erwiderte er freundlich. „Ich habe nichts Unehrenhaftes getan.“
Sie lächelte. „Straßenräuber zu unterstützen ist nicht eben ehrenhaft, Mylord.“
Er erwiderte ihr Lächeln aufrichtig. „Verzeiht. Ich wusste ja nicht, dass Ihr Euch nach dem Galgen sehnt. Bei erster Gelegenheit werde ich Euch behilflich sein.“
„Ich weiß. Deswegen seid Ihr ja gefesselt.“ Er unterdrückte ein Lachen. Die Wortgefechte mit ihr waren der größte Spaß seit Monaten. Was für eine Frau. Und schon hatte er eine neue Waffe gefunden. „Merkwürdige Art, einen Mann zu fesseln“, sagte er. „Seid Ihr einer von der Sorte, die gern einen männlichen Körper betrachten, Charles?“
Von seinen Worten getrieben, betrachtete sie ihn tatsächlich, und verräterische Röte stieg ihr in die Wangen. Sie sah ganz und gar weiblich aus, noch dazu auf unschuldige, verwirrte Art. Und das verursachte ihm eine Erektion. „Hört auf, alle beide“, sagte Verity, die sich, ein Fleischmesser in der Hand, dem Bett näherte. Die Ausbuchtung in seinen Hosen registrierte sie mit einem kaum merklichen Hochziehen der Augenbrauen. „Ich finde, der Mann hat recht“, wandte sie sich an ihre Schwester. „Er hat nichts getan, was eine solche Behandlung rechtfertigen würde. Er kann mit uns essen.“
„Verity, lasse das!“, fuhr Charles sie an. Doch Verity hatte die Stoffstreifen, die Cyn ans Bett fesselten, bereits durchtrennt, und dankbar richtete er sich auf und massierte seine tauben Handgelenke.
„Mein lieber Mann“, sagte er, erfreut darüber, nun auf gleicher Ebene mit ihr streiten zu können, „ich weiß die Freundlichkeit Eurer Schwester zu schätzen, doch wenn Ihr der Herr in diesem Hause seid, solltet Ihr Euer Weibervolk dann nicht ein bisschen besser unter Kontrolle haben?“ Ihre Augen blitzten. „Soll ich vielleicht eine Peitsche zu Hilfe nehmen?“
Cyn zwinkerte Verity zu. „Ist Eure Schwester denn so ungezogen?“
„Ach, hört endlich auf, Mylord“, sagte Verity, die sich das Lachen verbeißen musste. „Ihr reizt ihn absichtlich. Wenn Ihr so weitermacht, muss ich Euch wieder fesseln.“ Er hob die Hände zum Zeichen, dass er sich geschlagen gab, und folgte den Schwestern in die aromatisch duftende Küche. Wie lange mochte es noch dauern, bis jemandem ein unverzeihlicher Fehler unterlief, der Charles als … – ja, als was? Charlotte? – auswies. Verstohlen musterte er das Mädchen mit dem eisigen Gesicht. Charles passte entschieden besser zu ihr als Charlotte.
Nana strahlte, als sie Cyn ohne Fesseln sah, und wollte ihm einen Platz am Kopf des Tisches zuweisen. „Nein, nein“, wehrte Cyn ab und wies auf Charles. „Als Oberhaupt der Familie steht Euch dieser Platz zu.“ Rücksichtslos seinen beträchtlichen Charme einsetzend, lächelte er reihum alle an. „Dürfte ich wohl Euren Familiennamen erfahren?“
„Nein“, sagte Charles kurz angebunden und setzte sich. „Seid froh, dass Ihr etwas zu essen kriegt.“ Nana stellte einen großen Topf mit Kaninchenragout auf den Tisch.
„Noch dazu so köstliches Essen“, bemerkte Cyn mit einem glücklichen Lächeln.
Nana strahlte. „Es macht einfach Spaß, für einen Mann zu kochen.“
Cyn warf einen fragenden Blick in Charles’ Richtung. „Aber diese jungen Burschen, die gerade erst ausgewachsen sind, haben doch gewöhnlich einen mächtigen Appetit.“ Charles wurde rot. „Ich bin kein junger Bursche.“
„Ich bitte vielmals um Verzeihung, Sir. Ich weiß wohl, bei manchen Männern dauert es länger, bis der Bartwuchs einsetzt …“
„Reicht mir Euren Teller, Mylord“, bat Verity hastig und füllte ihm eine große Portion von dem Ragout auf. „Kartoffeln?“
Für den Rest der Mahlzeit verbot Cyn sich edelmütig weitere Neckereien.
„Nun“, sagte er, als sie vor gefüllten Teetassen saßen, „berichtet mir doch bitte von Euren Schwierigkeiten, damit ich Euch helfen kann.“
„Warum solltet Ihr?“, fragte Charles kalt. „Wie ich schon sagte, ich giere nach Abenteuern. Ohne Abenteuer kann ich nicht leben. Ich wollte schon immer ein fahrender Ritter sein.“
Es war Verity, die darauf einging. „Aber wie kommt Ihr darauf, dass ich eine bedrängte Maid sein könnte, Mylord?“ Er sah sie an. „Seid Ihr es denn nicht?“ Sie lächelte traurig. „Eine Maid ist gewöhnlich eine Jungfrau, und das bin ich ganz gewiss nicht. Bedrängt fühle ich mich allerdings durchaus …“
„Nicht, Verity!“, fiel Charles ihr scharf ins Wort. „Vertrau ihm nicht. Warum bloß musst du immer so vertrauensselig sein? Wenn du es ihm verrätst, schlägt er sich auf die Seite der anderen.“
„Was sollen wir denn tun?“, fragte Verity. „Wir brauchen jemanden für die Kutsche, und mir ist wohler, wenn …“
Die Worte wenn ein Mann an unserer Seite ist standen nahezu hörbar im Raum, und Cyn sah das böse Funkeln in Charles’ Augen. Handelte es sich hier lediglich um ein wildes gelangweiltes Mädchen, das ein Mann sein wollte? Hoffentlich nicht.
„Ihr würdet Euch besser fühlen, wenn ein älterer Mann mit mehr Erfahrung Euch beisteht“, ergänzte er, ohne mit der Wimper zu zucken. „Lieber Charles, grämt Euch doch nicht deswegen. Es ist klar, dass Ihr Euer Bestes tut, um Eurer Schwester zu helfen, doch es ist niemals klug, ein aufrichtig gemeintes Hilfsangebot auszuschlagen. Ich bin fast zehn Jahre älter als Ihr und verfüge über Erfahrungen, die Euch noch fehlen. Sagt mir, wohin Ihr reisen wollt, und ich tue, was in meinen Kräften steht, um Euch sicher dorthin zu bringen.“
„Nach Maidenhead“, sagte Verity fest. „Mein künftiger Ehemann, Major Nathaniel Frazer, ist dort stationiert.“ War er der Vater des Kindes? Verity trug einen Ehering, doch das musste nichts zu bedeuten haben. „Das dürfte kein Problem darstellen. Ich muss allerdings dazu sagen“, erklärte er vorsichtig, „dass ich bei der Sache eigentlich überhaupt keinen Haken sehe.“
„Außer Geld“, bemerkte Charles gedehnt.
„Ah. Deshalb also der Überfall auf meine Kutsche.“
„Genau.“
Niemand schien bereit zu sein, ihm weitere Informationen zukommen zu lassen, und so hakte Cyn noch einmal nach. „Ich verstehe, dass es verlockend ist, in meiner ausgesprochen bequemen Kutsche zu reisen, doch in ihren Besitz zu gelangen war immerhin mit gewissen Risiken verbunden. Wäre es da nicht klüger gewesen, sich mit der Postkutsche zu begnügen oder auch mit diesen beiden Vollblütern, die Ihr geritten habt?“
„Die Pferde gehören nicht uns“, erklärte Verity. „Hätten wir sie behalten, wäre die Hölle los gewesen. Allerdings stimme ich Euch zu: Es wäre klüger gewesen, die Postkutsche zu nehmen.“
„Ja“, mischte Charles sich unvermittelt ein. „Du hast recht. Morgen bedienen wir uns der Kutsche seiner Lordschaft, um nach Shaftesbury zu fahren, wo wir uns dann einen Platz in der Postkutsche besorgen.“ Sie blickte Cyn eiskalt an. „Das heißt, wenn wir Euch bis dahin trauen können, Mylord.“
„Ihr könnt mir bis in die Hölle trauen und wieder zurück“, sagte er schlicht, „aber nur, wenn Ihr mich an Eurem Abenteuer teilhaben lässt. Das lasse ich mir nicht nehmen.“
„Verdammt, das hier ist kein Spiel!“
„Dann ist echte Gefahr damit verbunden?“
„Ja.“
„Aus welcher Richtung?“
Sie aber presste die Lippen zusammen und klärte ihn nicht auf.
„Ich finde wirklich, wir sollten es ihm sagen, Lieber“, drängte Verity.
„Darüber sprechen wir später.“ Charles machte der Diskussion ein Ende, indem sie aufstand. „Im Augenblick erhebt sich allerdings die Frage, wo er schlafen soll.“ Cyn konnte nicht widerstehen. „Vielleicht bei Euch, Sir?“ Charles erstarrte, und Verity verschluckte sich an ihrem Tee. „Ist das ein Problem?“, fragte Cyn, an Charles gewandt. „Ich versichere Euch: ich schnarche nicht.“
„Aber ich“, erwiderte sie hastig.
„Ach so. Sagt mir, Sir, wo schlaft Ihr denn überhaupt?“
„Oben“, antwortete sie unvorsichtig. Die Röte ihrer Wangen verriet ihre Erregung, und sie fügte hinzu: „Wir haben den Raum durch einen Vorhang unterteilt.“
„Da Eure Schwester und ihr Kind zum Glück einen sehr tiefen Schlaf haben.“ Auf ihren verständnislosen Blick hin fügte er hinzu: „Wegen Eures Schnarchens.“
Nur mit äußerster Mühe konnte Cyn sich eines Grinsens enthalten. Lieber Himmel, wenn Augen tatsächlich hätten Feuer sprühen können, dann wäre er jetzt ein Häuflein Asche. Diese blitzenden Augen, diese reinen, festen Lippen und die zornige Röte ihrer Wangen verliehen ihr eine erstaunliche Schönheit.
Eine Woge purer Lust überrollte ihn unvermittelt, verbunden mit dem Wunsch, sie hier und jetzt ihrer Kleider zu entledigen und die weiblichen Geheimnisse unter dem Männergewand zu lüften, diese Augen vor Leidenschaft statt vor Wut brennen, diese Wangen vor Erregung glühen zu sehen. Zum Glück lag er nicht mehr mit gespreizten Armen und Beinen gefesselt auf dem Bett, sonst hätte die Reaktion seines Körpers sie zweifellos in Ohnmacht sinken lassen. Eilig senkte er die Wimpern, fasste aber erneut den Entschluss, dieses Abenteuer bis zum Ende auszukosten. Rasch wurde entschieden, dass Cyn in der Küche schlafen sollte, doch leider stand nur eine einzige Decke als Unterlage zur Verfügung. Nachdem es sich als unumgänglich erwiesen hatte, dass die drei ihm würden vertrauen müssen, erhielt er die Erlaubnis, zur Kutsche zu gehen und seinen Reisekoffer zu holen. Aus einigen Kleidungsstücken und seinem Mantel bereitete er sich ein annehmbares Bett, ein bedeutend besseres sogar, als ihm manches Mal in seinem Regiment zur Verfügung gestanden hatte. Immerhin war es in der Küche angenehm warm und trocken.
Nana und Verity trugen das Geschirr ab. Charles ging nach draußen und holte Wasser vom Brunnen, dann setzte sie sich und las ein Buch. Auch Cyn machte es sich bequem. Er zog seine Stiefel aus und reinigte sie mit einem Lappen. Wer wusste schon, wie lange sie auf Jeromes liebevolle Pflege würden verzichten müssen? Er hängte seine Jacke und seine Weste über eine Stuhllehne. Dann löste er die Schleifen, die seinen Zopf hielten, und kämmte sein Haar. Nach kurzem Zögern – schließlich waren Damen zugegen – band er sein Halstuch los und knöpfte sein Hemd auf. Nana und Verity beachteten ihn nicht, doch Charles sah genau zu. Cyn sah, wie sie den flackernden Blick aus ihrem Buch hob, doch ansonsten zeigte sie keine Reaktion. Er musste sich etwas Besseres einfallen lassen. Nana ging zu Bett. Verity sorgte sich noch ein paar Minuten um Cyns Wohlergehen, dann ging sie ebenfalls nach oben. Cyn gähnte und schlüpfte in sein behelfsmäßiges Bett. Er wartete gespannt darauf, wie das Mädchen sich nun verhielt. Sie klappte das Buch zu und nahm vor seinem Lager Aufstellung. Da er nicht mehr gefesselt war, bereitete es Cyn keine Schwierigkeiten, zu ihr aufblicken zu müssen. Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lächelte so verführerisch, wie es ihm möglich war, zu ihr auf. „Möchtet Ihr vielleicht doch mein Schlafquartier mit mir teilen?“ Sie rang nach Luft und trat einen Schritt zurück, hatte sich jedoch im nächsten Augenblick wieder gefangen. „Ich wollte lediglich klarstellen, Mylord, dass ich Euch töte, falls Ihr falsch spielt. Die anderen zwei sind weichherzig, ich aber nicht.“ Kein loses Mädchen, schade, schade. „Habt Ihr schon einmal jemanden getötet, Charles?“ Ihre Lippen zitterten verräterisch. „Nein.“ „Ich aber.“
„Es fällt mir schwer, das zu glauben.“
„Ach ja? Ich bin Captain im achtundvierzigsten Regiment.“ Sie vergaß, den Mund zu schließen.
„Zurzeit bin ich auf Genesungsurlaub, aber ich habe dem Tod schon oft genug ins Auge geblickt. Das Töten ist nicht so einfach, wie Ihr denkt, es sei denn, man hat einen zwingenden Grund.“
Jede Spur von Schwäche verschwand aus ihrem Gesicht. „Dann dürfte es mir nicht schwerfallen.“ Sie löschte die Kerzen und ließ ihn im milden Schein des abgedeckten Feuers zurück.
Cyn war jäh ernüchtert. Er blickte zu den Balken an der dunklen Decke auf. Wer, so fragte er sich, mochte das Mädchen so tief verletzt haben, dass sie bereit war zu töten? Wer war schuld daran, dass sie kein Geld besaß, sich als Mann verkleidete und Angst hatte? Ohne die Antworten zu wissen, machte er ihre Angelegenheit zu der seinen. Er hatte seine bedrängte Maid gefunden, doch Verity war es nicht. Es war Charles, schwierig, zornig und wunderschön.