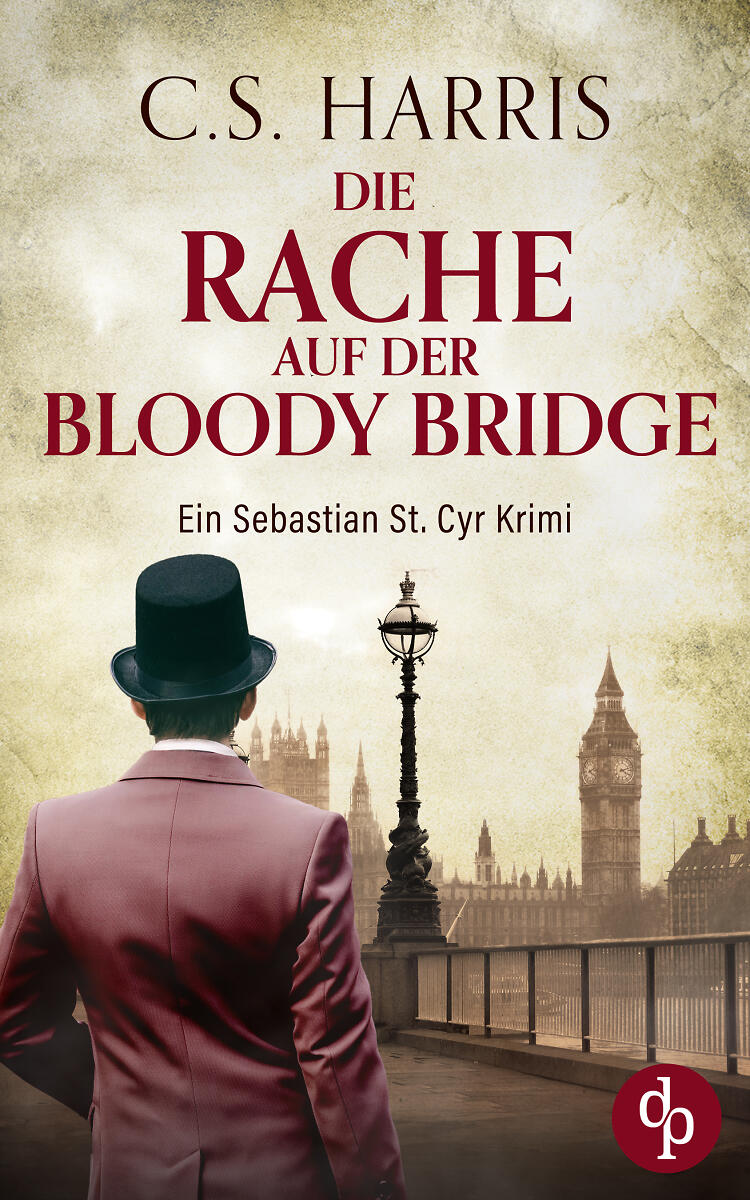Kapitel 1
Sonntag, 21. März 1813
Die Brücke wurde Bloody Bridge genannt.
Sie lag am Ende einer langen, gewundenen Straße, die vom Sloane Square mit seinen beruhigend flackernden Öllampen weit wegführte, noch hinter die letzten baufälligen Cottages am äußersten Rand der Felder, die im Mondlicht schwarz aussahen. Die schmale Backsteinbrücke war an beiden Seiten von einem hohen Steingeländer begrenzt, und sie war abgetreten und baufällig vom Alter. Das Moos, das sich im tiefen und kühlen Schatten der am Bachufer stehenden Ulmen gebildet hatte, machte die Backsteine dort glitschig.
Cian O’Neal mied diesen Ort möglichst sogar bei Tage. Es war Mollys Idee gewesen, hierher zu kommen, denn am anderen Ende der Brücke stand ein verlassener Schuppen mit einem warmen, weichen Heuboden, der junge Liebende in Not verlockte. Aber als der Wind jetzt in die Ulmen am Bach fuhr und das entfernte, jammernde Jaulen eines Hundes herantrug, spürte Cian, wie das pulsierende Drängen, das ihn hierher getrieben hatte, verebbte.
»Is vielleicht doch keine so gute Idee, Molly«, sagte er und verlangsamte den Schritt. »Der Schuppen, mein ich.«
Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn aus ihren dunklen Augen im rundlichen, fröhlichen Gesicht an. »Was ist los, Cian?« Sie drängte ihren warmen, weichen Körper an seinen und redete mit heiserer Stimme weiter: »Überlegst du dir’s noch mal?«
»Ne, es is nur …«
Der Wind frischte auf und ließ irgendwo in der Nacht einen Laden klappern. Er zuckte zusammen.
Zu seiner Beschämung sah er, wie ein Leuchten über ihr Gesicht glitt, dann lachte sie glockenhell auf. »Du hast ja Angst.«
»Nein, hab ich nich«, sagte er, auch wenn beide wussten, dass es gelogen war. Er war ein großer Bursche, wurde nächsten Monat achtzehn und war stark und gesund. Aber jetzt gerade fühlte er sich wie ein kleiner Angsthase, der sich von den alten irischen Märchen vom Dullahan ins Bockshorn jagen ließ.
Sie griff mit beiden Händen nach seiner, ging rückwärts über die Straße Richtung Brücke und zog ihn mit sich. »Na, dann komm«, sagte sie. »Soll ich als Erste rüber gehen?«
Am frühen Abend hatte es geregnet, ein kurzer, heftiger Schauer, und die tropfenden Blätter der Bäume hatten die Straße matschig und rutschig gemacht. Er spürte im Nacken ein eisiges Prickeln und versuchte, an die süße Wärme des Heubodens und die Art, wie Mollys weicher und williger Körper sich unter ihm anfühlen würde, vorzustellen.
Sie waren schon nahe genug an der Brücke, dass Cian sie ganz gut erkennen konnte – ein einzelner Bogen in tieferem Schwarz vor der aufgewühlten Dunkelheit des Nachthimmels. Aber etwas stimmte nicht. Eine Gänsehaut jagte ihm kribbelnd über den Kopf, und der Atem stockte ihm, als die Silhouette eines Männerkopfs vor ihnen auftauchte.
»Was ist denn?«, fragte Molly, deren Lachen erlosch, als sie herumwirbelte und Cian anfing zu schreien.
Kapitel 2
Montag, 22. März 1813, vor dem Morgengrauen
Das Kindlein lag in einer Wiege beim Kamin zusammengerollt auf der Seite, die Lippen im Schlaf leicht geöffnet und gleichmäßig atmend. Es hatte ein Fäustchen unter das Kinn geklemmt, und im Licht des Feuers sah die durchscheinende Haut seiner geschlossenen Lider so zart und verletzlich aus, dass sein Vater, der neben ihm stand, ganz besorgt wurde. Eines Tages würde dieser Säugling Viscount Devlin und dann, nach angemessener Zeit, Earl of Hendon werden. Aber einstweilen war er einfach der ehrenwerte Simon St Cyr, knapp sieben Wochen alt. Und er hatte keine Ahnung, dass er in Wirklichkeit auf keinen der Titel mehr Anrecht besaß als sein Vater Sebastian St Cyr, der derzeitige Viscount Devlin.
Devlin legte eine Hand an die Kaminumrandung. Er atmete stoßweise und gepresst, und trotz der kühlen Luft glänzte Schweiß auf seiner nackten Haut. Erinnerungen, die er bei Tageslicht gewöhnlich weit von sich schob, hatten ihn aus dem Schlaf hochgejagt. Aber die Bilder, die ihn heimsuchten, konnte er in den stillen Stunden der Nacht nicht vertreiben – Visionen von flackerndem Feuer, von einem sich in Qualen windenden, hilflosen Körper einer Frau, und von weichem braunem Haar, das an wächserner Kinderhaut flatterte.
Die Vergangenheit lässt uns nie los, dachte er. Wir tragen sie unser ganzes Leben mit uns herum, als geisterhafte Last aus bittersüßer Nostalgie, in die Schuld und Reue verwoben sind. Sie legt sich uns auf die Seele und raunt uns in den tiefsten Stunden der Nacht Dinge zu. Nur die allerkleinsten Kinder sind wirklich unschuldig, weil ihr Gewissen noch ungetrübt ist und sie ihre Tage der Qual noch vor sich haben.
Er erschauerte und bückte sich, um Kohle nachzulegen. Er tat es vorsichtig, um das schlafende Kind und seine Mutter nicht aufzuwecken.
Als Sebastian klein gewesen war, war es üblich gewesen, dass Kinder der Aristokratie und des Landadels zu einer Amme gegeben wurden und oft erst im Alter von zwei Jahren wieder zur Familie zurückkehrten. Aber es setzte sich derzeit immer mehr durch, dass sogar Herzoginnen ihren Nachwuchs selbst stillten, und Hero, die Mutter des Kindes und seit acht Monaten Sebastians Frau, hatte die Einstellung einer Amme vehement abgelehnt.
Sein Blick wanderte zu dem Bett mit dem dunkelblauen Betthimmel aus Seide, in dem sie schlief. Ihr dichtes Haar hatte sich auf dem Kissen ausgebreitet. Erneut spürte er eine namenlose, unheilvolle Sorge um seine Frau und sein Kind. Er schob sie auf seine Träume, die noch immer zu flüstern schienen, und auf eine Angst, die aus einer Schuld erwuchs, die nie gesühnt werden konnte.
In der Stille der Nacht erklangen plötzlich Hufgeklapper und das Rumpeln von Kutschrädern auf dem Pflaster aus Granitsteinen. Sebastian hob den Kopf und spannte den Körper an, als die Kutsche abrupt anhielt und schnelle, schwere Schritte eines Mannes die Eingangsstufen heraufstürmten. Er hörte von unten die Glocke läuten und darauf einen schroffen, fragenden Ruf seines Majordomus Morey.
»Eine Nachricht für Lord Devlin«, antwortete der unbekannte Besucher mit drängender Stimme, in der Entsetzten zu liegen schien. »Von Sir Henry, Bow Street!«
Sebastian zog sich den Morgenrock über und schlüpfte leise aus dem Zimmer.
Kapitel 3
Der Kopf war am Ende einer der niedrigen Backsteinmauern, die die Brücke säumten, abgelegt worden, das blicklose Antlitz seitwärts gedreht, als solle es jeden beobachten, der unaufmerksam genug war, sich zu nähern. Es war der Kopf eines Mannes mit dichtem dunklem ergrauendem Haar, schweren Augenbrauen und einer langen, vorspringenden Nase.
»Grässliche Arbeit ist das«, sagte der vierschrötige Wachtmeister, dessen Kiefernfackel, die er im tosenden Wind in die Höhe hielt, zischte und spuckte.
Sir Henry Lovejoy, der jüngste der drei Untersuchungsrichter auf Lebenszeit der Bow-Street-Behörde, beobachtete, wie das goldene Licht über die Züge des erstarrten, glotzenden Gesichts tanzte, und spürte, wie sich sein Magen regte.
Die Nacht war außergewöhnlich kalt und sternenlos. Die flackernden Fackeln der am Ufer des Bachs ausschwärmenden Wachtmeister erfüllten die Luft mit dem Geruch nach brennendem Pech. Natürlich mussten die Polizisten am nächsten Morgen eine gründlichere Suche durchführen; das hier war nur der Anfang.
Selbst bei Tage war dieser zerfurchte, matschige Weg nur wenig befahren, denn hinter dem Flüsschen, das von der schmalen, einbogigen Brücke überspannt wurde, lag The Five Fields, ein ausgedehntes Gebiet mit Gärtnereien und Baumschulen. Sie waren jetzt allesamt von einer unheimlichen Schwärze eingehüllt, die vollends undurchdringlich wirkte.
Lovejoy zog die Schultern gegen die Kälte vor und ging dorthin, wo der kräftige, stattliche Körper des unglückseligen Gentlemans ausgestreckt auf dem grasüberwachsenen Bogen der Brücke lag. Seine ursprünglich sauber geknotete Krawatte war in Unordnung und dunkel befleckt, das rohe, verstümmelte Fleisch seines Halses war zu grauenhaft, um es genauer zu inspizieren. Er war in Lovejoys Alter, in den Fünfzigern. Das hätte ihn nicht weiter stören sollen, aber aus einem Grund, den er nicht weiter hinterfragte, tat es das durchaus. Er sog rasch den Atem ein, roch die faulige, nach Kupfer riechende Luft und suchte nach seinem Schnäuztuch. »Sie sind sicher, dass das Stanley Preston ist, vielmehr war?«
»Ich fürchte ja, Sir«, antwortete der Constable. Der stämmige junge Mann mit vorstehenden Augen überragte den kleinen und dünnen Lovejoy. »Molly, die Schankmaid vom Rose and Crown, hat den, ähm, Kopf wiedererkannt, Sir. Und ich habe in seiner Tasche seine Visitenkarten gefunden.«
Lovejoy drückte sich das gefaltete Stofftuch an die Lippen. Ein derart grausamer Mord würde unter allen Umständen für Aufruhr sorgen. Aber wenn das Opfer der Vetter von Lord Sidmouth war, einem früheren Premierminister, der inzwischen als Minister des Inneren diente, dann hatten die Auswirkungen Folgen, die in der Tat schwerwiegend sein konnten. Der örtliche Magistrat hatte sogleich nach der Bow Street schicken lassen und sich dann gänzlich von der Untersuchung zurückgezogen.
Der Lärm einer schnell heranfahrenden Kutsche lenkte Lovejoys Aufmerksamkeit von dem blutüberströmten Leichnam zu ihren Füßen weg. Er sah einen schlanken Zweispänner, der von einem Gespann edler Brauner gezogen wurde und von der Sloane Street über den nördlichen Rand des Platzes fuhr, woraufhin er in den schmalen Weg zur Brücke einbog.
Der Fahrer, ein großer, schlanker Gentleman, trug einen Herrenmantel mit Schulterumhang und einen eleganten Kastorhut. Bei Lovejoys Anblick zog er die Zügel an, und der halbwüchsige Bursche, auch als Tiger bezeichnet, der sich auf dem Bock auf der Rückseite der Kutsche festgeklammert hatte, sprang herunter und lief zu den Köpfen der Pferde. »Lass sie am besten auf und ab gehen, Tom«, sagte Devlin und sprang leichtfüßig vom hohen Kutschbock. »Das ist ein scheußlicher Wind.«
»Aye, Meister«, sagte der Junge.
»Mylord«, sagte Lovejoy und ging dankbar auf ihn zu. »Meine Entschuldigung, dass ich mitten in einer solch gräulichen Nacht nach Euch habe rufen lassen. Aber ich fürchte, dieser Fall ist besorgniserregend. Äußerst besorgniserregend.«
»Sir Henry«, sagte Devlin. Dann wanderte sein Blick weiter in Lovejoys Rücken zu dem abgetrennten Kopf am Brückenende, und er stieß die Luft aus. »Großer Gott.«
Der Viscount war etwa fünfundzwanzig Jahre jünger als Lovejoy und mindestens einen Fuß größer; sein Haar war fast so dunkel wie das von einem Mann des fahrenden Volkes. Seine fremdartigen, bernsteinfarbenen Augen schimmerten im Fackellicht in einem katzenartigen Gelb, als die beiden Männer sich umdrehten, um zu dem Bach zu gehen. »Haben Sie schon etwas herausgefunden?«, fragte er.
»Nichts außer der Identität des Opfers.«
Als die beiden Männer sich zum ersten Mal begegnet waren, war Devlin des Mordes bezichtigt und Lovejoy fest entschlossen gewesen, ihn einem Gerichtsprozess zuzuführen. In den zwei Jahren seither hatte sich das, was als gegenseitiger Respekt begonnen hatte, zu einer ungewöhnlichen Freundschaft entwickelt. Lovejoy hatte in Devlin einen unerwarteten Komplizen mit einer brennenden Leidenschaft für Gerechtigkeit gefunden, einen brillanten Geist mit der seltenen Gabe, Morde aufzuklären. Aber der junge Viscount besaß darüber hinaus etwas, das kein Untersuchungsrichter oder Wachtmeister der Bow Street je zu erreichen hoffte, nämlich ein angeborenes Begreifen und Kenntnis der anspruchsvollen Welt der Gentleman’s Clubs und der Bälle der feinen Gesellschaft. Der Kopf, der nun diese gottverlassene Brücke am Rand von Hans Town und Chelsea zierte, gehörte zu der Sorte Mann, die solche feinen Orte frequentierte.
»Wart Ihr mit Mr Preston bekannt, Mylord?«, fragte Lovejoy als Devlin stehenblieb und die blutleeren Züge des toten Mannes betrachtete. Der Wind fuhr in das ergrauende Haar und ließ den Mann für einen gruseligen Augenblick beinahe lebendig aussehen.
»Nur entfernt.«
Prestons feiner Kastorhut lag mit der Krempe nach oben auf dem Fuß des Brückenpfeilers; Devlin beugte sich vor, um ihn aufzuheben, und mit nachdenklicher Miene befühlte er die Krone und die Krempe.
Lovejoy sagte: »Ich fürchte, dass die Bow Street sowohl vonseiten des Palastes als auch aus Westminster unter enormen Druck geraten wird, diesen Fall aufzuklären. Und zwar schnell.«
Devlin sah ihn an. Sie wussten beide, wie solcher Druck zu einer voreiligen Verhaftung und Verurteilung eines Unschuldigen führen konnte. »Sie bitten mich um Hilfe?«
»Ja, Mylord, das tue ich.«
Ängstlich wartete Lovejoy auf die Antwort. Aber der Viscount blickte nur über die im Dunkeln liegenden Felder hinweg, seine Miene blieb ausdruckslos.
Lovejoy wusste, dass Devlins eigener, fast fatal endender Zusammenstoß mit der unglücklichen Arbeitsweise des britischen Rechtssystems viel mit seiner Leidenschaft zu tun hatte, für Mordopfer nach Gerechtigkeit zu streben. Aber der Magistrat hatte immer schon den Verdacht gehegt, dass mehr dahinter steckte. Dem Viscount war etwas zugestoßen – ein düsterer, aber unbekannter Zwischenfall in seiner Vergangenheit, der ihn dazu getrieben hatte, sein Offizierspatent zu veräußern und einen Weg der Selbstzerstörung einzuschlagen, von der er erst kürzlich angefangen hatte, sich zu erholen.
Der Wind frischte noch stärker auf, bewegte die Äste der Ulmen am Bachlauf und ließ ein zerrissenes Theaterplakat über das schäbige Backsteinpflaster der Brücke flattern. Devlin sagte: »Die Krone und die Oberseite der Krempe von Prestons Hut sind nass, aber die Unterseite nicht. Und da sein Haar ebenfalls trocken aussieht, würde ich sagen, dass er im Regen spazieren gegangen ist und getötet wurde, nachdem es aufgehört hatte zu regnen. Um wie viel Uhr war das?«
»Gegen halb zehn«, sagte Lovejoy uns stieß einen erleichterten Seufzer aus.
Kapitel 4
Sebastian drehte sich zu Prestons Leiche um. Der kopflose Körper lag auf dem Rücken, die Arme ausgestreckt, ein Bein leicht angewinkelt, und das nasse Gras war dunkel von seinem Blut. Sebastian hatte in seinen sechs Jahren im Militärdienst oft derartige Anblicke gesehen – und schlimmere. Trotzdem war er gegen ein solches Gemetzel nicht abgestumpft. Er zögerte nur einen winzigen Augenblick, dann ging er neben dem Leichnam in die Hocke.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte er und stützte sich mit einem Unterarm auf dem Knie ab.
»Eine Schankmaid und ein Stalljunge vom Rose and Crown«, antwortete Lovejoy. »Kurz nach elf. Das Barmädchen – Molly Watson heißt sie, glaube ich – hat den Magistraten der Gemeinde alarmiert.«
Sebastian drehte sich um und betrachtete die leere Straße. »Was hat sie denn um diese späte Stunde hier zu schaffen gehabt?«
»Ich habe selbst nicht mit ihr gesprochen. Sir Thomas – der örtliche Magistrat – sagte ihr, sie könne nach Hause gehen, bevor ich eingetroffen bin. Aber soweit ich es verstanden habe, hatte sie wohl keine plausible Erklärung.« Lovejoys Stimme wurde ganz gepresst vor Missbilligung. »Sir Thomas meinte, ihr Ziel wäre wohl der Heuschober in dem Stall dort drüben gewesen.«
Sebastian musste den Kopf senken, um sein Lächeln zu verstecken. Als strammer Reformist lebte Lovejoy nach einem strengen Moralkodex und war deshalb leicht aus der Fassung zu bringen, wenn Menschen einen viel freieren Lebensstil bevorzugten als er selbst.
»War sein Herrenmantel schon so geöffnet, als er gefunden wurde?«, fragte Sebastian. Er sah Prestons Taschenuhr auf dem Boden neben seiner Hüfte liegen; sie war noch an der goldenen Kette befestigt.
»Einer der Wachtmeister sagte, dass er die Taschen des Mannes nach seinen Karten durchsucht hat. Ich nehme an, dabei hat er den Mantel geöffnet.«
Sebastian zog sich einen Handschuh aus und berührte die blutgetränkte Weste. Er zog die nasse und klebrige Hand wieder zurück. »Er ist noch ein bisschen warm«, sagte er und wischte sich die Hand mit seinem Taschentuch ab. »Wissen Sie, wann er zuletzt gesehen wurde?«
»Laut seiner Dienerschaft ist er gegen neun Uhr ausgegangen. Sein Haust ist nicht weit weg von hier – gleich hinter Hans Place. Man sagte mir, er war Witwer mit zwei erwachsenen Kindern, einem Sohn in Jamaika und einer unverheirateten Tochter. Unglücklicherweise hat die Tochter den Abend mit Freundinnen verbracht und hatte keine Kenntnis der Pläne ihres Vaters für die vergangenen Stunden.«
Sebastian ließ den Blick über die dunklen, grasbewachsenen Ufer des Bachlaufs schweifen. »Ich frage mich, was zum Teufel er hier wollte. Ich bezweifle irgendwie, dass er auf der Suche nach einem warmen Heuboden war.«
»Das nehme ich doch nicht an, Sir«, sagte Sir Henry und räusperte sich peinlich berührt.
Sebastian erhob sich wieder. »Schicken Sie die Leiche zu Gibson?«, fragte er. Paul Gibson, der einbeinige irische Wundarzt mit einer gefährlichen Opiumsucht, konnte die Geheimnisse eines toten Körpers besser enträtseln als jeder andere in England.
Sir Henry nickte. »Ich bezweifle, dass er uns mehr als das Offensichtliche zu berichten hat, aber ich schätze, wir sollten ihn den Leichnam begutachten lassen.«
Sebastian wandte den Blick erneut auf den Kopf auf der Brücke. Die Blutlache um ihn herum war in der Kälte geronnen. »Weshalb hat man ihm den Kopf abgeschnitten?«, sagte er halb zu sich selbst. »Und dann auf der Brücke drapiert?« Einst war es üblich gewesen, die Köpfe von Verrätern auf Piken auf der London Bridge aufzuspießen. Dieser barbarische Brauch war allerdings vor hundertfünfzig Jahren aufgegeben worden.
»Vielleicht zur Warnung?«, schlug Sir Henry vor.
»Für wen?«
Der Magistrat schüttelte den Kopf. »Das vermag ich mir nicht vorzustellen.«
»Es ist mächtiger Hass – oder Zorn – nötig, damit ein Mann sich dazu hinreißen lässt, den Körper eines Mitmenschen zu verstümmeln.«
»Zorn oder ein verwirrter Geist«, sagte Sir Henry.
»Richtig.«
Sebastian ging zum alten Backsteinfundament der Brücke. Er hatte keine Fackel dabei, brauchte allerdings auch keine, da er eine fast tierhaft scharfe Seh- und Hörfähigkeit besaß, die es ihm ermöglichte, sehr weit und auch im Dunkeln zu sehen und Geräusche wahrzunehmen, die den meisten seiner Mitmenschen verborgen blieben, wie er erfahren hatte.
»Was ist das?«, fragte Sir Henry, als Sebastian zum Ufer hinunterschlitterte, sich bückte und einen Gegenstand aufhob, der vielleicht einen halben Meter lang und zehn Zentimeter breit, aber sehr dünn war.
»Es scheint eine Art altes Metallband zu sein«, sagte Sebastian und drehte es in seinen Händen. »Wahrscheinlich aus Blei. Es ist an beiden Enden frisch bearbeitet worden, und da ist eine Inschrift. Sie lautet …« Er brach ab.
»Wie? Wie lautet sie?«
Er sah auf. »Sie lautet ›King Charles, 1648‹.«
»Grundgütiger«, flüsterte Sir Henry.
Jeder britische Schuljunge kannte die Geschichte von King Charles I, Enkel von Mary, Königin von Schottland. Er war von Oliver Cromwell und seinen puritanischen Kohorten am 30. Januar 1649 verurteilt und enthauptet worden. Nur, weil im traditionellen Kalender das neue Jahr am 25. März begann statt am ersten Januar, hatten die Chronisten der damaligen Zeit das Datum der Hinrichtung für das Jahr 1648 verzeichnet.
»Vielleicht hat es mit dem Mord gar nichts zu tun«, sagte Sir Henry. »Wer weiß, wie lange es schon hier liegt?«
»Die Oberfläche ist trocken, also muss es fallen gelassen worden sein, nachdem der Regen aufgehört hat.«
»Aber was könnte ein Mann wie Stanley Preston denn nur mit Charles I zu tun haben?«
»Abgesehen von der Todesart, meinen Sie?«, fragte Sebastian.
Der Untersuchungsrichter kniff die Lippen so fest zusammen, dass die Haut neben seinen Nasenflügeln ganz weiß wurde. »Das ist das eine.«
Irgendwo in der Ferne setzte Glockengeläut ein, dann erklang eine zweite Kirchenglocke. Der Nebel zog kalt und klamm vom Fluss herauf. Sebastian sah, wie Sir Henry die Straße entlang zum Sloane Square blickte, wo die Lichter der Öllaternen zu einem dumpfen Schimmer verkümmerten.
»Es ist eine beängstigende Vorstellung, dass derjenige, der das hier getan hat, noch irgendwo da draußen ist«, sagte der Magistrat. »Und mitten unter uns lebt.«
Und er könnte es wieder tun.
Das sprachen weder Sir Henry noch Sebastian laut aus. Aber die Worte waren da, und der kalte, kräftige Wind trug sie davon.
Kapitel 5
Der Geruch von frischem Blut hatte die Pferde verängstigt, sodass Sebastian alle Hände voll zu tun hatte, als er seinen Zweispänner heimwärts lenkte.
»War das echt ’n Kopf auf der Brücke?«, fragte Tom, als sie in die Sloane Street einbogen. »Von ’nem Mann?«
»Ja.«
Der Tiger stieß aufgeregt den Atem aus. »Boah! Eklig.«
Der kleine, schmalgesichtige Bursche war seit nunmehr zwei Jahren bei Sebastian. Nicht einmal Tom selbst kannte sein richtiges Alter und seinen Nachnamen. Er hatte allein auf der Straße gelebt, als er versucht hatte, Sebastian um seine Geldbörse zu erleichtern – und zu guter Letzt dessen Leben gerettet hatte.
Und zwar mehr als ein Mal.
Sebastian sagte: »Er gehört – oder ich sollte wohl sagen, gehörte – zu einem gewissen Mr Stanley Preston.«
Tom schien den Klang in Sebastians Stimme genau wahrzunehmen, denn er sagte: »Ihr habt wohl nich viel für den Kerl übrig gehabt?«
»Tatsächlich habe ich ihn kaum gekannt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mit Männern, deren Wohlstand aus Zuckerplantagen auf den Westindischen Inseln stammt, so meine Schwierigkeiten habe.«
»Weil die Zucker anbauen?«
»Weil ihre Plantagen nicht von Pächtern, sondern von Sklaven bearbeitet werden. Hauptsächlich von Afrikanern, aber sie setzen auch deportierte irische und schottische Rebellen ein.«
Sie fuhren schweigend weiter, bis sie an der Zollstelle des Hyde Parks vorbei waren und durch die ruhigen, regennassen Straßen Mayfairs rollten. Dann sagte Tom plötzlich: »Wenn Ihr den nich leiden mochtet, warum stört’s Euch dann, dass ihn einer gekillt hat?«
»Weil selbst diejenigen, die Plantagen auf den Westindischen Inseln besitzen, es nicht verdient haben, brutal ermordet zu werden. Abgesehen davon finde ich die Vorstellung, meine Heimatstadt mit jemandem zu teilen, der herumspaziert und seinen Feinden einfach den Kopf abschneidet, etwas beunruhigend.«
»Beun-was?«
»Beunruhigend. Es macht mir ein … ungutes Gefühl.«
»Schätze, es war ’n Franzmann«, sagte Tom, der Fremden allgemein und Franzosen im Besonderen ein großes Misstrauen entgegenbrachte. »Die schneiden den Leuten doch immer die Köpfe ab.«
»Das ist eine interessante These, die sicherlich Betrachtung verdient.« Sebastian hielt vor der Eingangstreppe seines Stadthauses in der Brook Street an. Die Öllampen, die an beiden Seiten der Tür weit oben angebracht waren, warfen goldene Lichtpfützen auf das nasse Pflaster, aber das Haus selbst lag dunkel und ruhig da, da die Bewohner noch schliefen. »Kümmer dich um die Pferde, dann geh ins Bett und bleib dort. Es ist fast Morgengrauen.«
Tom huschte voran, um die Zügel zu nehmen, als Sebastian leichtfüßig auf das Pflaster sprang. »Werdet Ihr ausschlafen?«
»Nein.«
»Na, dann rechnet ma nich damit, dass ich das mache«, sagte Tom und schob mürrisch das Kinn vor.
Sebastian schnaubte. Toms Begriff von Gehorsam war noch immer etwas wacklig.
Er beobachtete Tom, der zu den Stallungen fuhr, und drehte sich dann um, um ins Haus zu gehen. Als er sich im Ankleidezimmer entkleidete, bewegte er sich leise, bevor er neben Hero ins Bett kroch. Er wollte sie nicht wecken. Aber das Bedürfnis, ihren warmen, lebendigen Körper an seinem zu spüren, war zu groß. Vorsichtig schob er einen Arm um ihre Taille und schmiegte seine Brust an ihren Rücken.
Sie schob die Hand auf seine, und in der Dunkelheit sah er ein Lächeln auf ihren Lippen, als sie sich leicht drehte, sodass sie ihn über die Schulter anschauen konnte. »Du warst lang weg«, sagte sie. »War es so schlimm, wie Sir Henrys Nachricht vermuten lässt?«
»Schlimmer.« Er schmiegte das Gesicht in ihr dunkles, duftendes Haar. »Schlaf weiter.«
»Kannst du denn schlafen?«
»In einer Weile.«
»Ich kann dir helfen«, sagte sie heiser und streichelte mit der Hand über seine nackte Hüfte. Ihm blieb der Atem stehen, als sie sich in seinen Armen umdrehte und seinen Mund mit den Lippen bedeckte.
***
Als er am nächsten Morgen herunterkam, traf er Hero im Flur. Sie trug eine jagdgrüne Pelisse und einen Samthut mit drei Federn. Sie zog gerade ein Paar rehlederne Handschuhe an, dann sah sie auf und entdeckte ihn.
»Na, guten Morgen«, sagte sie mit einem herzlichen Lächeln in den Augenwinkeln. »Ich habe nicht erwartet, dich so früh zu sehen.«
»Es ist nicht mehr früh.«
Sie drehte sich zum Spiegel über der Konsole, um ihren Hut zu richten. »Wenn man fast die ganze Nacht auf war, schon.«
Sie war eine ungewöhnlich große Frau, fast so groß wie Sebastian, mit dichtem mittelbraunem Haar und grauen Augen, in denen eine fast beängstigende Intelligenz funkelte. Ihr Aussehen würde man eher als attraktiv denn hübsch bezeichnen, da sie ein ausgeprägtes Kinn, einen großen Mund und eine gebogene Nase besaß, die sie von ihrem Vater, Lord Jarvis, geerbt hatte. Der war ein entfernter Vetter von King George und stand als die eigentliche Macht hinter der zerbrechlichen Regentschaft des Prinzen von Wales. Vor einiger Zeit hatte Jarvis versucht, Sebastian ermorden zu lassen – und zweifelsohne würde er das wieder tun, wenn es seinen Zwecken diente.
»Hast du wieder eine Befragung?«, fragte er, während er beobachtete, wie sie den Hut schräg auf den Kopf setzte. »Worum geht es dieses Mal? Müllmänner? Kaminfeger? Blumenmädchen?«
»Marktleute.«
»Aha.«
Sie schrieb eine Serie von Artikeln über Londons arme Arbeiterklasse, die sie am Ende in einem Buch zusammenführen wollte. Es war ein Vorhaben, das ihren Vater anekelte, einerseits, weil er ihre Tätigkeit für eine Frau als unpassend ansah, andererseits weil dem Projekt ein Hauch von Radikalismus anhaftete, den er verabscheute. Allerdings hatte Hero sich von den Erwartungen und Vorurteilen ihres Vaters noch nie einengen lassen.
Sie sagte: »Der Mord an Stanley Preston steht in allen Zeitungen. Ist er tatsächlichen enthauptet worden?«
»Ja.«
Sie drehte sich langsam wieder zu ihm um und betrachtete ihn ruhig mit großen Augen.
Er sagte: »Hast du einen Augenblick Zeit? Ich würde dir gern etwas zeigen.«
»Sicher.« Sie legte die Pelisse ab und folgte ihm in die Bibliothek, wo er das altertümliche Metallband auf seinem Schreibtisch hatte liegen lassen.
»Das hier habe ich in der Nähe von Prestons Leichnam gefunden.« Er gab ihr den Bleistreifen und beschrieb ihr knapp die Szenerie an der Brücke.
»König Charles, 1648«, las sie und sah zu ihm auf. »Ich verstehe nicht; was ist das?«
»Ich könnte falsch liegen, aber solche Metallbänder habe ich schon gesehen; um alte Särge befestigt.«
»Du willst sicher nicht andeuten, dass das hier vom Sarg von Charles I stammt?«
»Ich weiß es nicht. Aber es ist doch verräterisch, dass die Inschrift ›King Charles‹ lautet, und nicht ›Charles I‹, und 1648 anstatt 1649. Wo genau ist Charles I bestattet worden? Mir ist aufgefallen, dass ich das gar nicht weiß.«
»Das weiß niemand. Nach der Hinrichtung war die Rede davon, dass er in Westminster Abbey beerdigt werden sollte. Aber Cromwell hat das nicht erlaubt, also haben die Männer des Königs ihn bei Nacht weggebracht und heimlich bestattet. Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, was sie mit ihm gemacht haben sollen. Ich habe schon Vermutungen gehört, er wäre in der St George’s Chapel in Windsor Castle bestattet. Aber keiner weiß es mit Gewissheit.« Sie runzelte die Stirn. »Welchem politischen Lager hat Preston angehört?«
»Es würde mich sehr wundern, wenn er eine Nostalgie für die Stuarts hegte, falls du das denkst.«
Sie fuhr mit den Fingerspitzen die Gravur nach. Ihre Züge waren gefasst und nachdenklich. »Ist es dir recht, wenn ich das Jarvis zeige?«, fragte sie und griff wieder nach ihrer Pelisse.
»Er wird es nicht schätzen, dass ich dich erneut in eine Mordermittlung hineinziehe.«
»Keine Sorge«, sagte sie, als ihr Sebastian die Pelisse abnahm und ihr damit half. »Ich bezweifle ernstlich, dass seine Abneigung gegen dich noch größer werden könnte als sie bereits ist.«
Er musste lachen. Dann drehte er sie zu sich um, ließ die Hände auf ihren Schultern liegen und schwieg.
»Was?«, fragte sie und sah ihn an.
»Nur dass … Wer auch immer Preston ermordet hat, war entweder so zornig, dass er am Rande des Wahnsinns war, oder er ist tatsächlich geisteskrank. Und ich weiß nicht, welche der beiden Möglichkeiten ihn gefährlicher macht.«
»Wahnsinn ist immer angsteinflößend, wahrscheinlich, weil er einfach nicht nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, dass ich dennoch mehr einen Mann fürchte, der brutal, aber geistig gesund ist. Denn der ist zu durchtriebener, kalter Berechnung fähig.«
»Weil er klug ist?«
»Ja, und weil die Wahrscheinlichkeit, dass er Fehler macht, geringer ist.«