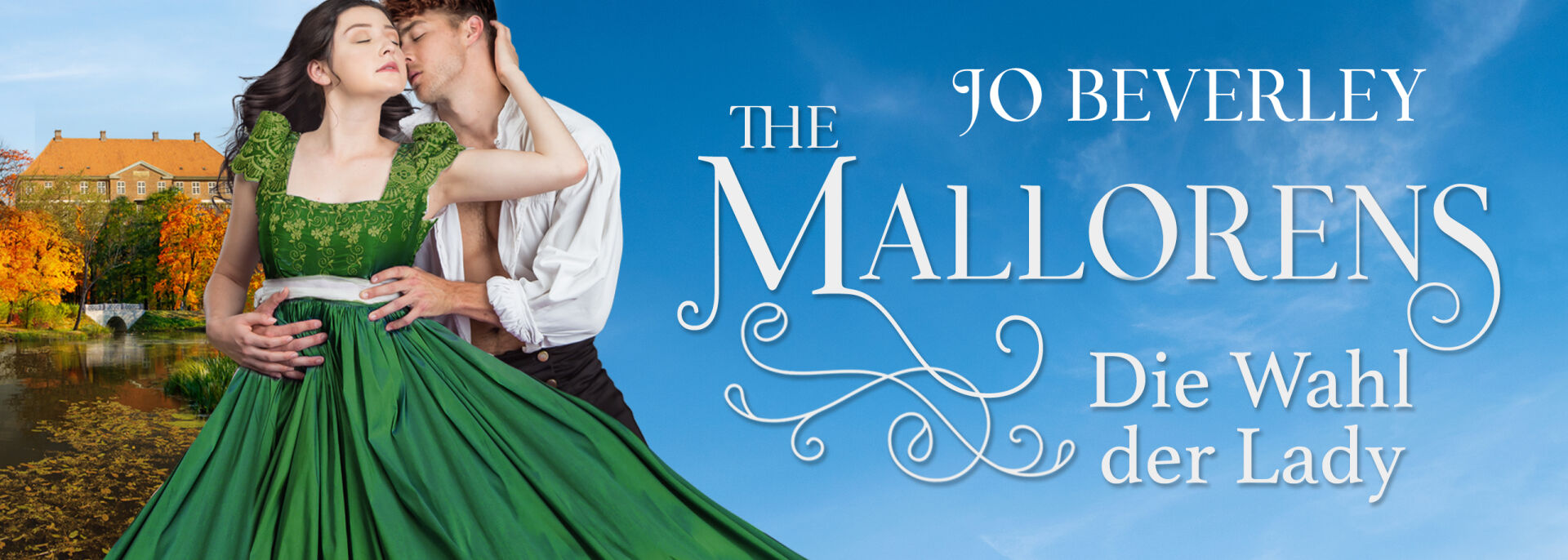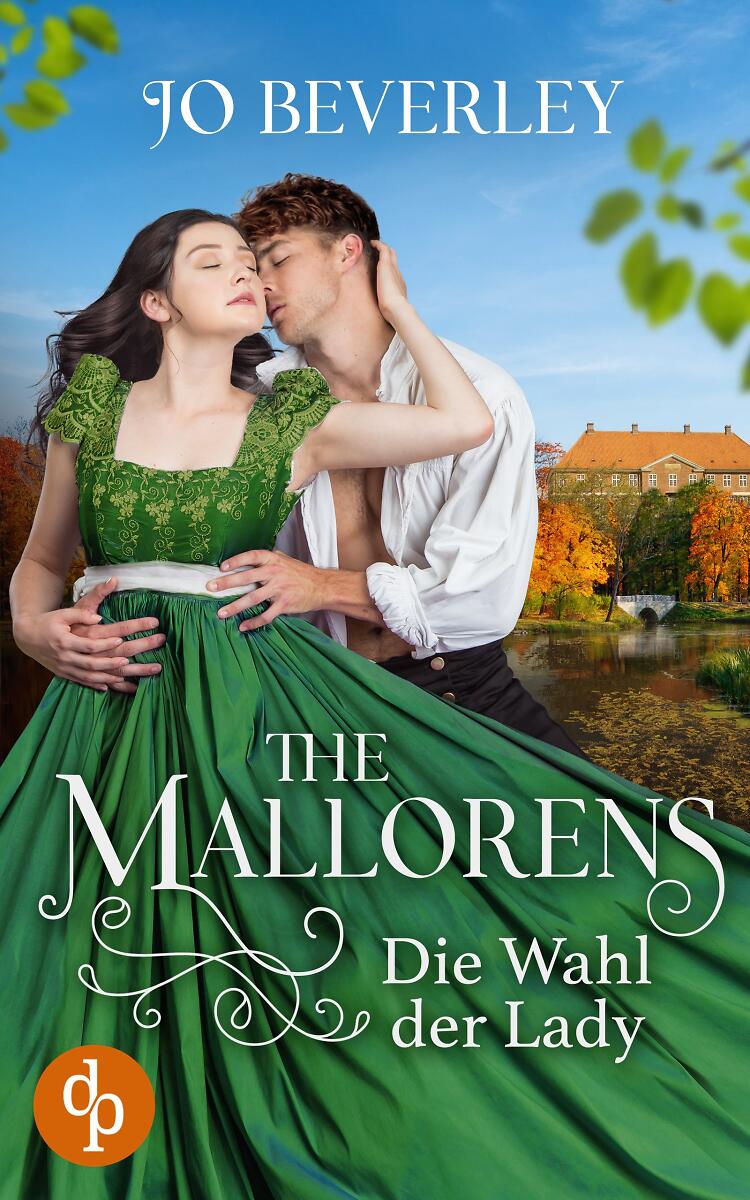1
Nord-Yorkshire, August 1762
Eine Sünde zu begehen sollte doch nicht so schwierig sein! Hieß es nicht, verbotene Früchte schmeckten am besten?
Rosamunde Overton saß in der schwankenden und ratternden Kutsche und floh eiligst nach Hause – tugendhaft, doch nur aus Feigheit.
Um von den Fenstern so weit wie möglich entfernt zu sein, war sie in die Mitte der Sitzbank gerückt. Seit dem Unfall, der in ihrem Gesicht bleibende Narben hinterlassen hatte, mied sie Kutschenfenster. Sie hatte aus Scheu aber auch vieles andere gemieden, das war ihr heute bewusst geworden. Wer längere Zeit ans Bett gefesselt ist, verliert die Kraft in den Beinen. Rosamunde, die seit acht Jahren nicht mehr aus Wensleydale herausgekommen war, litt unter dem völligen Verlust der Energie, die im Umgang mit Fremden notwendig war.
Umso mehr, wenn es darum ging, mit einem Fremden ein Schäferstündchen zu verbringen!
Zusammengesunken saß sie da und blickte bewegungslos hinaus auf eine Landschaft, die ihre Stimmung widerzuspiegeln schien. Über den struppigen, steil ansteigenden Schafweiden hingen düstere Wolken, Überreste des Sturms, der ihre Fahrt verlangsamt hatte. Das Tageslicht war nur noch eine purpurne Erinnerung, das Mondlicht ein blasses Versprechen, und so dämmerte sie in dieser bleiernen Stunde zwischen Tag und Nacht dahin.
Tatsächlich war es ihr zunächst ganz leicht erschienen, etwas Sündhaftes zu tun, als sie es mit Diana geplant hatte. Alle verlangten nach einem Kind: nicht nur ihr Ehemann, sondern alle im Haus und in ganz Wenscote. Doch von ihrem Mann konnte sie keine Kinder bekommen. Also hatte sie eine Maske angelegt, um sich in Harrogate dem anonymen, zügellosen Treiben eines Maskenballs zu überlassen. Wie Diana ihr prophezeit hatte, waren da durchaus Männer aufgetaucht, die bereit waren, sich von ihr verführen zu lassen. Bereit – doch ohne zu ahnen, wer sie war und dass es ihr nur darum ging, schwanger zu werden.
Sie schloss die Augen. Wie einfach hatte sie sich das alles vorgestellt!
Doch statt einen von ihnen ernsthaft zu ermuntern, hatte sie ständig die Tanzpartner gewechselt, auf der verzweifelten Suche nach einem, der ihr richtig gut gefiel. Was um alles in der Welt hatte sie erwartet?
Einen schmucken Prinzen?
Einen charmanten Aristokraten?
Einen edlen Ritter?
Im Laufe des Abends war ihr klar geworden, dass es solche Traumliebhaber nicht gab. Immer deutlicher hingegen waren ihr die Fehler der realen Männer ins Auge gesprungen: ihre dicken Bäuche und schlechten Zähne, ihre lüsternen Augen und geifernden Münder, ihre schmutzigen Hände, ihre X-Beine …
Obwohl sie sich mit mehreren Gläsern Wein gehörig Mut angetrunken hatte, verlor sie am Ende doch die Nerven und ergriff die Flucht. Beim ersten Tageslicht, noch bevor Diana aufgewacht war, hatte sie die Pferde anspannen lassen, um sich in die Dales zurückfahren zu lassen – in die Sicherheit von Wenscote.
Wenscote, ein Zufluchtsort, den sie nicht verdiente, weil sie nicht bereit war, ihn zu retten! Wenn sie kein Kind bekäme, würde das Landgut eines Tages an Edward Overton, den Neffen ihres Gatten, übergehen. Und Edward würde es sofort der streng religiösen Sekte vermachen, der er angehörte. Rosamundes Gatten ging es gesundheitlich sehr schlecht, und ihr Versagen drohte seinen Tod noch zu beschleunigen. Es wäre für den herzensguten Mann, der einst der verwundeten Sechzehnjährigen Zuflucht gewährt hatte, womöglich das Ende. Dr. Wallace hatte gesagt, dass sich Digbys gesundheitliche Probleme und die Schwindelanfälle durch die Sorge noch verschlimmerten.
Wie einfach hatte sie sich das alles vorgestellt!
Rosamunde überließ sich für einen Moment dem idyllischen Bild eines glücklichen Digby, der zufrieden sein Kind heranwachsen sah und es auf sein Erbe vorbereitete. Wenn er für ein Kind sorgen müsste, würde er vielleicht eher den Anweisungen des Arztes Folge leisten, einfachere Kost zu sich nehmen und weniger Alkohol trinken. Tränen brannten ihr in den Augen, Tränen der Sehnsucht. Die Lösung lag jedoch nicht in sehnsüchtigen Träumen, sondern in einer Sünde mit Folgen, und darin hatte sie versagt …
Rosamunde verscheuchte ihre sinnlosen Gedanken und öffnete das Fenster. „Halt!“
„Anhalten, Mylady?“, fragte der Kutscher.
„Ja, anhalten! Sofort!“
Mit einem Ruck hielt die Kutsche an und stand nun so schief, dass Rosamundes Zofe Millie, die auf dem Sitz gegenüber lautstark schnarchte, mit ihrer ganzen Leibesfülle gegen ihre Herrin zu prallen drohte. Rosamunde hielt schützend die Arme vor sich, um sie notfalls auffangen zu können, und lehnte sich dann wieder in ihren Sitz zurück.
„Gibt es ein Problem, Mylady?“, rief Garforth vom Kutschbock herunter.
„Ich glaube, dort hinten liegt etwas im Straßengraben! Vielleicht ein Mensch – schick Tom zurück, um nachzusehen!“
Die Kutsche schwankte, als der junge Stallbursche heruntersprang. Rosamunde lehnte sich aus dem Fenster und blickte im Dämmerlicht hinter ihm her. „Ein Stück weiter hinten, Tom! Nein, weiter drüben – dort beim Ginsterbusch!“
„Zum Kuckuck, da liegt tatsächlich was“, brummte der Stallbursche. Er glitt die Böschung hinunter, ging prüfend in die Hocke und rief dann nach oben: „Da liegt ein Mann, Mr Garforth!“
Rosamunde öffnete den Kutschenschlag, raffte ihre weiten Röcke und sprang auf die Straße. „Ist er tot?“, rief sie, während sie auf die Stelle zulief.
„Eher stockbetrunken, Mylady! Wie der wohl hierhergekommen ist?“
Rosamunde blickte hinab in eine morastige Bodensenke. „Er wird sich den Tod holen! Kannst du ihm da raushelfen?“
Tom schob seine großen Hände unter die Arme des Mannes und hob ihn an. Obwohl er ein kräftiger Bursche war, dauerte es einige Zeit, bis er die nasse, schwere Last auf die Straße gezogen hatte. Rosamunde kniete neben dem nach Gin und feuchter Wolle riechenden leblosen Bündel nieder.
Mit beklommener Miene fühlte sie an dem kalten Handgelenk den Puls. Wenigstens lebte er noch! Im kargen Licht tastete sie ihn vorsichtig ab, konnte aber keine Verletzung finden. Er war tatsächlich bloß stockbetrunken, wie Tom gesagt hatte; dabei war der nächste Gasthof meilenweit entfernt!
„Was sollen wir mit ihm tun, Mylady?“, fragte Tom.
„Wir nehmen ihn natürlich mit!“
„Ist das Euer Ernst? Es könnte sonst wer sein! Von hier ist er jedenfalls nicht.“
Ihn liegen zu lassen käme einem Todesurteil gleich. Rosamunde blickte Tom streng in die Augen. „Sind wir denn wie die Priester und Leviten, die einfach auf der anderen Straßenseite vorübergehen? Oder sind wir gute Samariter? Sag Garforth, er soll die Kutsche zurücksetzen!“
Kopfschüttelnd trottete der Stallbursche davon. Da konnte sie noch so viel auf die Bibel verweisen – Tom und Garforth würden sich bestimmt über ihr verrücktes Verhalten auslassen. Sie war jedoch keineswegs verrückt! Selbst wenn der Mann ein Fremder war und noch dazu ein Trunkenbold – sie konnte ihn doch nicht einfach so liegen lassen! Dermaßen durchnässt würde er sich bestimmt den Tod holen, denn hier oben waren die Nächte selbst im Sommer kalt.
Während das Gespann quietschend rückwärts rollte und der Kutscher den Pferden dabei gut zuredete, dachte Rosamunde im schwindenden Licht über dieses lebendig gewordene Gleichnis nach: Ob dieser Fremde wie der Mann auf dem Weg nach Jericho von Räubern überfallen worden war?
Wahrscheinlich nicht – sonst müsste sie trotz der Dämmerung Blutergüsse oder gar Blut erkennen können. Nein, er war sicherlich nur ein armer Wicht, der zu viel getrunken hatte.
Aber trotz der Bartstoppeln und des üblen Geruchs war er bestimmt kein Landstreicher! Vorsichtig betastete Rosamunde seine robusten Kniehosen und seine Jacke – ordentliche Kleider mit Hornknöpfen und dezenter Borte. Die Weste war schlicht, das Halstuch ohne Spitzenbesatz.
Alles deutete auf einen rechtschaffenen Mann mit einer Anstellung und Verpflichtungen hin. Das verwirrte sie. Ihrer Erfahrung nach kamen Trinker entweder aus der unteren oder der oberen Gesellschaftsschicht, nicht aber aus der arbeitsamen Mittelschicht, die ihr am vertrautesten war.
Er hatte Reitstiefel an. Möglicherweise war das die Erklärung. Vielleicht war er betrunken vom Pferd gefallen.
„Du bist mir wirklich ein Rätsel“, murmelte Rosamunde, während sie zögernd seine Taschen durchsuchte. Besonders unangenehm war es ihr, die Hand in die Taschen der engen Hose zu schieben, weil sie dabei zwangsläufig an intimste männliche Regionen stieß. Doch es war alles vergebens – bis auf ein schlichtes Taschentuch waren seine Taschen leer. Vielleicht war er ausgeplündert worden, oder er hatte sein Geld bis auf den letzten Penny vertrunken.
Sein Taschentuch benutzte sie nun, um ihm behutsam das Gesicht abzuwischen. Als die Kutsche langsam neben ihr zum Stillstand kam, warfen die Laternen ihr kegelförmiges, flackerndes Licht auf das Geschöpf, dessen sie sich angenommen hatte.
Oh weh!
Obwohl ihn Bartstoppeln, Schrammen und ein kleiner blauer Fleck am Kieferknochen verunzierten, war der Mann mit Sicherheit der Liebste einer Frau. Er war zwar kein Adonis, hatte jedoch ein ansprechendes Gesicht mit regelmäßigen Zügen, die auch im bewusstlosen Zustand aussahen, als würden sie lieber lächeln als sich grimmig verziehen.
Mit einem Anflug von Zärtlichkeit legte Rosamunde ihre Hand an seine stoppelige Wange und war froh, ihn den Menschen zurückbringen zu können, für die er zu lächeln pflegte. Hoffentlich würde ihm dieses Missgeschick eine Lehre sein! Wenn er eine Lungenentzündung bekäme, sähe es allerdings schlecht für ihn aus.
„Beeil dich, Garforth!“
„Ich tue, was ich kann, Mylady.“
Ihr war klar, dass der Kutscher von ihrer Barmherzigkeit ebenso wenig begeistert war wie Tom. Hätten die beiden den Mann wirklich seinem Schicksal überlassen?
Als die Kutsche in der richtigen Position stand, band Garforth die Zügel zusammen, überließ die Pferde kurz sich selbst und half dem Stallburschen beim Hineinhieven des Mannes. Das war bei dessen kräftigem Körperbau und einer Größe von einem Meter achtzig gar nicht so einfach. Während dieser Aktion wachte nun auch – welch Wunder! – Millie auf. Nach anfänglichem Murren zog sie die für kältere Fahrten bereitliegenden Decken hervor und wickelte den Mann darin ein.
„Damit die Sitze nicht schmutzig werden, Mylady“, bemerkte sie brummig.
Rosamunde gab Anweisungen, den Mann auf ihre Bankseite zu legen, und ließ sich dicht daneben nieder. Damit er nicht so durchgerüttelt würde, bettete sie seinen Oberkörper auf ihren Schoß. Als sie ihre Hand an seinen eiskalten Hals legte, hielt sie unwillkürlich die Luft an.
„Können wir irgendwo in der Nähe Hilfe holen?“
„Das nächste Landgut auf unserem Weg ist Arradale, Mylady“, sagte Garforth, „und von dort sind’s nur noch fünf Meilen bis nach Hause.“
„Halte dort an!“ Rosamunde stopfte die Decken fester um den Mann. „Eine Stunde könnte über Leben oder Tod entscheiden! Mach am besten schon beim Witwenhaus Halt, das ist ein Stück näher als das Haupthaus.“
Arradale House war das Heim ihrer Cousine Diana, der Gräfin Arradale; bemerkenswert an ihr war der äußerst seltene Umstand, dass sie die Peerswürde mit ererbtem Sitz im Oberhaus innehielt. Das Witwenhaus von Arradale hatte Rosamunde und Diana in ihrer Kindheit als eine Art Spielstätte gedient, und die beiden jungen Frauen suchten es auch heute noch auf, wenn sie ein paar Tage entspannen oder ausgelassen wie früher sein wollten. Das Haus stand immer für sie bereit.
Garforth tippte an seinen Dreispitz, und quietschend setzte sich die Kutsche wieder in Bewegung. Je schneller sie fuhren, desto schneller käme der durchnässte Mann ins Warme; doch Rosamunde brachte es wegen ihres damaligen Unfalls genauso wenig über sich, auf Eile zu drängen, wie sie es vermocht hatte, mit einem maskierten Lüstling zu schlafen. Nach dem misslungenen Unternehmen hatte sie sich zunächst einreden wollen, dass sie es ja noch ein zweites Mal versuchen konnte. Wenn sie dann nicht mehr so aufgeregt wäre, würde es sicher klappen. Mittlerweile bezweifelte sie jedoch, dass sich all ihre Ängste allein durch Willenskraft besiegen ließen.
Sie verscheuchte ihre Sorgen und konzentrierte sich auf das, was sie im Augenblick tun konnte. Als sie die Hand wieder an den kühlen Hals des Mannes legte, konnte sie seinen Puls zwar spüren, aber nur ganz schwach. Es war durchaus möglich, an Unterkühlung zu sterben!
„Was meinst denn du, Millie?“
Das Mädchen hatte die Arme vor ihrem üppigen Busen verschränkt. „Sieht ganz nach einem Galgenvogel aus, Mylady! Wenn er aus seinem Rausch erwacht, solltet Ihr besser nicht in seiner Nähe sein.“
„Aber was ist, wenn er nicht wieder zu sich kommt? Meinst du, er könnte sterben?“
Millie war kein hartherziger Mensch, sondern lediglich schlecht gelaunt. Statt irgendwo in einem Gasthof behaglich in den Federn zu liegen, verbrachte sie den ganzen Tag auf einer chaotisch verlaufenden Fahrt. Und trotz hereinbrechender Dunkelheit waren sie immer noch unterwegs. Sie beugte sich vor und musterte den Mann. „Sieht ziemlich robust aus, wenn Ihr mich fragt, Mylady! Wenn er nicht gerade Lungenfieber kriegt, wird er wohl durchkommen.“
Rosamunde drückte den Mann fester an sich. Er war zwar ein Fremder und womöglich ein Taugenichts, aber sie hatte ihn gefunden und würde dafür sorgen, dass er wohlbehalten nach Hause kam!
Es musste doch irgendetwas geben, das sie richtig machte!
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die Kutsche endlich in die Auffahrt zum Witwenhaus einbog. Rosamunde war sich sicher, dass der Puls des Mannes schwächer geworden war. Vorsichtig rutschte sie unter ihm hervor und sprang hinaus, kaum dass die Kutsche zum Stehen gekommen war. Energisch bediente sie den Türklopfer. Es brannte zwar kein Licht, aber sie wusste, dass sich die Hausverwalter in ihrem Wohntrakt aufhielten.
Die Tür ging auf, und die hagere Mrs Yockenthwait spähte argwöhnisch in die Dunkelheit hinaus. „Na so was, Lady Overton!“
„Ich habe einen Verletzten in der Kutsche! Kann Mr Yockenthwait uns helfen, ihn ins Haus zu bringen?“
Kurz darauf wurde der in Decken gehüllte Mann durch die Tür getragen.
„In die Küche mit ihm“, befahl die Hausverwalterin unwirsch. „Dass mir die guten Böden nicht vollgetropft werden!“
Tom und der sehnige Mr Yockenthwait trugen die schwere Last durch einen Gang in die geflieste Küche, dann eilten sie wieder hinaus, um Garforth beim Versorgen der Pferde zu helfen. In der Küche strahlte eine Feuerstelle behagliche Wärme aus.
„Ihr übernachtet natürlich hier, Mylady“, sagte Mrs Yockenthwait bestimmt. „Es ist viel zu spät, um weiterzufahren!“
„Wir kommen gerade aus Harrogate – die Wege sind völlig aufgeweicht vom Regen! Unterwegs haben wir diesen Mann aufgelesen. Er lag einfach so da!“ Rosamunde spürte leichte Panik in sich aufsteigen und holte tief Luft. „Wir müssen ihm die nassen Kleider ausziehen!“
„Unbedingt“, sagte die Haushälterin und krempelte ihre Ärmel hoch. „Na komm schon, Millie!“
Millie, die sich auf einen Stuhl hatte plumpsen lassen, begann sich wieder hochzurappeln.
„Bleib ruhig sitzen, Millie“, sagte Rosamunde. „Ich werde Mrs Yockenthwait helfen!“
Die Haushälterin warf Rosamunde einen missbilligenden Blick zu. Offenbar gefiel es ihr nicht, dass sie Millie Igby schonte – oder sie hielt es für unschicklich, dass Rosamunde ihr beim Ausziehen des Mannes half. „Ich bin eine verheiratete Frau, Mrs Yockenthwait“, sagte Rosamunde mit fester Stimme. Hoffentlich merkte man ihr nicht an, dass sie trotz ihrer achtjährigen Ehe noch nie einen nackten Männerkörper gesehen hatte! „Aber geht Ihnen hier im Haushalt nicht ein Dienstmädchen zur Hand, seit Ihre Töchter verheiratet sind?“ „Jessie geht mit den Hühnern schlafen, Mylady! Ich bestehe darauf, denn schließlich muss sie auch mit den Hühnern aufstehen. Auch wir wollten gerade zu Bett gehen!“
Und natürlich hatten gottesfürchtige Menschen nach Sonnenuntergang nicht mehr unterwegs zu sein.
Rosamunde ignorierte den vorwurfsvollen Unterton und legte Handschuhe, Hut und Umhang ab. Weil keine Fremden zugegen waren – zumindest keine Fremden, die bei Bewusstsein waren –, nahm sie nach kurzem Zögern auch ihre mit Rüschen und Schleifen besetzte Spitzenhaube ab, mit der sie die Seiten ihres Gesichts kaschierte. Trotzdem strich sie nervös über die größte Narbe, die bis zum rechten Augenwinkel verlief: Was würde geschehen, wenn er zur Besinnung kam, während sie sich gerade über ihn beugte?
Rasch schob sie ihre Bedenken beiseite und kniete sich hin, um der älteren Frau beim Abwickeln der Decken zu helfen. Mrs Yockenthwait, die die Kräftigere von ihnen war, hob den Mann an, während Rosamunde ihm die nassen Kleidungsstücke – Jacke, Weste, Halstuch und Hemd – vom Oberkörper zog.
Danach war sie erhitzt und außer Atem, während der Mann immer noch blau vor Kälte war. Sie half Mrs Yockenthwait, ihn mit warmen, rauen Tüchern abzurubbeln, und fühlte sich belohnt, als er zu zittern begann, wenn auch unter heftigem Zähneklappern.
„So ist’s gut, oder?“, fragte sie.
„Ja, aber wir müssen ihn richtig durchwärmen! Ich werde trockene Decken holen und ein paar in Tücher gewickelte, aufgeheizte Backsteine.“
Wenig später war der Oberkörper des Mannes dick eingepackt, und das Zähneklappern hörte auf. Rosamunde trocknete sein braunes Haar mit einem Handtuch.
Dann wandten sie sich der unteren Hälfte zu.
Die Stiefel saßen so fest, dass Rosamunde befürchtete, sie würden dem Mann die Fußgelenke verrenken oder gar brechen. Als sie die Stiefel endlich auf den Fliesenboden warfen und das Wasser aus ihnen heraussickerte, schienen die bestrumpften Füße des Mannes jedoch keinen Schaden davongetragen zu haben. Ihm die restlichen Kleider auszuziehen ging dann sehr schnell. Rosamunde versuchte zwar krampfhaft, nicht auf seine Geschlechtsteile zu schauen, konnte aber nicht umhin, einen flüchtigen Blick darauf zu werfen.
Das harte Ding, das immer Schmerzen zu bereiten schien, sah direkt niedlich aus und lag schlaff an seinem behaarten Schenkel …
Rosamunde wandte den Blick schnell ab und hoffte, Mrs Yockenthwait würde ihre geröteten Wangen auf die Anstrengung zurückführen. Beim Abrubbeln übernahm sie Füße und Waden und empfand dabei ein ungewohntes verbotenes Vergnügen an seinem gut gebauten Körper. Dass ein männlicher Körper so wohlgestaltet sein konnte! Eigentlich hätte sie sich das denken können – in der Kunst wurden Männerkörper ja häufig nackt dargestellt.
Als sie den Mann umdrehten, um seinen Rücken trocken zu reiben, befand Rosamunde, dass er als Modell für die Art von Gemälden posieren könnte, die in Arradale House an den Wänden hingen. Bei ihr zu Hause hingen keine solchen Kunstwerke, denn Digby bevorzugte Pferde, Landschaften und Familienporträts. Einmal hatte er einen reisenden Künstler beauftragt, von ihnen beiden ein Doppelporträt anzufertigen; ihr Gesicht war darauf natürlich von der unversehrten Seite zu sehen.
Während sie die Beine des Mannes in eine warme Decke hüllte, entfuhr ihr ein Seufzer. Hätte sie ihren Schönheitsfehler denn für die Nachwelt festhalten wollen? Nein; trotzdem wäre sie lieber so dargestellt worden, wie sie wirklich war.
Sie verscheuchte ihre törichten Gedanken und half der Haushälterin dabei, den Mann wieder auf den Rücken zu drehen. „Das Zittern hat nachgelassen“, stellte sie fest, „jetzt dürfte ihm auch wärmer geworden sein!“
„Ja, und sicher wird es ihm auch guttun, etwas Warmes zu trinken!“ Doch als Mrs Yockenthwait versuchte, ihm Tee einzuflößen, lief das meiste daneben.
Rosamunde stand besorgt dabei. Sie hatte einmal gehört, dass sich jemand nackt neben eine unterkühlte Person gelegt hatte, um sie zu wärmen. Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie Mrs Yockenthwait bei so einem Vorschlag reagieren würde!
Sie verkniff sich ein Lächeln und strich dem Mann das Haar aus der Stirn. Während es in der Wärme des Feuers trocknete, ringelte es sich zu schönen, rotbraunen Locken. Sein gesäubertes Gesicht sah trotz Stoppeln und blauem Fleck gut aus; genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Der Mann durfte auf keinen Fall sterben – notfalls würde sie sich tatsächlich nackt ausziehen und sich neben ihm in die Decken wickeln!
Sie strich mit den Fingern über seinen Hals und spürte erleichtert, dass er wärmer und der Puls kräftiger geworden war.
Während Rosamunde den Mann nur ganz zaghaft berührte, schob die Haushälterin ihre abgearbeiteten Hände resolut unter die Decke und befühlte seine Brust. „Schon besser“, stellte sie fest. „Manchmal scheint der Alkohol sie zu schützen! Und jetzt, Mylady“, fuhr sie fort und richtete sich dabei auf, „bringe ich Euch erst einmal eine Tasse Tee!“
Auch Rosamunde erhob sich. Nach ländlichen Gepflogenheiten war es bereits spät. Millie schnarchte schon wieder.
Als Rosamunde den Tee entgegennahm, sagte sie: „Millie und ich werden in unseren gewohnten Betten schlafen, aber für ihn werden wir wohl auch eins brauchen.“ Sie blickte auf die eingewickelte Gestalt neben dem Kamin. „Wie lange wird er wohl bewusstlos bleiben?“
„Möglicherweise schläft er die ganze Nacht durch, Mylady. Ihr wollt ihn wirklich in einem Schlafzimmer unterbringen?“
Rosamunde zuckte innerlich zusammen, als ihr bewusst wurde, dass es tatsächlich ungewöhnlich war, einem Landstreicher solch einen Komfort zu bieten. Sie blickte erneut zu dem Mann hinüber, bei dem außer seinem guten Aussehen nichts auf seine gesellschaftliche Stellung hinwies. Es war durchaus möglich, dass er ein primitiver, abscheulicher Bursche war. Etwas an ihm deutete allerdings auf das Gegenteil hin, und das lag nicht nur an seinem Gesicht, das aussah, als würde es häufig lächeln.
Plötzlich wurde ihr klar, dass es an seinen Händen lag. Sie waren nun zwar unter der Decke verborgen, aber Rosamunde erinnerte sich, dass sie gar nicht rau und die Nägel sehr gepflegt waren. Außerdem war der Mann sauber gewesen. Nun ja, durch sein Missgeschick war er natürlich schmutzig geworden, doch aufgebrochen war er mit Sicherheit sauber und adrett wie jeder anständige Mann.
„Ein Schlafzimmer“, wiederholte sie bestimmt. „Ich möchte Ihnen keine zusätzliche Arbeit aufhalsen und werde mich mit Millie um ihn kümmern.“
„Mit der?“, fragte Mrs Yockenthwait und warf einen abschätzigen Blick auf das schnarchende Mädchen.
„Ach, dafür kann sie nichts – sie wird eben schnell müde. Kalt ist ihr auch immer, selbst wenn sie etliche Umschlagtücher um sich wickelt!“
„Oh ja, ihre Mutter war genauso. Aber sie ist Euch wohl kaum eine große Hilfe!“
„Nun, ich bin nicht sehr anspruchsvoll. Und es ist doch wichtig, dass sie eine Anstellung hat.“
Die Frau zuckte die Achseln. „Lasst ihn doch hier unten, Mylady. Auf dem Fußboden liegt er ganz gut, und neben dem Kamin ist es warm.“
„Wenn oben Betten zur Verfügung stehen? Das wäre doch herzlos!“
Rosamunde sah ein, dass ihre Hartnäckigkeit verwundern musste, doch langsam wurde ihr selbst klar, weshalb sie so handelte. Sie war überzeugt, dass er von guter Herkunft und daher das Obergeschoss der richtige Ort für ihn war. Außerdem gehörte er ihr. Er war ihre Angelegenheit – ihr lebendiges Gleichnis! Hier unten würde er außerhalb ihres Einflussbereichs und in der Obhut des Dienstpersonals sein. Oben würde sie sich seiner annehmen können, zumindest für ein Weilchen.
„Vielleicht ist er ein feines Bett gar nicht gewöhnt“, sagte die Frau mit einer Sturheit, wie sie für die Bewohner Yorkshires typisch war.
Aber auch Rosamunde war eine Frau aus Yorkshire. „Dann wird er es umso mehr genießen, nicht wahr?“
Mrs Yockenthwait schüttelte den Kopf. „Ihr hattet schon immer ein zu weiches Herz, Rosie Ellington.“ Aber sie sagte es mit dem Anflug eines Lächelns, und Rosamunde hörte mit Freude, dass sie ihren Mädchennamen benutzte.
Diana und sie waren als Kinder in diesem Teil von North Riding herumgetollt und ständig in Schwierigkeiten geraten. Wie oft hatten die Leute aus der Gegend sie nach Stürzen aufgehoben und ihnen den Staub abgeklopft! Und wenn sich die beiden Mädchen in Gefahr gebracht hatten, hatten sie dafür gesorgt, dass sie nach Hause kamen, damit sie sich dort ihre Bestrafung abholten.
Und jetzt waren Diana und Rosie wieder einmal in Schwierigkeiten! Nur dass Diana noch in Harrogate war und von ihrer feigen Cousine derzeit bestimmt die Nase voll hatte.
Als die Männer wieder hereinkamen, servierte ihnen Mrs Yockenthwait Tee und kalten Pie. Rosamunde gesellte sich zu ihnen. Während sie ihr schlichtes Mahl genossen, nahm Mrs Yockenthwait die langstielige Wärmpfanne von der Wand. „Ich werde mich schon mal um die Betten kümmern.“
Rosamunde sprang auf. „Ich mache das schon, Mrs Yockenthwait! Millie soll mir helfen.“ Sie schüttelte ihre Zofe, bis diese brummend aufwachte.
„Bin ich eingenickt, Mylady?“
„Gerade eben, Millie! Aber du musst mir jetzt beim Zurechtmachen der Betten helfen. Mrs Yockenthwait hat schon genug zu tun!“
„Das ist sehr nett, meine Liebe“, sagte die Frau und streckte sich. „Ich heize inzwischen noch ein paar Backsteine auf.“
Millie bestand darauf, die schwere Wärmpfanne hochzutragen. Rosamunde folgte ihr, um sicherzugehen, dass die Pfanne nicht umkippte. Zuerst gingen sie ins vordere Schlafzimmer, in dem Rosamunde und Diana immer schliefen. Rosamunde versuchte Millie die Arbeit zu überlassen, doch weil das Mädchen so schrecklich langsam war, verlor sie schließlich die Geduld und nahm ihr die Wärmpfanne ab. „Geh du lieber zu Tom hinunter! Er soll unser Gepäck hochbringen, damit du schon alles herrichten kannst. Um die Betten kümmere ich mich!“
Millie nickte und stapfte davon.
Rosamunde wärmte mit der Wärmpfanne das Bett im Gästezimmer vor und war froh, dass die Zimmer jetzt im Sommer nicht zu feucht und zu kalt waren. Mit ein paar warmen Backsteinen zusätzlich müsste es für ihn ganz behaglich sein.
Anschließend wärmte sie auch Millies Bett im kleinsten Zimmer. Die Ärmste fror nachts immer fürchterlich, selbst wenn sie zum Schlafen mehrere Kleider übereinander anzog. Zuletzt ließ Rosamunde die Wärmpfanne in dem Bett zurück, in dem der Mann schlafen würde. Während sie die Treppe hinuntereilte, fragte sie sich, ob sie eine Nachricht nach Wenscote schicken sollte, damit Digby wusste, wo sie war. Da sie aber ohnehin vorgehabt hatte, vierzehn Tage in Harrogate zu bleiben, würde er sie gar nicht vermissen. Außerdem war es schon sehr spät.
Am Fuß der Treppe hielt sie inne und beschloss, Digby besser nicht zu benachrichtigen, weil er dann unweigerlich zusätzliche Dienstboten herüberschicken würde. Und diese würden ihr ihn aus den Händen nehmen …
Sie schüttelte den Kopf. Er war gewiss nicht nur ein Betrunkener am Straßenrand! Kleider machen Leute, hieß es, aber nachdem sie ihrem zum Leben erweckten Gleichnis die Alltagskleider ausgezogen hatten, schien er ihr eher mehr zu sein als weniger.
Dumme romantische Fantasien! Sie war ja schon eifrig dabei, sich aus seinen rotbraunen Locken und seinem herrlichen Körper eine Kombination aus Herkules, Horatius und Roland zusammenzubasteln! Einen edlen fahrenden Ritter …
Bei diesem Gedanken erstarrte sie.
Einen fahrenden Ritter?
Genau so einen hatte sie doch auf dem Maskenball gesucht!
Warum sollte sie bis zu einem weiteren Maskenball warten?
Es war eine so aberwitzige Idee, dass sie den Gedanken kaum weiterzuspinnen wagte. Doch er ließ sie nicht los und verfestigte sich wie Dunst, der im Winter eine Fensterscheibe beschlägt und zu filigranen Eismustern gefriert.
Schließlich musste sie ja etwas unternehmen! Dr. Wallace hatte sie gewarnt, dass Digby jeden Augenblick einen Schlaganfall erleiden und tot umfallen konnte. Wegen seiner Kurzatmigkeit und seines stets geröteten Kopfes war ihr das ohnehin schon lange klar.
Jeden Augenblick!
Und dann würde Wenscote Edward und seiner Sekte gehören.
Als sie kürzlich mit Diana auf Reisen war, hatten sie ein Landgut besucht, das bereits im Besitz dieser Sekte gewesen war. Die beiden hatten feststellen müssen, dass die Geschichten, die über diese Sekte erzählt wurden, nicht nur der Wahrheit entsprachen, sondern dass alles noch viel schlimmer war.
Die Mitglieder von George Cotters Neuer Glaubensgemeinschaft mussten sämtlichen Freuden des Lebens entsagen und sich ganz der Arbeit und dem Gebet widmen. Jeder Verstoß wurde bestraft. Straften Eltern ihre Kinder nicht hart genug – zum Beispiel, wenn ein Mädchen seine Haube oder ein Junge seinen Kragen abgenommen hatte –, übernahmen dies die ‚Heiligen‘ der Glaubensgemeinschaft für sie, und dann floss Blut.
Rosamunde hatte einige Kinder dieser Sekte gesehen; sie mussten selbst an heißen Tagen dicke, unbequeme Kleider tragen und sahen aus, als wagten sie aus Angst vor einer Bestrafung nicht einmal zu atmen.
Der einzige Ausweg für die armen, in der Falle sitzenden Menschen bestand darin, fortzuziehen und das Land aufzugeben, auf dem ihre Familien seit Generationen und Jahrhunderten gelebt hatten.
Sie konnte nicht zulassen, dass Wenscote das Gleiche widerfuhr, vor allem deshalb nicht, weil ihr persönlich keine Gefahr drohte. Mit ihrem Witwenanteil könnte sie selbst sich anderswo niederlassen, während das Dienstpersonal und vor allem die Pächter in der Falle sitzen würden. Sie hatte es in der Hand gehabt, sie alle zu retten, aber sie hatte versagt! Und nun wurde ihr eine zweite Chance gewährt.
Ein Mann. Ein Fremder, der bald wieder fort sein würde!
Sie musste es zumindest versuchen! Sonst würde sie sich ihr Leben lang Vorwürfe machen.
Also gut. Obwohl sie bei dem Gedanken schon jetzt innerlich zitterte, beschloss sie, ihn in die Tat umzusetzen. Sie würde es tun. Die Frage war nur noch, wie sie vorgehen sollte.
Wie zum Beispiel sollte sie den Mann zum Mitmachen bewegen?
Männer, besonders junge Männer, waren landläufigen Ansichten und Warnungen zufolge begierig darauf, zwischen die Beine einer Frau zu gelangen. Offenbar mussten sie häufig sogar gewaltsam abgewehrt werden, und manche griffen auch zum Mittel der Entführung, um ans Ziel zu gelangen. Jede junge Frau wusste, dass das Alleinsein mit einem Mann zwangsläufig sündhaftes Treiben und einen anschwellenden Bauch zur Folge hatte.
Genau das wollte sie ja! Es sollte eigentlich so einfach sein, wie reife Beeren zu pflücken. Trotzdem hegte sie Zweifel …
„Ist alles in Ordnung mit Euch, Mylady?“
Rosamunde fuhr zusammen, als die Hausverwalterin sie ansprach. Da stand sie hier im Flur herum und hätte doch längst das Bettzeug holen, die Betten beziehen und wärmen können! Sie war sich sicher, dass ihr verruchter Plan sie wie sichtbare Höllenflammen umloderte, und verschwand schnell in der Küche. Dort bat sie die Männer, ihren Ritter, ihren Retter, ihren möglichen Sündenpartner in sein Bett hochzutragen.
2
Um das Bett noch einmal vorzuwärmen, eilte Rosamunde voraus. Er durfte auf keinen Fall Fieber bekommen. Nachdem die Männer ihn diskret aus den Decken gewickelt und unter die Bettdecke gelegt hatten, verteilte sie die aufgeheizten Backsteine um ihn herum und packte ihn warm ein.
„Kennen Sie den Mann, Mr Yockenthwait?“, fragte sie. Damit ihr Plan funktionierte, musste es ein Fremder sein, einer, der möglichst nie wieder in diese Gegend käme.
Seth Yockenthwait schüttelte den Kopf. „Er ist nicht von hier, Mylady. Und ein so gut aussehender Spitzbube wie der wäre mir mit Sicherheit aufgefallen.“
Rosamunde musterte den Mann erneut und merkte, dass Seth recht hatte. Bisher hatte sie nur einzelne Teile von ihm begutachtet; jetzt stellte sie fest, dass alle wunderbar harmonierten.
Besonders angetan hatten es ihr die schön geschwungenen Lippen.
Zum Küssen.
Sie trat vom Bett zurück. Meine Güte! Sie konnte sich doch nicht einerseits auf ein Opfer vorbereiten und gleichzeitig wie eine liebestolle Sennerin nach süßen Küssen schmachten! So ging das nicht …
Doch dann redete sie sich ins Gewissen. Denk bloß nicht, du könntest einen Rückzieher machen. Du wirst es tun, Mädchen, selbst wenn er ein leibhaftiger edler Ritter ist!
Sie verkniff sich das Lachen, das sie wegen ihrer verrückten Gedanken überkam, und verließ als Erste das Zimmer. Es durfte keiner merken, dass sie ein persönliches Interesse an dem Mann hatte.
„Wir wissen rein gar nichts über ihn“, stellte sie so beiläufig wie möglich fest. „Es könnte sein, dass er ein übler Schurke ist, und ich will nicht, dass hier jemand gefährdet wird.“ Sie schloss das Zimmer von außen ab und steckte den Schlüssel in ihre Tasche. „So. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Mr Yockenthwait.“
„Ganz recht, Mylady“, sagte der Mann in der typischen Art des männlichen Yorkshire-Bewohners, der Frauen für dämlich hält, sich aber hütet, dies laut zu äußern.
Vor Nervosität beinahe zitternd, sah Rosamunde den wieder nach unten gehenden Männern hinterher und ließ sich dann von Millie zur Nacht herrichten. Anschließend schickte sie das Mädchen in ihr Zimmer und wartete. Sobald sie sicher war, dass alle im Bett lagen, holte sie noch einmal tief Luft …
Und zögerte.
Sie konnte es nicht tun. Unmöglich!
Es ist doch völlig harmlos, du Gans! Du willst nur nach deinem Patienten sehen!
Trotzdem brauchte sie den Schlägen der Standuhr draußen im Gang zufolge eine ganze Viertelstunde, bis sie Mut schöpfte und sich aufraffte. Sie zwang sich, das Zimmer zu verlassen und zu seiner Tür hinüberzugehen. Sie nahm vorsichtshalber keine Kerze mit, denn vielleicht war er aufgewacht, und er durfte sie auf keinen Fall sehen. So leise wie möglich drehte sie den Schlüssel herum, schlich in das dunkle Zimmer, schloss die Tür und blieb dort stehen, den Rücken an das Holz gepresst.
Er lag immer noch reglos da; nichts deutete darauf hin, dass er zu sich gekommen war.
Leise wie ein Dieb schlich sie ans Fenster, um den Vorhang einen Spalt weit aufzuziehen und das schwache Mondlicht hereinzulassen.
Er hatte sich auf die andere Seite gedreht. Sie hielt das für ein gutes Zeichen, doch als sie ihn vorsichtig berührte, um seinen Puls und seine Temperatur zu fühlen, gab er keinen Mucks von sich. Aber er fühlte sich schön warm an, und es bestand wohl keine Gefahr mehr, dass er nicht durchkommen würde.
Also, was nun?
Sie trug einen Stuhl dicht neben das Bett, ließ sich darauf nieder, betrachtete die schemenhafte Gestalt und redete sich gut zu.
Wenscote war in schrecklicher Gefahr. Bis zum Frühjahr war alles in bester Ordnung gewesen, weil bis dahin nicht Edward der zukünftige Erbe war, sondern William, ein anderer Neffe von Digby. William, wie Digby ein warmherziger Yorkshire-Mann, hätte Wenscote übernommen und das Landgut auf dieselbe großzügige Weise geführt wie sein Onkel.
William Overton war jedoch plötzlich gestorben – vielleicht weil er Digby so ähnlich war. In einem Gasthof in der Nähe von Filey hatte er ein üppiges Mahl genossen, dabei zu viel getrunken und einen Schlaganfall erlitten. Und nun war Edward der rechtmäßige Erbe von Wenscote. Und Edward, der in York aufgewachsen war, hatte sich der Neuen Glaubensgemeinschaft angeschlossen …
Williams Schicksal als warnendes Beispiel vor Augen, war Digby zwar bemüht, seine Lebensweise zu ändern und mäßiger zu essen und zu trinken. Doch es gelang ihm nicht, und er genoss weiterhin die Freuden des Lebens. Edward Overton, der ihn jetzt regelmäßig besuchte und ihm dann Vorträge über die Vorzüge der einfachen Ernährung hielt, bewirkte damit nur, dass sein Onkel dem Essen aus reiner Verärgerung erst recht kräftig zusprach.
Und nun sein verspäteter Kinderwunsch.
Digbys Interesse an ehelichen Dingen war noch nie sehr groß gewesen und in den letzten Jahren völlig erloschen. Der Gedanke an Edward hatte ihn jedoch dazu gebracht, es ein paar Mal zu versuchen. Als sie sich an diese Misserfolge erinnerte, fingen Rosamundes Wangen in der Dunkelheit zu brennen an.
Armer Digby.
Im Anschluss daran hatte er begonnen, Rosamunde gegenüber dezente Andeutungen zu machen.
„Du bist eine junge Frau, mein Schatz. Es wäre nur natürlich, wenn du hin und wieder ein Auge auf hübsche junge Männer werfen würdest.“
Und: „Vielleicht ist Gott einem alten Sünder gnädig und lässt für ihn ein Wunder geschehen.“
Mit bitterem Lächeln sann Rosamunde über ihr Wunder nach. Es war lächerlich, den Mann in diesem Bett als ein Geschenk des Himmels zu betrachten. Er hatte mit Sicherheit nur wegen einer Dummheit am Straßenrand gelegen, und das, was sie hier plante, war eine Sünde, so ehrenwert der Anlass auch sein mochte.
Stimmte es wirklich, dass der Zweck die Mittel heiligte?
Ja, davon war sie überzeugt.
Plötzlich kam ihr ein Problem in den Sinn, und sie erstarrte.
Die Idee mit dem Maskenball war deshalb so verlockend gewesen, weil sie dort für den Mann, mit dem sie sich eingelassen hätte, inkognito hätte bleiben können. Angesichts der Tatsache, dass eine Erbschaft auf dem Spiel stand, war das sehr wichtig.
Wenn dieser Mann jedoch von hier aufbrechen würde, wüsste er, wo er gewesen war, und könnte leicht herausfinden, mit wem er zusammen gewesen war.
Das Kinn in die Hand gestützt, überlegte sie hin und her und wünschte, Diana wäre da, die im Pläneschmieden viel besser war als sie. Was wäre ihr Rat?
Ein falscher Name! Sowohl für sich selbst als auch für dieses Haus. Das wäre ganz einfach, vor allem dann, wenn sie den Mann nicht aus dem Zimmer ließ und die Yockenthwaits von ihm fernhielt. Wenn sie diese schweigsamen Leute um Geheimhaltung bat, würden sie ihrem Wunsch bestimmt nachkommen. Und Millie würde ohnehin tun, was man ihr auftrug.
Welchen Namen sollte sie wählen? Wenn er je auf den Gedanken käme, sie zu suchen – welcher Name würde ihn völlig in die Irre führen, ohne dass sie den Ruf anderer gefährdete? Mit einem Anflug von Schalkhaftigkeit entschied sie sich für den Namen Gillsett. Dies war der Name zweier exzentrischer Schwestern, die im abgelegenen Arkengarthdale einen Hof bewirtschafteten.
Jeder, der Rosamunde dort zu finden versuchte, würde in einer Sackgasse landen.
Doch wie sollte sie ihn fortgehen lassen, ohne dass er merkte, wo er gewesen war? Natürlich! Sie würde ihn einfach wieder betrunken machen!
Erlösende Gewissheit durchdrang sie stark und klar wie ein dahinströmender Fluss. Es war richtig so. Es würde funktionieren. Es sollte so sein.
Und wenn er erst einmal fort war, würde er sowieso nicht nach ihr suchen. Die Welt war voll von Männern, die von einer Frau, mit der sie eine Nacht verbracht hatten, nichts mehr wissen wollten, und die sich nicht um die Kinder kümmerten, die sie gezeugt hatten. Rosamunde war kein einziger Fall bekannt, wo ein Mann sich die Mühe gemacht hätte, eine Frau aufzuspüren.
Also – nervös strich sie mit den Händen übers Kleid – ging es nur noch darum, wie sie ihn dazu bekam, das Nötige zu tun. Doch das dürfte kein Problem sein. Männer waren bekanntlich wie Schafböcke oder Stiere. Wenn sich die Gelegenheit bot, ein Weibchen zu begatten, nahmen sie diese auch wahr. Wenn er beim Erwachen eine Frau neben sich im Bett vorfand …
Rosamundes Herz begann wild zu schlagen, und sie schluckte, um ihre trockene Kehle zu befeuchten. Konnte sie das wirklich tun?
Sie musste es tun. Dieses Mal würde sie kein Feigling sein. Sie zog die Vorhänge wieder zu, streifte ihren Morgenrock ab und hängte ihn mit zittrigen Händen ordentlich über die Rückenlehne des Stuhls. Nach kurzem Zögern schlüpfte sie unter die Daunendecke und blieb am äußersten Rand des warmen Betts liegen.
Weil ihr zu warm war, nahm sie einen der heißen Backsteine heraus. Dann versuchte sie, eine bequeme Lage zu finden.
Mit einer anderen Person im Bett zu liegen, kam ihr nicht seltsam vor, denn schließlich tat sie das seit ihrer Heirat; dieser Mann hier lag allerdings in der Mitte.
Sie rückte so nah an ihn heran, wie sie irgend wagte …
Erbarmen! Sie hatte ganz vergessen, dass er nackt war! Eigentlich spielte das keine große Rolle, aber neben einem nackten Mann zu liegen war doch so ziemlich das Sündhafteste, was man sich vorstellen konnte.
Nein.
Das war nicht das Sündhafteste.
Sie wollte mit aller Gewalt Ehebruch begehen.
Das war das Sündhafteste.
Sie versuchte sich innerlich auf die Prozedur vorzubereiten. Bloß nicht im letzten Augenblick in Panik geraten!
Es war doch so einfach. Er würde ihr Nachthemd hochziehen, sich auf sie drauflegen und ein bisschen hin und her rutschen, bis er hineinfand. Er würde ein paarmal zustoßen, bis sich sein Samen ergoss, sich anschließend umdrehen und weiterschlafen. Vielleicht würde er sogar vergessen, dass es passiert war.
Das Einzige, was sie tun musste, war, es zuzulassen.
Sie atmete ein paarmal tief durch und sagte sich wieder und wieder, dass sie dazu in der Lage war – es hinzunehmen. Um es noch einfacher zu machen, schob sie nach einer Weile das Vorderteil ihres Nachthemds schon mal bis zur Hüfte hoch.
Als nichts geschah, rückte sie noch näher an ihn heran, sodass ihr nackter Oberschenkel nun den seinen berührte.
Dann lachte sie leise über sich selbst.
Glaubte sie etwa, er würde aus seinem Vollrausch erwachen, als hätte ihm jemand Riechwasser unter die Nase gehalten?
Was war sie doch für eine Närrin! Er war immer noch stockbetrunken und würde vermutlich die ganze Nacht durchschlafen. Bevor er nicht zu Bewusstsein kam, konnte er wohl kaum von Wollust befallen werden.
Sie blinzelte ein paar Tränen weg, die ihr teils vor Lachen, teils vor Pein in die Augen getreten waren, und entschied, dass sie genauso gut in ihrem eigenen Bett schlafen konnte.
Aber sie tat es dann doch nicht.
Es war leichter geborgen neben seinem warmen Körper liegen zu bleiben. Und wer weiß, wann er aufwachen würde. Vielleicht erst am späten Vormittag, vielleicht aber schon in den nächsten Stunden. Sie musste da sein, wenn er zu sich kam.
Obwohl ihr durchaus bewusst war, dass sie sich sonderbar verhielt, begann Rosamunde, sich enger an ihren bewusstlosen, unvollkommenen Ritter, ihren ahnungslosen Liebhaber, ihren vom Himmel gesandten Retter zu kuscheln. Sachte ließ sie sich von seiner Wärme und seinen leisen Atemzügen in den Schlaf lullen.
Dunkelheit.
Schmerzen.
Höllenqualen!
Damit sein Kopf nicht platzte, presste er die Hände dagegen und war erstaunt, dass der Schädel sich in Wirklichkeit gar nicht mit jedem Herzschlag ausdehnte und zusammenzog.
Wo zum Teufel war er?
Was war mit seinem Kopf passiert?
Er öffnete die Augen einen Spalt weit, aber er konnte absolut nichts sehen.
Blind! War er blind?
Endlich nahmen seine hektisch hin und her blickenden Augen einen helleren Streifen wahr. Sicher eine Lücke zwischen zwei schweren Vorhängen, durch die das Abendlicht schimmerte. Bitte, lieber Gott, lass es so sein!
Diese Bauchschmerzen! Diese Krämpfe! Nicht so schlimm wie die Kopfschmerzen, aber schlimm genug. Er hoffte nur, dass ihm nicht schlecht würde. Wenn er sich übergeben müsste, würde er womöglich ersticken, weil er seinen Kopf bestimmt nicht bewegen konnte.
Während er vollkommen reglos liegen blieb, begann er andere Dinge wahrzunehmen. Er lag in einem Bett. In einem ziemlich bequemen Bett.
Er war nackt. Einen schwerkranken Mann würde man doch nicht nackt ins Bett stecken, oder?
Jemand lag neben ihm.
Sie lagen ein Stück auseinander, aber er konnte regelmäßige Atemzüge hören.
Eine Frau? Das würde erklären, warum er keine Kleider anhatte, aber …
Was zum Teufel hatte er bloß angestellt?
Vielleicht war es ja auch ein Mann – ein Mitreisender, ein Zechgenosse, der zusammen mit ihm umgekippt war. Vorsichtig versuchte er sich zu bewegen und streckte forschend eine Hand aus.
Eindeutig weiblich. Er registrierte nun den zarten Blumenduft, den seine Sinne schon vorher wahrgenommen hatten. Sie trug ein Nachthemd. Merkwürdig. Er konnte sich nicht erinnern, jemals eine Frau verführt zu haben, ohne ihr dabei das Nachthemd auszuziehen.
Vielleicht war sie sehr keusch; aber solche Frauen waren gar nicht sein Typ.
Wer mochte sie sein?
Er hatte keine Ahnung. Nicht die leiseste Vorstellung. Heiliger Strohsack – ein schöner Schlamassel!
Seinem Kopf und der Tatsache zufolge, dass er sich nicht an die Frau erinnern konnte, musste er ein ganzes Fass leer getrunken haben. Was sollte er ihr am Morgen bloß sagen?
Aber wo hatte er so viel getrunken? Wenigstens das sollte er noch wissen. Er müsste sich zumindest daran erinnern, wo er das erste Glas geleert hatte.
Er suchte verzweifelt nach einem Ort, einem Namen, einem Bild …
Und stürzte in eine schreckliche Leere. Da, wo sein Gedächtnis sein sollte, war nur ein Vakuum.
Voller Panik klammerte er sich an eine Tatsache, von der er sicher war, dass sie stimmte. Er hatte nicht allzu viel getrunken. Seit seiner Kavaliersreise durch Italien hatte er keinen Vollrausch mehr gehabt. Damals war er sechzehn gewesen und hatte geglaubt, die Folgen hätten ihn für den Rest seines Lebens vom übermäßigen Alkoholgenuss kuriert.
War er jetzt etwa in Italien, in einem Palazzo in Venedig, volltrunken von edlem Wein?
Nein. Seither waren Jahre vergangen.
Viele Jahre.
Er war in England.
Ja, er war sich sicher, dass er in England war und ein erwachsener Mann. Er fuhr sich mit der Hand übers Kinn und spürte die kräftigen Knochen und die kratzigen Bartstoppeln.
Eine weitere Tatsache kam ihm in den Sinn. Sein neunundzwanzigster Geburtstag lag noch nicht weit zurück.
Warum wusste er manche Dinge so sicher, während ihm andere entfallen waren? Er wusste, dass er in England war, aber nicht, an welchem Ort. Er wusste, wie alt er war, aber nur wenig von dem, was er seit seinem zehnten Lebensjahr getan hatte. Verdammt! Er wollte den Kopf schütteln, hielt aber sofort wieder inne, weil ihn ein heftiger Schmerz durchfuhr. Sein Hirn war sowohl benebelt als auch leer, so, als hinge ein dichter Schleier zwischen ihm selbst und den Bruchstücken seines Lebens.
Woran konnte er sich außerdem erinnern? Woran?
Dass er sich von seiner Familie in London verabschiedet hatte.
Er hatte eine Familie – Brüder und Schwestern. Er konnte im Geist sogar ihre Gesichter sehen, doch als er sich ihre Namen ins Gedächtnis rufen wollte, fiel ihm nur Unsinn ein. Eine Elfe? Eine breite Elfe? Eine sündige Elfe?
Das war ja nicht zum Aushalten! Er versuchte sich aufzusetzen, gab es aber wieder auf, weil ihn erneut ein Schmerz durchzuckte. Oh Gott, oh Gott …
Langsam ließ er seinen Brummschädel zurück auf das Kissen sinken und blieb wieder vollkommen still liegen. Bei jedem Atemzug jagte ein stechender Schmerz durch seinen Kopf.
Vielleicht war er ernstlich krank. Aber wer war dann die Frau in seinem Bett? Seine Krankenpflegerin?
Wohl kaum.
Wer war sie?
Wer war er selbst?
Diese einfache Frage stieg jäh in ihm auf und sank sogleich in diese beängstigende Leere hinunter, sodass er vor Entsetzen erstarrte. Entsetzen darüber, dass er mit dieser Frage in dieses tiefe, schwarze Loch stürzen und aufhören würde, zu existieren.
Seine Hand tastete nach etwas Realem. Egal was. Ihr Baumwollnachthemd.
„Oh – Ihr seid wach!“
Die Frau hatte sich bewegt und ergriff nun seine zitternde Hand. Er umklammerte sie und hätte vor Dankbarkeit fast geweint.
„Wo bin ich?“, flüsterte er, weil er Angst hatte, die Schmerzen würden sich verschlimmern, wenn er lauter sprach.
Schweigen. Hatte er sich die Frau nur eingebildet? Er umklammerte ihre weiche Hand noch fester …
„In Gillsett! Au, Ihr tut mir weh!“
Er lockerte sofort seinen Griff. „Verzeiht! Ich … ich kann nichts sehen!“
Sie strich ihm mit ihrer anderen Hand über die Stirn, eine liebevolle Geste, die ihm wohlig vertraut vorkam. War dies seine Ehefrau? Er würde doch wohl noch wissen, ob er verheiratet war!
Die Vorstellung, vertraut mit dieser warmen Stimme und dieser weichen, liebkosenden Hand zu sein, war jedenfalls nicht unangenehm.
Ach was! Ihre zärtliche Berührung erinnerte ihn lediglich an seine Mutter, die seit vielen Jahren tot war. Mit ihrer sanften Stimme hatte sie ihn in Fiebernächten beruhigt. Sie hatte allerdings Französisch gesprochen. War er Franzose …?
Nein, mit Sicherheit nicht.
„Das liegt nur daran, dass es dunkel ist, Sir“, sagte die Frau eindeutig auf Englisch. „Es ist mitten in der Nacht.“
Er machte sich zum Narren. Da lag er hier mit einem Flittchen und einem fürchterlichen Kater in einem Gasthof und führte sich auf, als wäre ein böser Geist hinter ihm her. Die Schmerzen jedoch waren real, und sein Magen wogte immer noch bedrohlich.
„Ich habe wohl zu viel getrunken.“
„Ihr könnt Euch nicht mehr daran erinnern, Sir?“
Oh verdammt. Wie sollte er verhindern, dass sie merkte, dass er sich nicht an sie oder an die fröhlichen Bettspiele erinnerte, die sie zweifellos miteinander gespielt hatten? „Es tut mir leid. Mein Kopf … Er schmerzt fürchterlich.“
„Ist schon in Ordnung!“ Sie berührte ihn erneut auf diese zärtliche, wunderbare Weise, strich ihm mit ihren kühlen Fingern sacht über die Hände und den Kopf. „Versucht, wieder zu schlafen. Morgen Früh wird es Euch besser gehen.“
„Ist das ein Versprechen?“ Es gelang ihm sogar, einen leicht humorvollen Unterton in seine Frage zu legen, was ihm irgendwie typisch vorkam. Doch dann stieg ein widerwärtiger Geschmack in seine Kehle, und er drehte sich trotz der hämmernden Schmerzen in seinem Kopf hastig von ihr weg. „Ich muss mich übergeben!“, stieß er mit erstickter Stimme hervor.
Während er dagegen anzukämpfen versuchte, stand sie wie durch ein Wunder plötzlich auf der anderen Seite des Betts und hielt ihm genau in dem Moment den Nachttopf vor den Mund, als der Brechreiz ihn überwältigte.
Zumindest schienen die Schmerzen mit dem brennenden Erbrochenen ein wenig abzunehmen. Als er aufs Kissen zurücksank, hörte das Stechen in seinem Kopf auf. Nur das Hämmern dauerte an.
Ein widerlicher Gestank verbreitete sich im Zimmer. Dies war wohl das Peinlichste, was ihm in seinem Erwachsenenleben je passiert war. „Ich bitte vielmals um Vergebung …“
„Das macht nichts.“ Er nahm einen belustigten Unterton wahr und stöhnte auf. Er musste ja die reinste Witzfigur abgeben. Als er die Frau vergangene Nacht in sein Bett gelockt hatte, war er bestimmt äußerst galant gewesen, und nun lag er hier wie ein greinendes, krankes Kind.
Sie wischte ihm mit einem feuchten Tuch das Gesicht ab. Dann hob sie seinen Kopf leicht an und hielt ein kühles Glas an seine Lippen.
„Mehr“, verlangte er, als er das Wasser ausgetrunken hatte.
Er vernahm Gläserklirren und das angenehme Geräusch gluckernden Wassers. Er war froh, dass sich alles im Dunkeln abspielte, denn allein der Gedanke an helles Licht ließ ihn erschaudern. Einen Augenblick später hielt sie ihm ein weiteres volles Glas an den Mund; er leerte es und sank dankbar in die Kissen zurück.
Daunenkissen.
In Gasthöfen gab es keine Daunenkissen.
„Wo bin ich?“, fragte er erneut. Hatte sie das nicht bereits gesagt? Er hatte es schon wieder vergessen.
„In Gillsett.“
Das klang nicht nach dem Namen eines Gasthofs. Eher nach einem Wohnsitz. Einem Gehöft – oder gar einem Gutshof i..
„Wie heißt Ihr, Sir? Sollen wir jemanden benachrichtigen?“
Wenigstens brauchte er ihr nicht zu sagen, dass er das nicht wusste. Denn nun versank er wieder in diese alles auslöschende Leere.
3
Rosamunde richtete sich auf und schüttelte den Kopf. Da nahm sie sich vor, Ehebruch zu begehen, und am Ende stand sie mit stinkenden Nachttöpfen da! Vielleicht war ihr eintöniges Leben gar nicht Folge ihres Unfalls, sondern schlicht und einfach ihr Schicksal!
Zumindest hatte sie es geschafft, ihm die Lüge über seinen Aufenthaltsort aufzutischen.
Sie war noch nie eine gute Lügnerin gewesen. Sie hasste Betrug, und ihre stockende Zunge und ihr schuldbewusstes Erröten hatten Diana und sie immer wieder verraten. Heute Nacht hingegen hatte sie mit ruhiger Stimme die Unwahrheit gesagt, und die Dunkelheit hatte ihre glühenden Wangen verborgen.
Vielleicht gelang es ihr ja doch noch, diesen verrückten Plan durchzuführen.
Allerdings nicht sofort.
Sie musste warten, bis es ihm wieder besser ging. Folglich konnte sie vorerst genauso gut ihren Nachttopfpflichten nachkommen.
Sie öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen, streifte ihren Morgenrock über und trug den Nachttopf hinaus. Weil sie ihn schlecht im Flur stehen lassen konnte, holte sie die kleine Nachtlampe aus ihrem Zimmer, schlich die Treppe hinunter und stellte den Topf leise draußen vor die Hintertür.
Zurück in ihrem Zimmer, zog sie den sauberen Nachttopf unter ihrem Bett hervor, ging damit zu ihm hinüber und stellte den Topf neben sein Bett. Ob sie wohl besser bei ihm bleiben sollte, falls er sich noch einmal übergeben musste?
Nein! Schließlich hatte der Kerl sich selbst in diesen Zustand gebracht – da konnte er auch ohne ihre Hilfe spucken, bis er wieder nüchtern war!
Zutiefst verstimmt kroch Rosamunde in ihr eigenes Bett, das jetzt unangenehm kalt war. Doch kurz darauf musste sie schon wieder über sich lachen: Wie hatte sie sich bloß einbilden können, dass ein kranker Mann beim Erwachen schlagartig gesund und wollüstig sein könnte?
Wie dumm von ihr!
Trotzdem wünschte sie, es wäre so gewesen, denn dann hätte sie es jetzt hinter sich.
Sie drehte sich zur Seite, boxte in ihr Kissen und fühlte sich aus irgendeinem Grund todunglücklich …
Dann fiel ihr ein, warum. Ihr wurde wieder bewusst, wie langweilig ihr Dasein war – eine Tatsache, die sie sich normalerweise nicht eingestand.
Sie führte ein schönes Leben. Sie hatte einen herzensguten Ehemann, ein gemütliches Zuhause und ein gut geführtes Landgut, auf dem es viel Nützliches zu tun gab. Ihre Familienangehörigen lebten in der Nähe, und sie war von guten Freunden umgeben.
Durch den Unfall hätte sie dazu verdammt sein können, den Rest ihres Lebens als Einsiedlerin zu verbringen, doch Digby hatte sie durch sein freundliches Angebot, sie zur Frau zu nehmen, errettet.
Wann war man eigentlich eine Einsiedlerin? Selbst eine Frau, die in einer Gemeinschaft lebte, konnte als Einsiedlerin gelten, wenn sie diese nie verließ. Wenn sie Angst davor hatte.
Die Fahrt nach Harrogate war ihre erste Unternehmung außerhalb von Wensleydale seit acht Jahren gewesen.
Na und? Sie drehte sich um und boxte wieder in ihr Kissen. Viele Leute begnügten sich damit, ständig in der Nähe eines schönen Heims zu sein. In Wensleydale gab es Leute, die noch nicht einmal in Richmond gewesen waren!
Dennoch – sie musste zugeben, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden war. Stattdessen fühlte sie sich von der Welt um sie herum ausgeschlossen.
Sie strich mit dem Finger über die langen Narben rechts von ihrem Auge. Doch nicht sie waren das Problem. Sie versteckte sich wegen der Narbe, die quer über ihre Wange verlief, auch wenn ihre Familie und Diana immer wieder beteuerten, dass sie gar nicht so schlimm sei.
Aber selbst Digby saß lieber an ihrer linken Seite.
Der liebe Digby. Als Freund ihres Vaters und Wahlonkel hatte sie ihn stets geliebt. Jedoch nicht so – das wurde ihr immer klarer –, wie eine Ehefrau ihren Ehemann lieben sollte. Mit sechzehn war ihr das allerdings noch nicht bewusst gewesen, auch hatte sie nicht bedacht, wie unpassend es ihr vorkommen würde, wenn er seine ehelichen Rechte einforderte. Es war nie schrecklich gewesen, sondern lediglich etwas, das sie und Sir Digby Overton nicht miteinander tun sollten.
Sie war froh gewesen, als sein Interesse daran erloschen war und sie wieder unbeschwert miteinander leben konnten.
Bis jetzt.
Denn jetzt musste sie ein Kind bekommen. Das war sie Digby, Wenscote und allen anderen, die in diesen letzten acht Jahren so gütig zu ihr gewesen waren, schuldig.
Abgesehen davon, gestand sie sich beschämt ein, lag es auch in ihrem eigenen Interesse, Wenscote nicht zu verlieren. Wenn Digby starb und sie bis dahin kein Kind hatte, würde sie das Gut verlassen müssen.
Ihren Zufluchtsort, den Ort, an dem sie Aufgaben und Pflichten hatte.
Digby war ein gerechter, jedoch kein risikofreudiger Gutsherr. Das Schafzuchtprojekt und der Anbau von Winterfutterpflanzen waren Rosamundes Werk gewesen. Sie hatte die landwirtschaftliche Produktion – die Käseherstellung, Spinnerei und Weberei – besser organisiert und dafür gesorgt, dass alle für ihre Erzeugnisse einen fairen Preis bekamen. Besonders die Pferdezucht, die sie ebenfalls aufgebaut hatte, lag ihr am Herzen.
Obwohl sie dies alles zu Beginn mehr oder weniger aus Langeweile getan hatte, war ihr die Arbeit inzwischen zum Lebenszweck geworden. Wenn sie Wenscote verlor, müsste sie all das aufgeben. In den meisten Kreisen wurde es ja sogar als unschicklich angesehen, wenn eine Frau sich mit Tierzucht befasste.
So sah es also aus. Jetzt war die Stunde der Wahrheit gekommen.
Nein, sie hatte nicht vor, sich zur Märtyrerin zu machen. Sie verfolgte eigennützige Ziele.
Wenn sie diese Sache durchzog, würden zwar viele andere Leute davon profitieren, doch in erster Linie ging es ihr um sich selbst.
Und wenn schon: Sie hatte Grund genug, aktiv zu werden, und wusste, was zu tun war.
Ein Zuchttier, dachte sie ganz nüchtern. Sie war es gewohnt, Schafböcke und Hengste zu beurteilen, und dieser hier war gesund und gut gebaut. Was wollte sie mehr? Wartete sie immer noch auf einen verwegenen Ritter auf einem weißen Ross?
Ein verwegener Ritter würde bestimmt jede Menge Turbulenzen verursachen. Ihr betrunkener Tunichtgut würde die Sache erledigen wie Samuel, ihr bester Bock, und sich anschließend ohne einen weiteren Gedanken dem nächsten Schaf zuwenden.
Mit einem betrübten Seufzer drehte sie sich auf den Rücken, um zu schlafen, doch die Gedanken ließen ihr keine Ruhe.
Sogar sie wusste, dass junge Männer nicht jede Frau besprangen, der sie begegneten. Das wäre ja noch schöner! Sie lachte in sich hinein, als sie sich vorstellte, wie sich auf einem Jahrmarkt – oder gar beim Sonntagsgottesdienst! – sämtliche Männer wie Samuel auf einem Feld voller paarungsbereiter Schafe verhielten.
Doch das war gar nicht witzig! Sie musste herausfinden, was zu tun war. Sollte sie sich aufreizend anziehen? Würde sie nackt sein müssen? Sollte sie ihn zuerst berühren? Ihn zuerst küssen?
Oh, sie wünschte so sehr, Diana wäre bei ihr! Obwohl ihre Cousine unverheiratet war, kam sie mit bedeutend mehr Männern zusammen und flirtete mit den meisten. Sie hatte sogar von Büchern gesprochen, in denen intime Dinge beschrieben wurden. Bestimmt könnte sie ihr sagen, wie man einen Mann verführte! Was auch immer nötig war, Rosamunde war dazu bereit.
Selbst wenn sie ins Haupthaus von Arradale hinübergehen musste, um wegen dieser geheimnisvollen Bücher die Bibliothek zu durchforsten!
Angst.
Immer noch lag er im Dunkeln, verfolgt von einer unbestimmten, aber bitteren Erinnerung an Feinde, die ihn bedrängten.
Stille.
Ein ekliger Geschmack im Mund.
Erbrochenes.
Heiliger Strohsack! Jetzt erinnerte er sich einer peinlichen Situation. Er hatte sich vor den Augen einer Frau übergeben!
War sie tatsächlich da gewesen?
Er streckte vorsichtig die Hand aus und stellte fest, dass er allein war.
Gott sei Dank. Er hatte nur geträumt.
Aber der Geschmack war immer noch da, und die Erinnerung an eine ruhige, angenehme Stimme war verflixt klar.
Er spürte einen Luftzug und drehte den Kopf zur Seite, der nicht mehr gar so heftig schmerzte. In der Dunkelheit bewegten sich Vorhänge, durch die jetzt etwas mehr Licht von draußen ins Zimmer fiel. Jemand hatte das Fenster zum Lüften geöffnet.
Also wer war sie? Und wo war er?
Eindeutig auf dem Land. Das verrieten ihm die würzige Luft und die Stille.
Die Frau hatte ihm den Namen des Ortes genannt, doch er war ihm wieder entfallen. Gill-irgendwas? Gillshaw?
Er brannte darauf, endlich Klarheit zu bekommen. Obwohl er in einem bequemen Bett lag und alles friedlich war, plagte ihn eine widersinnige Furcht vor Gefahren, die in den Schatten lauern könnten.
Passierte dies alles in Wirklichkeit?
Er wusste es nicht.
So wie er auch immer noch nicht wusste, wer er war. Das war doch absurd! Er quälte sich weiter, um seinem Gedächtnis seinen Namen zu entlocken.
Doch er rief nur traumähnliche Erinnerungen wach, die er jedoch begierig festhielt.
Ein herrlicher Sommertag, an dem er über einen Feldweg geritten war.
Wann?
Ein altes, mit Efeu bewachsenes Steinhaus. Wo?
Singende Vögel in den Bäumen. Ein blauer Mantel, der mit Farbe befleckt wurde, als er etwas frisch Gestrichenes streifte.
Hatte er sich darüber geärgert?
Eine gute, solide Kutsche, in der er saß – vertieft in Schriftstücke.
Er verweilte bei dieser Szene. Sie ließ auf einen arbeitsamen, pflichtbewussten Mann schließen – was ihm richtig vorkam – und nicht auf diesen Trunkenbold im Hurenbett …
Im Kerzenschein glänzende silberne Schalen auf einem reich gedeckten Tisch …
Er holte ein paarmal tief Luft, um nicht weiter zwanghaft zu versuchen, diese Fetzen zu einem Ganzen zu verbinden. Mit beunruhigender Sicherheit wusste er, dass sie nicht zusammengehörten.
Wer war er?
Wie lautete sein Name, verdammt noch mal?
Plötzlich hob sich der Schleier. So wie ein kleiner Lausbub nach Stunden endlich aus seinem Versteck hüpft und unschuldig fragt: „Hast du mich etwa gesucht?“, sprang ihm jetzt sein Name entgegen.
Brand Malloren.
Ihm fiel ein Stein vom Herzen.
Er war Brand Malloren. Während sich das Wissen in seinem Hirn verfestigte, kamen weitere Teilstücke hinzu. Er war Brand Malloren, der dritte Sohn des Marquis von Rothgar. Des alten Marquis. Inzwischen hatte sein ältester Bruder diesen Titel geerbt.
Das reichhaltige Dinner war sein letztes Mahl im Malloren House in London gewesen, bevor er nach Nordengland abgereist war.
Während die Fetzen sich zu einer zusammenhängenden Geschichte verwoben, griff er voller Verlangen nach jedem Detail, um mehr über sich selbst zu erfahren.
Er konnte den Speisesaal so deutlich vor sich sehen, als würde er darin sitzen. Silberne Schalen mit köstlichen Speisen, alles war in warmes Kerzenlicht getaucht; doch weil Sommer war, wurde der Raum auch von der Abendsonne beleuchtet. Sein ältester Bruder, der Marquis, saß am Kopfende des Tisches, links und rechts von ihm Cyn und seine Ehefrau Chastity, und Elf befand sich ihm gegenüber. Das war also die Elfe, die ihm zuvor in den Sinn gekommen war! Seine Schwester Elfled. Cyn, nicht ‚Sünde‘, Bryght, nicht ‚breit‘ — Arcenbryght, sein anderer Bruder.
Wie lange war das her? Hatte Bryghts Frau ihr Kind schon bekommen? War die Geburt glatt verlaufen? Sie war so zierlich …
Er versuchte verzweifelt, sich weitere Einzelheiten ins Gedächtnis zu rufen, doch alles, was sich zwischen jenem köstlichen Mahl und seinem Aufenthalt in diesem dunklen, rätselhaften Zimmer abgespielt hatte, war wie weggeblasen.
Dann entsann er sich, dass er während dieses Essens von einer Reise nach Nordengland gesprochen hatte.
War er jetzt im Norden? Er meinte, in der Stimme der Frau einen leicht nordenglischen Akzent wahrgenommen zu haben, obwohl sie wie eine Dame sprach. Folglich war er vermutlich in Yorkshire oder in Northumberland. Aber wo? Und wo war seine Pflegerin? Und was zum Teufel war mit ihm passiert?
Er wagte es, sich aufzusetzen, und stellte fest, dass seine Kopfschmerzen auf ein erträgliches Maß zurückgegangen waren. Während er versuchte, den dumpfen Schmerz weg zu massieren, quälte ihn noch immer die Vorstellung, sich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken zu haben.
Wenn es ihm schon nicht gelang, die grauenhafte Dunkelheit in seinem Hirn zu vertreiben, konnte er wenigstens die ihn umgebende Finsternis erhellen. Er ertastete einen Tisch und suchte mit seinen Fingern nach Kerze und Feuerzeug. Nichts. Als er den Arm weiter ausstreckte, stieß er gegen ein Glas, das zu Boden fiel und zerbrach.
Er fluchte und tastete den glatten Tisch nach etwas anderem ab; vielleicht fand er etwas, das er als Waffe benutzen konnte.
In diesem Moment ging quietschend die Tür auf, und im schwachen Flurlicht wurde eine blasse Gestalt sichtbar.
„Seid Ihr wach, Sir?“
Als er die sanfte, ihm vertraute Stimme vernahm, hätte er vor Erleichterung weinen können.
Woher kam diese schreckliche Panik? Was war mit ihm geschehen?
„Sir?“ Erst als sie auf ihn zukam, wurde ihm bewusst, dass er noch nicht geantwortet hatte.
„Ja, ich bin wach. Kommt nicht näher – rechts neben dem Bett liegen Glassplitter!“
Sie blieb stehen. Weil sie die Tür geschlossen hatte, war ihre Gestalt nur noch schemenhaft erkennbar. Mit unterdrücktem Stöhnen besann er sich auf das, was vorgefallen war.
Zuerst hatte er sich übergeben müssen. Und jetzt hatte er auch noch eine gefährliche Unordnung gemacht! Er sollte besser so schnell wie möglich von hier verschwinden und sich nie wieder blicken lassen.
„Ist Euch wieder übel?“, fragte sie. „Hier unten steht der Nachttopf!“
Er sann eine Weile über ihre Frage nach und war froh, sagen zu können: „Nein! Ich danke Euch aufrichtig für Eure Fürsorge.“
„Keine Ursache. Braucht Ihr irgendetwas?“
Ja – mein Hirn zurück. Das konnte er wohl kaum sagen. „Eine Kerze vielleicht?“
„Es ist mitten in der Nacht!“
Wie sollte er erklären, dass er urplötzlich Angst vor der Dunkelheit hatte? „Es tut mir leid, Euch solche Umstände zu machen.“ Er wünschte, er könnte sich an ihren Namen erinnern und daran, was sie einander bedeuteten. An irgendetwas.
Sie trat an die linke Seite des Betts. Während er zusah, wie sie den gespenstisch blassen Arm ausstreckte, um ihm die Hand auf die Stirn zu legen, fiel ihm ein, dass sie ihn zuvor schon einmal berührt hatte und wie angenehm das gewesen war.
„Es geht mir schon viel besser“, sagte er. Eine samtweiche Hand. Die Hand einer Lady; allerdings hatten auch viele Dirnen weiche Hände.
„Ihr habt eindeutig kein Fieber mehr.“
„Wo sagtet Ihr, bin ich hier?“
„In Gillsett.“
Gillsett. Um sich den Namen endlich einzuprägen, wiederholte er ihn im Stillen mehrmals. „Und wo ist Gillsett?“
„In Arkengarthdale.“
Eins der abgelegeneren Täler in Yorkshire. Hauptsächlich Schafzuchtland. Eigenartig, dass er die Lage des Tals kannte und wusste, wie das Land genutzt wurde, aber nicht, wo er vor Kurzem gewesen war und aus welchem Grund. Sonderbarerweise war er sich sicher, dass er nicht aus geschäftlichen Gründen in Arkengarthdale war.
Dann musste er die nahe liegende Frage stellen. „Und Ihr seid …?“
„Miss Gillsett.“
Er hatte mit Sicherheit nur geträumt, dass diese gesittete, beherrschte Lady in seinem Bett gelegen hatte. Miss Gillsett von Gillsett war zweifellos eine gütige und höchst tugendhafte Dame in einem abgeklärten Alter. Wenn er ihr erzählen würde, dass er sich eingebildet hatte, sie habe in seinem Bett gelegen, würde sie wahrscheinlich in Ohnmacht fallen.
„Ist Euch Euer Name wieder eingefallen, Sir?“, fragte sie.
Aus Verlegenheit und auch weil es ihm missfiel, wenn andere vor ihm katzbuckelten, hätte er ihr seinen Namen gerne verschwiegen. Aber er hatte keine Wahl. „Malloren.“ Als sie darauf nicht reagierte, entspannte er sich und fügte seinen Vornamen hinzu. „Brand Malloren.“
„Habt Ihr Familienangehörige oder Freunde, die sich um Euch Sorgen machen, Mr Malloren?“
Eigentlich war er Lord Brand Malloren, doch er hatte natürlich nichts dagegen, in dieser peinlichen Lage als einfacher Herr angesehen zu werden. Die Frage war jedoch bedenkenswert. Wenn seine Familienangehörigen wüssten, dass es ihm nicht gut ging, würden sie sich bestimmt Sorgen machen. Aber sie waren weit weg, und seine Dienerschaft hatte er in Thirsk zurückgelassen. Wenn er Glück hatte, würden weder seine Familie noch seine Bediensteten je von diesem Debakel erfahren.
„Nein. Ich bin allein und in geschäftlichen Angelegenheiten unterwegs.“
Als hätte sich der Schleier noch ein weiteres Stück gelüftet, fielen ihm plötzlich einige Gründe ein, weshalb er unterwegs war: Um die über ganz England verstreuten Güter seines Bruders aufzusuchen. Um die Geschäftsbücher und den Zustand der Ländereien zu überprüfen. Um mit konservativen Pächtern über mögliche Veränderungen zu diskutieren. Um Zuchtergebnisse und die Erträge von versuchsweise angebauten Feldfrüchten zu begutachten.
Ihm fiel auch wieder ein, dass er Routinesachen häufig seinen Bediensteten überließ, während er selbst ohne Vorwarnung verdächtige oder interessante Orte aufsuchte.
Er hatte das Gefühl, ganz nah am Kern der Sache zu sein, spürte es wie das schmerzhafte Zucken in einer noch frischen Narbe …
„Geschäftliche Angelegenheiten in den Dales, Mr Malloren?“, erkundigte sie sich, bevor er weitergrübeln konnte, um was es bei dieser Einzelheit ging und warum sie wichtig war.
„Verflucht!“, entfuhr es ihm, doch rasch verbiss er sich weitere wütende Worte. „Verzeiht – meine Nerven sind völlig am Ende. Ehrlich gesagt, liebe Lady, bin ich nicht bei klarem Verstand und weiß zu wenig über mich selbst, um mir einen Reim aus allem machen zu können. Was ist mit mir geschehen?“
„Ich weiß es nicht. Es wurde schon dunkel, als ich Euch bewusstlos am Straßenrand gefunden habe. Ihr wart meilenweit von der nächsten Ortschaft entfernt und völlig durchnässt.“
Das war ganz und gar nicht die Geschichte, die er selbst sich ausgemalt hatte. „Am Straßenrand … in Arkengarthdale?“ Er kannte die Gegend gut genug, um sie sich vorstellen zu können. Von Schafen beweidetes Heideland, das zu sumpfigem Hochmoor anstieg. Verstreute, triste Höfe und menschenleere Straßen. „Dann danke ich Euch aufrichtig, Miss Gillsett, dass Ihr mir das Leben gerettet habt. Und ich bitte umso mehr um Verzeihung, Euch solche Umstände zu machen.“
Rosamunde stand in der Dunkelheit und blickte auf die nur undeutlich sichtbare Gestalt. Diana sagte immer von ihr, dass sie ein zu wahrheitsliebender Mensch sei, und das stimmte.
Bei einer Lüge konnte sie zwar ein Weilchen mitspielen, doch dann quoll die Wahrheit aus ihr hervor wie überkochende Flüssigkeit.
So wie jetzt.
War es möglich, diese Sache wenigstens teilweise wahrheitsgetreu durchzuführen?
„Seid Ihr mir wirklich dankbar, Mr Malloren?“, hörte sie sich sagen. Ihre Hände waren krampfhaft ineinander verschränkt, und ihr Herz hämmerte.
„Bei meiner Ehre.“
Sie schluckte. „Könntet Ihr Euch vorstellen, mir dafür einen Dienst zu erweisen?“
Nach unmerklichem Zögern erwiderte er: „Wie könnte ich das ablehnen?“
„Es steht Euch frei“, versicherte sie ihm. „Ich möchte nicht, dass Ihr Euch verpflichtet fühlt, wenn es Euch unmöglich erscheint.“
„Warum sagt Ihr mir nicht einfach, was Ihr wollt?“
Von der Wahrheit übermannt hätte sie um ein Haar ausgerufen: „Ein Kind!“ Sie war jedoch vernünftig genug, um zu wissen, dass sie das nicht sagen durfte.
Was dann?
Diana hatte gesagt, manche Frauen wollten einen Mann nur für sich selbst. Für den Akt.
Aber wie sollte sie das ausdrücken?
„Ich will …“ Hinsichtlich dieses Vorgangs konnte sie nur an Schafe denken. „Ich will besprungen werden“, entfuhr es ihr, doch gleich darauf schlug sie sich entsetzt die Hand vor den Mund. „Verzeihung! Ihr würdet natürlich nicht …“
„Warum nicht?“, entgegnete er erstaunlich gelassen. „Ich muss Euch jedoch darauf hinweisen, dass es Folgen haben kann, besonders für eine unverheiratete Lady.“
Sie dachte kurz nach und sagte dann: „Ich bin nicht unverheiratet.“
„Ah. Also nicht Miss Gillsett.“
„Nein.“
„Witwe?“
„Nein.“ Diese Tatsache war ihr herausgesprudelt, bevor sie sie zurückhalten konnte.
„Also ein Ehemann, der Euch vernachlässigt.“
Sie zögerte. Digby war in fast jeder Hinsicht der liebste, gütigste Mann, den man sich vorstellen konnte, aber ihr war klar, worauf der Fremde anspielte.
„Ja“, murmelte sie, die Hand immer noch halb auf den Mund gepresst.
Dann wurde ihr bewusst, wie das auf ihn wirken musste, und sie spürte, wie ihre Wangen zu glühen anfingen. Sie musste ihm vorkommen wie eine Frau, die Heißhunger auf fleischliche Dinge hatte, eine Frau, die so lüstern war, dass sie einem am Straßengraben gefundenen Fremden ein eindeutiges Angebot machte!
Am liebsten wäre sie aus dem Zimmer gestürzt, doch dann sagte sie sich, dass es letztendlich ja stimmte. Nicht so, wie er es sich vorstellen musste, doch trotzdem stimmte es. Zudem war es egal, was er dachte. Wenn sie diese Sache hinter sich gebracht hätten, würden sie einander nie mehr wieder sehen.
Er schwieg und dachte wohl darüber nach, was genau sie erwartete.
„Also?“, fragte sie auffordernd und es klang ziemlich schroff.
„Jetzt? Du heiliger Bimbam, nein.“ Er murmelte etwas vor sich hin, das sie nicht verstand. Das war wohl auch besser so. Rosamunde war eine Träne aus dem Auge getreten, und sie bekämpfte den Drang, in Schluchzen auszubrechen. Sie machte sich noch völlig unmöglich!
„Ihr seid sehr nett zu mir gewesen“, sagte er, als wöge er jedes einzelne Wort ab. „Und ich bin gerne bereit, auch nett zu Euch zu sein, liebe Lady. Doch mein Kopf schmerzt noch höllisch, mein Hirn ist vollkommen benebelt und ich bin mir keineswegs sicher, ob ich mich nicht wieder übergeben muss, wenn ich mich bewege.“
Natürlich ging es ihm noch nicht gut genug. Rosamunde wäre am liebsten unters Bett gekrochen in der Hoffnung, dass sich dort ein Monster versteckte, das sie verschlingen würde.
Andererseits hätte sie es gerne möglichst schnell hinter sich gebracht, damit sie den Mann morgen wegschicken konnte und er für immer aus ihrem Leben verschwand.
Hier ging es jedoch nicht darum, was sie am liebsten tun würde, wie peinlich ihr alles war oder wie sehr ihr das Ganze widerstrebte. Sie musste es einfach hinter sich bringen und hoffen und beten, dass sie dabei ein Kind empfangen würde. Bevor sie zur Ehebrecherin werden konnte, galt es jedoch vorerst, Krankenpflegerin zu sein.
„Soll ich Euch ein Kopfschmerzmittel bringen?“, fragte sie so kühl wie möglich.
„Ich kann nicht garantieren, dass mein Magen das verträgt, aber ich bin bereit, es auszuprobieren.“
Er klang so gelassen. War er nicht zutiefst schockiert?
Sie war es.
„Ich bin gleich wieder zurück.“
Als sie draußen war, ließ Brand sich mit einem Seufzer, der nicht ausschließlich von den Schmerzen herrührte, auf das Kissen zurücksinken. Zum Teufel – doch er hätte wohl schlecht Nein sagen können, oder? Frustrierte Ehefrauen waren ihm des Öfteren begegnet, und wenn sie ihm außerhalb des Bettes gefielen, war er durchaus gewillt, ihnen im Bett Vergnügen zu bereiten. Aber in diesem Fall …
Er wusste nicht einmal, wie sie aussah. Das spielte zwar keine große Rolle, doch ihm war nicht ganz wohl dabei. Nun ja, bis er kräftig genug war, um sich ihrer anzunehmen, würde das Tageslicht dieses Problem lösen. Es sollte auch nichts ausmachen, dass er sie nicht kannte. Er konnte nicht gerade behaupten, dass er mit sämtlichen Frauen, mit denen er geschlafen hatte, gut bekannt gewesen war, und von dieser hier wusste er zumindest, dass sie ein gütiger Mensch war.
Mit reuevollem Lächeln gestand er sich ein, dass es im Grunde sein geschwächter Zustand war, der ihm Sorgen bereitete. Er war es nicht gewohnt, mit liebeshungrigen Frauen anzubandeln, wenn er nackt und krank und nicht Herr seiner Sinne war.
Er hörte sie wieder hereinkommen und beobachtete ihre schattenhafte Gestalt, die unsicher in dem dunklen Zimmer umhertappte. Sicher hatte sie in ihrem eigenen Zimmer Licht gehabt, und ihre Augen waren noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Warum hatte sie die Lampe nicht mitgebracht? Hatte sie etwas zu verbergen?
„Hier – bitte!“, hauchte sie.
Ihre Hände berührten sich am Glas, nach dem er griff, und sie zuckte zusammen. Dann hörte er, wie sie mit dem Löffel ein letztes Mal umrührte. „Es ist bitter, aber es hilft. Trinkt alles aus!“
Er gehorchte und schüttelte sich danach angewidert. „Pfui Teufel!“
„Glaubt Ihr, Ihr werdet das Mittel bei Euch behalten?“
Er legte sich zurück. „Das wird sich zeigen. Was war das für ein Zeug?“
„Zum größten Teil Weidenrinde.“
Nach einer Weile meinte er: „Ich glaube, der Nachttopf wird nicht nötig sein.“ Er wünschte, sie würde ihn allein lassen. „Ihr braucht nicht auf mich aufzupassen.“
Sie trat ein paar Schritte zurück. „Gut. Dann also bis morgen früh?“
Ein Stöhnen unterdrückend, sagte er: „Frühstück und eine Zahnbürste, liebe Lady – danach werde ich Euch zu Diensten sein.“
Sie ging, und er befürchtete, dass sein Ton zu grob gewesen war. Doch verflucht: Er wäre um ein Haar gestorben, sein Hirn war verhext und gerade hatte er etwas geschluckt, das wie tödliches Gift schmeckte!
Was glaubte sie, was er war: ein verdammter Liebesautomat?
Er nickte wieder ein. Im Schlaf erschien ihm eine garstige, dürre Alte, die an einem riesigen Schlüssel drehte, der sein Glied langsam hochsteigen und zu ziemlich beängstigenden Dimensionen anwachsen ließ.