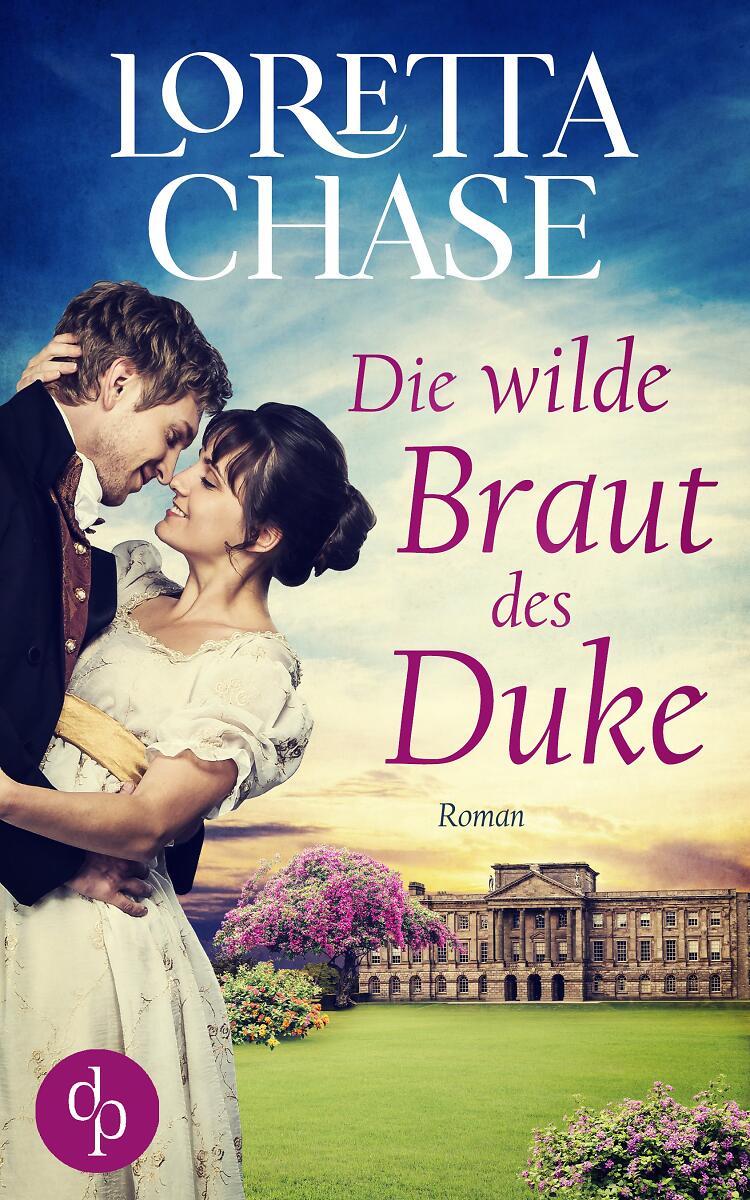Kapitel 1
Newland House, Kensington
Am späten Vormittag des 11. Juni 1833
Falls die Braut betrunken war – was natürlich nicht zutraf –, war es dem Feiern geschuldet.
Gar nicht mehr lange und Lady Olympia Hightower würde alle Träume ihrer Familie wahr werden lassen. Und die meisten ihrer eigenen auch. Sie würde Duchess of Ashmont werden. Am Rande der fatalen sechsundzwanzig, musste sie dem Schicksal danken, dass sie das Herz … die Bewunderung … irgendetwas … eines Mannes gewonnen hatte, der zu den drei berüchtigtsten Libertins Englands zählte, dem Trio der drei Dukes, die auch als Ihre Un-Gnaden bekannt waren.
Mit zusammengekniffenen Augen betrachtete sie den Spiegel. Hinter goldgerahmten Brillengläsern brauchten ihre Augen, die sich nicht so recht entscheiden konnten, ob sie grau, blau oder grün sein wollten, einen Moment, um die volle Pracht ihrer selbst … ihre Pracht … jedenfalls um sie wahrzunehmen.
Kunstvoll aufgedrehte Locken in einem gewöhnlichen Braunton umrahmten ihr herzförmiges Gesicht. Ihren Kopf zierte ein raffiniert geflochtenes Arrangement, gekrönt von einer großen Blume aus gerüschter und mit Orangenblüten verzierter Spitze. Ein Schleier aus französischer Klöppelspitze floss über ihre bloßen Schultern und die langen, spitzenbesetzten Ärmel bis über ihre Taille herab.
Sie sah an sich herunter.
Vier Knoten liefen abwärts zu dem V ihrer Taille. Darunter bauschten sich lange Röcke aus Seidenbrokat. Eine riesige Verschwendung des Geldes, das besser angelegt gewesen wäre, um Clarence nach Eton zu schicken oder eine Kommission bei der Armee für Andrew zu erwerben oder irgendetwas für einen der Jungen. Außer seinem Erben – Stephen, Lord Ludford – hatte der Earl of Gonerby fünf Söhne zu unterstützen, ein Thema, auf das er nie auch nur einen Gedanken verschwendet hatte. Im Gegensatz zu seiner Tochter war er nicht mit der Fähigkeit zu praktischem Denken gesegnet. Daher nun ihre derzeitige missliche Lage. Die gar nicht misslich war. Wie alle sagten. Absolut nichts war misslich daran, eine Duchess zu sein.
Jedenfalls hatte diese extravagante Hochzeitsaufmachung absolut nichts mit praktischem Denken zu tun. Das Geld musste für Olympia verschwendet werden, für ein einziges Kleid, denn laut Tante Lavinia war es eine Investition in die Zukunft. Eine zukünftige Duchess konnte bei ihrer Hochzeit nicht einfach irgendetwas tragen. Die Brautausstattung musste teuer und modisch, aber keinesfalls übertrieben aussehen, denn eine zukünftige Duchess musste auf teure, aber keinesfalls übertriebene Weise modisch sein. Nach der Hochzeit war das natürlich eine ganz andere Sache. Eine Duchess konnte den gesamten Inhalt ihrer Schmuckschatullen über sich ausleeren und hätte es noch lange nicht übertrieben.
Es benötigte nur wenige Änderungen, ein anderes Arrangement auf ihrem Kopf, ein paar mehr Diamanten oder Perlen oder beides, und Olympia würde das Kleid beim nächsten Salontheater tragen oder wenn ihre Mutter oder vielleicht Tante Lavinia, die Marchioness of Newland, die neue Duchess of Ashmont bei Hofe einführen und der Königin präsentieren würde.
Das war aber noch nicht alles, was nach der Hochzeit geschehen würde. Da war auch die Hochzeitsnacht, die, laut Mama, nicht unangenehm werden würde, auch wenn sie bezüglich der Details recht vage geblieben war. Aber der Hochzeitsnacht folgte die Ehe, Jahre und Jahrzehnte davon. Mit Ashmont. Die baldige Duchess of Ashmont nahm die Tasse mit dem Tee, der von Lady Newland gebracht und mit einem großzügigen Schuss Brandy versetzt worden war, um die Nerven der Braut zu beruhigen. Die Tasse war leer.
»Denk nicht einmal daran, davonzulaufen«, hatte ihre Tante gesagt, als sie den beschwipsten Tee gebracht hatte. Gewiss nicht. Zu spät dafür, selbst wenn Olympia ein Mädchen gewesen wäre, das vor irgendetwas zurückgescheut oder davongelaufen wäre, schon gar nicht vor der Chance ihres Lebens. Sie hatte sechs Brüder. Unter lauter Jungen war es nichts wert, das zweitgeborene Kind zu sein. Da hieß es herrschen oder beherrscht werden. Mancher sagte, sie war ein wenig zu beherrschend – für ein Mädchen.
Aber das würde keine Rolle mehr spielen, wenn sie erst Duchess war. Sie bückte sich und holte unter dem Frisiertisch das Fläschchen Brandy hervor, das sie Stephen gestohlen hatte. Sie entkorkte es, brachte es an die Lippen und nahm einen geschätzten Fingerhut voll. Sie verkorkte die Flasche wieder, stellte sie auf die Frisierkommode und sagte sich, dass sie im Begriff war, das Richtige zu tun.
Was war die Alternative? Den Bräutigam zu demütigen, der nichts getan hatte, jedenfalls ihr nicht, um eine solche Behandlung zu verdienen? Schande über ihre Familie zu bringen? Sich für immer gesellschaftlich zu ruinieren? All das weswegen? Wegen des unguten Gefühls in der Magengrube, das gewiss nichts weiter zu bedeuten hatte, als dass ihr vor der Hochzeit wie so vielen ein wenig die Nerven durchgingen?
Sie sagte sich, dass nur eine Verrückte davor weglaufen würde, die Braut eines der attraktivsten, reichsten und einflussreichsten Männer des Königreichs zu werden.
Ashmont hätte nämlich einflussreich sein können, wenn er gewollt hätte, aber er …
Sie verlor den Faden, weil jemand an die Tür klopfte.
»Also bitte!«, sagte sie. »Ich bete.«
Sie hatte sich Zeit allein ausgebeten. Sie müsse sich sammeln und sich auf diese enorme Veränderung in ihrem Leben vorbereiten, hatte sie ihrer Mutter und ihrer Tante gesagt. Sie hatten einander vielsagend angesehen und waren gegangen. Kurz darauf war Tante Lavinia mit dem hochprozentigen Tee zurückgekommen.
»Zehn Minuten, Liebes«, hörte sie die Stimme ihrer Mutter aus dem Flur.
Waren die zehn Minuten bereits vorüber?
Olympia entkorkte erneut das Fläschchen und nahm einen weiteren Schluck.
Fast sechsundzwanzig, ermahnte sie sich. Nie wieder würde sie eine solche Chance bekommen, niemals wieder. Es war überhaupt ein Wunder, dass sie sie bekommen hatte. Und sie hatte gewusst, was sie tat, als sie Ja gesagt hatte.
Nun gut, Lucius Wilmot Beckingham, der sechste Duke of Ashmont, war vielleicht ein ziemlicher Blödian und so unreif, dass sich der neunjährige Clarence im Vergleich zu ihm wie König Salomo ausnahm. Und ja, selbstredend würden Seine Gnaden nicht treu sein. Aber Ashmont sah gut aus, und er konnte ein Mädchen mit seinem Charme um den Verstand bringen, wenn er es darauf anlegte, und er hatte es definitiv darauf angelegt, sie zu bezirzen. Er schien sie zu mögen. Und es war nicht so, als lauerten irgendwelche unangenehmen Überraschungen auf sie. Sein Charakter war jedem, der die Klatschspalten der einschlägigen Journale las, nur allzu bekannt.
Entscheidend war, dass er ihr einen Antrag gemacht hatte. Und sie verzweifelt war.
»Eine Duchess«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild. »Du kannst praktisch die Welt verändern, oder zumindest einen Teil davon. Näher kann eine Frau dem Mannsein nicht kommen, außer sie wird Königin – und keine bloße Gemahlin, sondern Königin von eigener Statur. Und auch dann … Ach, nicht weiter wichtig. Es wird dir nicht passieren, mein Mädchen.«
Irgendwo in Olympias Kopf oder vielleicht ihrem Herzen oder ihrem Magen sagte eine schnippische kleine Stimme, die genauso klang wie ihre Cousine Edwina: »Die Liebe des Lebens wird dir genauso wenig passieren. Es wird kein Traumprinz auf dem weißen Ross für dich kommen. Nicht einmal ein leidenschaftlicher Lord. Oder auch nur ein Kaufmannsgehilfe.«
Sie erstickte die Stimme, wie sie sich manches Mal gewünscht hatte, Cousine Edwina ersticken zu können.
Die Olympia, die sich Fantasien von Prinzen und leidenschaftlichen Gentlemen hingegeben hatte, war eine naive Kreatur gewesen, die den Kopf voller aus Romanen gespeister romantischer Vorstellungen hatte, als sie sich in ihre erste Londoner Saison gestürzt hatte.
Sieben Jahre lang war sie zum langweiligsten Mädchen der Saison gekürt worden. In sieben Jahren hatte sie nicht einen Antrag erhalten. Das heißt, sie hatte keinen Antrag erhalten, den eine junge Dame, die noch bei rechtem Verstand war – wie verzweifelt sie auch sein mochte – je angenommen hätte oder, wie im Falle eines recht betagten Verehrers, hätte annehmen dürfen.
Was also hätte sie sagen sollen, als Ashmont sie fragte? Sie hätte Nein sagen und einer Zukunft als alte Jungfer entgegensehen können, in der sie auf Brüder angewiesen war, die kaum den eigenen Unterhalt und den ihrer Familien bestreiten konnten. Oder sie konnte Ja sagen und gleich eine ganze Reihe Probleme mit einem Schlag lösen. So einfach war das. Man musste es nicht unnötig verkomplizieren. Sie nahm noch einen Schluck Brandy. Und noch einen. Dann ertönte ein weiteres, etwas ungeduldigeres Klopfen.
»Es ist das Richtige und ich werde es tun«, flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu. »Irgendjemand muss es schließlich tun.«
Sie nahm noch einen Schluck.
»Was zur Hölle treibt sie so lange?«, fragte Ashmont.
Die Gäste tuschelten geschäftig. Bei jedem Geräusch, das von außerhalb des Salons zu ihnen drang, wandten sich Köpfe der Tür zu, durch welche die Braut kommen sollte. Bisher war keine Braut erschienen. Sie musste nun schon eine gute halbe Stunde verspätet sein. Ripley war hinausgegangen, um die Brautmutter zu fragen, ob Lady Olympia möglicherweise unpässlich sei. Lady Gonerby hatte irritiert ausgesehen und nur den Kopf geschüttelt. Ihre Schwester, Lady Newland, hatte eine Erklärung abgegeben.
»Irgendwas mit dem Kleid«, sagte Ripley. »Die Tante ist mit einem Dienstmädchen und einem Nähkästchen nach oben verschwunden.«
»Ein Nähkästchen!«
»Ich nehme an, es hat sich irgendetwas gelöst.«
»Was zum Teufel interessiert mich das?«, sagte Ashmont. »Ich werde es ohnehin später lösen.«
»Du weißt doch, wie Frauen sind«, entgegnete Ripley.
»Es sieht Olympia nicht ähnlich, sich über Nichtigkeiten aufzuregen.«
»Ein Brautkleid ist keine Nichtigkeit«, konterte Ripley. »Ich muss es wissen. Das meiner Schwester hat mehr gekostet als das Stutfohlen, das ich aus Pershore geholt habe.«
Seine Schwester war nicht anwesend. Laut Blackwood war Alice nach Camberley Place aufgebrochen, eines von Ripleys Anwesen, um sich um ihre liebste Tante zu kümmern.
»Das ist langweilig«, sagte Ashmont. »Ich hasse diese verfluchten Rituale.«
Lord Gonerby verließ den Salon. Er kehrte einen Augenblick später zurück und erklärte gut gelaunt: »Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Es ist wohl irgendein Saum oder Volant, der nicht will, wie er soll. Ich werde Champagner bringen lassen. Es gibt keinen Grund, dass wir dürsten sollten, während fleißige Nadeln am Werke sind.«
Einen Augenblick später erschienen der Butler und zwei Diener, die Tabletts mit Gläsern hereintrugen.
Ashmont trank eines, dann noch eines und noch eines in schneller Folge. Ripley trank auch, aber nicht so viel. Das lag zum Teil daran, dass er sich noch nicht ganz vom gestrigen Abend erholt hatte.
Anscheinend wurde er alt, denn er hätte nach der ausgedehnten Spiel- und Zechtour und der anschließenden Prügelei auf der Straße, gefolgt von der nur allzu bekannten Anstrengung, Ashmont aus einem Handgemenge herauszuhalten und ins Bett zu verfrachten, gut noch ein Stündchen Schlaf gebrauchen können. Der andere Grund für seine Abstinenz war die Aufgabe, die er übernommen hatte. Am gestrigen Abend bei Crockford’s hatte Ashmont ihn gebeten – oder vielmehr verlangt –, dass einer seiner zwei Freunde die heutige Zeremonie lenken sollte.
»Einer von euch muss dafür sorgen, dass ich pünktlich und mit dem Ring dort erscheine«, hatte er gesagt. »Und mit den Papieren und so weiter. Jeder glaubt, ich werde es vermasseln. Aber das werde ich nicht.«
»Ich habe schon eine Hochzeit hinter mich gebracht«, hatte Blackwood gemeint. »Meine eigene. Ich würde dieses Mal gern einfach nur zusehen. Frei von jeder Verantwortung.«
Nachdem er so die Aufgabe Ripley zugeschoben hatte, hatte Blackwood gelächelt und sie aufgescheucht, indem er vorgeschlagen hatte, dass sie beide nach Hause fahren sollten, um etwas Schlaf zu bekommen.
Wenn er mehr über Ashmonts dringenden Wunsch wusste, an die Kette gelegt zu werden, hatte Blackwood es nicht erwähnt. Nicht, dass er Zeit gehabt hätte, viel zu sagen. Das Reden war gestern vor allem Ashmont zugefallen, und was er erzählt hatte, hatte Ripley zur Verzweiflung gebracht.
Erstens war Ashmont auf ehrbare Weise zu seiner Verlobten gekommen, also in der üblichen Art des Werbens und indem er um ihre Hand angehalten hatte. Mit anderen Worten, die Braut war nicht schwanger. Außerdem hatte Ashmont, was ebenso erstaunlich war, ein attraktives, begehrenswertes und geistig gesundes Mädchen dazu gebracht, seinen Antrag anzunehmen.
Ripley hätte viel Geld darauf verwettet, dass es in England nicht ein Mädchen aus gutem Hause gab, das verzweifelt genug war, Ashmont zu nehmen – beziehungsweise dessen Familie dem zugestimmt hätte, wenn schon sein Aussehen und Charme vermocht hatten, den Verstand der Auserwählten zu vernebeln. Wie er in seinen sporadischen Briefen geprahlt hatte, hatten die Patronessen des Almack’s ihn von ihren Bällen ausgeschlossen, der König hatte Seine Gnaden wissen lassen, er sei bei den Morgenempfängen Seiner Majestät unerwünscht, und die Mehrheit aller Gastgeberinnen in London hatten ihn von ihren Gästelisten gestrichen. Für einen gut aussehenden, zahlungskräftigen Duke war so etwas schon eine reife Leistung.
Allerdings hatten sich, so schien es, Ashmonts und Lady Olympias Pfade vor einigen Wochen in der Nähe des Clarendon Hotels gekreuzt. Ein übellauniger Hund, der offenbar gleich ein Missfallen an Seiner Gnaden gefunden hatte, hatte versucht, ihm den Stiefel zu zerfetzen. Ashmont, der wie gewöhnlich schon gut dabei gewesen war, war beim Versuch, den Hund abzuschütteln, auf die Straße gestolpert, direkt in den Weg eines offenen Hackneys, der wie üblich mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs gewesen war.
»Aber dann war da der Griff eines Regenschirms«, hatte er Ripley erzählt. »Er hakte sich um meinen Arm und zog mich zurück. Und schon stolperte ich zurück auf den Gehweg und mühte mich, mein Gleichgewicht wiederzufinden. Der Hund kläffte unterdessen wie verrückt. Und sie sagte ›Psst‹ oder so etwas und stieß die Spitze des Regenschirms mit einem lauten Klack auf den Gehsteig. Und denk dir, der Hund hörte auf zu bellen und trollte sich!«
Ashmont hatte bei der Erinnerung daran gelacht.
»Und sie fragte: ›Ist Ihnen etwas passiert, Duke?‹ Und ihre Zofe murmelte irgendetwas, zweifelsohne, um die Lady von mir loszureißen. Ich dachte, es wäre alles in Ordnung, aber Olympia sah an mir herunter und ließ mich wissen, mein Stiefel sei arg zerfetzt. Ich sah selbst hin und stellte fest, dass sie recht hatte. Sie sagte, ich könne so nicht in London herumlaufen – es könnte wer weiß was in den Stiefel und an meinen Fuß gelangen, meinte sie. Und dann sagte sie ausgerechnet: ›Meine Kutsche wird jeden Moment hier sein. Ich werde Sie nach Hause fahren.‹ Was sie dann auch tat, auch wenn es ihrer Zofe überhaupt nicht gefallen wollte. Auch dem Kutscher und dem Diener gefiel es nicht, aber sie konnten nichts machen. Lady Olympia Hightower! Kannst du es fassen? Ich konnte es nicht. Wie oft haben wir sie bei dieser oder jener Gesellschaft gesehen?«
Zahllose Male, dachte Ripley. Ein recht hochgewachsenes Mädchen mit Brille, aber durchaus nicht unansehnlich. Eine gute Figur. Nein, eher eine sehr gute. Aber sie war ein wohlerzogenes Mädchen aus sehr angesehenem Hause und stand in dem Ruf, enorm belesen zu sein. Sie hätte genauso gut ein Etikett mit der Aufschrift Gift mit Totenkopf und gekreuzten Knochen auf ihrem entzückenden Busen tragen können.
»Sie war so liebenswürdig«, hatte Ashmont gesagt. »Gar nicht auf diese gekünstelte, sentimentale Art wie manche Mädchen, sondern sehr nüchtern und ruhig, eher wie ein Kerl. Und ich muss sagen, ich war ungemein von ihr eingenommen. Und dass Onkel Fred mir später an den Kopf warf, ich sei ihrer weder würdig noch ihr intellektuell gewachsen und andere Miesmachereien, half nichts. ›Das muss doch wohl sie entscheiden, nicht wahr?‹, entgegnete ich ihm. Und dann machte ich mich daran, um sie zu werben. Ich kann dir sagen, es war ein harter Kampf. Aber schließlich hat sie Ja gesagt, nicht? Und wie war Lord Fred überrascht, als ich es ihm verkündete! Er klopfte mir sogar auf die Schulter und sagte: ›Na, dann hattest du wohl doch das Zeug dazu.‹«
Ashmont war hocherfreut, es seinem manipulativen Onkel endlich einmal gezeigt zu haben. Allerdings glaubte Ripley vielmehr, dass Lord Frederick Beckingham eine Gelegenheit gewittert und sie am Schopfe gepackt hatte. Ashmont zu sagen, dass er etwas nicht haben oder tun könnte, war der sicherste Weg, ihn dazu zu bewegen, es zu tun.
Nicht, dass es am Ende noch eine Rolle gespielt hätte, solange Ashmont zufrieden war und es dem Mädchen klar war, worauf sie sich einließ. Und wenn sie so intelligent war, wie man annahm, sollte sie sich dessen durchaus bewusst sein. Das Problem war, dass die Hochzeit nicht ganz so glatt lief, wie sie sollte, Ashmont langweilte die Warterei, und ein gelangweilter Ashmont war ein gefährliches Objekt.
Ripley warf seinem Schwager einen Seitenblick zu. Blackwood – ebenfalls dunkel wie Ripley, aber weit polierter und gefälliger – hob fragend eine schwarze Augenbraue. Ripley zuckte mit den Schultern.
Blackwood schlenderte gelassen zu ihnen herüber.
»Ich weiß nicht, was an einem Saum so kompliziert sein soll«, meinte Ashmont. »Der ist unten, nicht wahr? Also.«
»Und wenn sie darüber stolpert und aufs Gesicht fällt …«
»Dann fang ich sie auf«, konterte Ashmont.
Ripley sah Blackwood an.
Sie beide sahen Ashmont an. Er war zweifelsohne in Fahrt. Er konnte gerade noch aufrecht stehen. Wenn die Braut nicht bald kam, würde eines von zwei Dingen geschehen: Im besten Falle würde sich der Bräutigam in den Vollrausch trinken und unelegant zu Boden gehen. Im schlimmsten Falle würde er eine Schlägerei provozieren.
»‘s reicht!«, rief Ashmont. »Jetzt hol ich se.«
Er machte Anstalten, zur Tür zu laufen, und stolperte. Blackwood bekam ihn an der Schulter zu fassen. »Gute Idee«, sagte er. »Es nützt ja nichts, hier herumzustehen.«
Er fing Ripleys Blick auf. Ripley nahm die andere Seite, und sie führten den Freund aus dem Salon. Da sich die Gäste um die Tabletts mit dem Champagner scharten, trafen sie im Flur nur Dienstboten an.
»Wohin?«, fragte Blackwood.
»Runter«, sagte Ripley.
»Nicht runter«, sagte Ashmont. »Sie’s oben. Da.« Er deutete vage die Richtung an, indem sein Finger fahrige Kringel in die Luft zeichnete.
»Pech«, entgegnete Ripley. »Es bringt Pech, die Braut vor der Hochzeit zu sehen.«
»Hab ja auch erwartet, se bei der Hochzeit zu seh’n«, lallte Ashmont.
Sie führten ihn zur Treppe und dann, mit einiger Mühe, die Stufen hinab.
»Hier entlang«, sagte Ripley.
Er war bereits in Newland House gewesen, aber das war Jahre her. Er war nicht sicher, wie das Erdgeschoss aussah. In einem alten Haus dieser Art hätte er ein Frühstückszimmer oder Speisezimmer erwartet und, höchstwahrscheinlich, eine Bibliothek. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte, welches Zimmer. Sie mussten Ashmont vom Alkohol fernhalten und von allen, mit denen er beschließen könnte, einen Streit vom Zaun zu brechen, also mehr oder weniger allen Anwesenden.
Blackwood und er führten ihren Freund zu einer Tür, die sich in sicherem Abstand zur Haupttreppe befand. Ripley öffnete sie. Das Erste, was er sah, war Weiß, Meilen davon, als ob eine Wolke in den Raum gekrochen wäre, bei dem es sich, wie er sich vage erinnerte, um eine Bibliothek handelte. Allerdings trugen Wolken keine weißen Satinslipper und bestickten Strümpfe und standen auch nicht auf Bibliotheksleitern.
»Ups«, sagte Blackwood.
»Verflucht, Olympia!«, rief Ashmont. »Was zum Teufel treibst du?«
Er versuchte, sich von seinen Freunden loszureißen.
Ripley sagte: »Wir müssen ihn hier rausschaffen.«
»Den Teufel werdet ihr, verdammt«, protestierte Ashmont. »Muss mit ihr sprechen. Darf das nich’ vermasseln.«
In seinem augenblicklichen Zustand würde er aber genau das tun.
Ripley warf Blackwood ihren berühmten ›Und was jetzt?‹-Blick zu.
»Pech«, wandte sich Blackwood an Ashmont. »Es bringt Pech, die Braut vor der Hochzeit zu sehen.«
Während er den protestierenden Ashmont zurück in den Flur zerrte, rief er Ripley über die Schulter zu: »Er hat dir die Verantwortung für die Hochzeitsfeier übertragen. Also tu etwas!«
»Den Ring«, entgegnete Ripley. »Die Papiere. Geld bereithalten, falls benötigt. Das waren meine Aufgaben, nicht die Braut.«
»Tu etwas«, wiederholte Blackwood.
Noch einmal öffnete Ripley die Tür.
Die Bibliotheksleiter war leer. Ein Geräusch zog seinen Blick auf das Fenster. Er sah einen Wirbel aus Weiß. Ashmonts Zukünftige mühte sich mit dem Fensterriegel ab. Mit wenigen Schritten hatte Ripley den Raum durchquert.
»Witzige Sache«, sagte er. »Sollten Sie nicht bei einer Hochzeit sein?«
»Ich weiß«, sagte sie. »Sie könnten der strahlenden Braut auch helfen. Der Riegel klemmt.«
Er nahm einen Hauch Brandy wahr, der sich mit einem blumigen Duft vermischte.
Auch wenn sein Verstand im Augenblick nicht auf der Höhe war, konnte er die Situation ganz einfach zusammenfassen: betrunkene Braut am Fenster mit dem Ziel, hinauszuklettern. Das war ein Problem.
»Warum?«, fragte er.
»Woher soll ich wissen, warum er klemmt?«, entgegnete sie. »Finden Sie, dass ich wie ein Klempner aussehe? Oder wie auch immer man das nennt. Glaser.« Sie nickte. »Fensterheini.«
»Da ich kein Fensterheini bin, könnte es sein, dass ich nicht qualifiziert bin, Ihnen in dieser Sache zu helfen«, sagte er.
»Dann wachsen Sie über sich hinaus«, konterte sie. »Ich bin die Jungfer in Not. Und Sie –«
Sie wandte den Kopf, um ihn anzusehen. Sie starrte den Knoten seiner Halsbinde an, der sich in etwa auf ihrer Augenhöhe befand. Dann kniff sie die Augen zusammen und ließ den Blick höher wandern. Die grauen Augen hinter ihren Brillengläsern waren rot umrändert. Sie hatte geweint. Mit Sicherheit hatte Ashmont etwas gesagt oder getan, das sie aufgewühlt hatte. Das wäre nichts Neues. Seine Zunge war oft schneller als sein Verstand. Ehrlich gesagt war keiner der drei Dukes mit besonders viel Taktgefühl gesegnet.
»Gottverdammt«, sagte sie. »Sie! Sie sind zurück.«
»Ah, das haben Sie also bemerkt.« Er fühlte eine eigenartige Zufriedenheit. Aber Champagner hatte für gewöhnlich diese Wirkung, auch in kleinen Dosen.
»Sie sind über 1,80 m groß«, sagte sie und legte den Kopf in den Nacken. »Sie stehen genau vor mir. Ich bin vielleicht kurzsichtig, aber nicht blind. Selbst ohne meine Brille könnte ich wohl kaum verfehlen, Sie zu erkennen, auch aus einer etwas entfernteren … Entfernung. Von der ich wünschte, dass Sie sich befänden. Dort befänden.« Sie machte eine scheuchende Handbewegung. »Gehen Sie weg. Ich möchte nur etwas Luft schnappen. In … äh … Kensington Gardens.«
»In Ihrem Brautkleid«, sagte er.
»Ich kann es wohl schlecht ausziehen und wieder anziehen, als wäre es ein Mantel.« Sie sprach in dem besonders geduldigen Tonfall, den man üblicherweise einem Kleinkind von geringer Auffassungsgabe entgegenbrachte. »Es ist kompliziert.«
»Es regnet«, sagte er in einem ebenso geduldigen Ton.
Sie wandte den Kopf und spähte aus dem Fenster. Regentropfen zeichneten Schlangenlinien auf die Scheibe.
Mit einer überzeichneten Geste tat sie seinen Einwand ab. »Halb so wild – wenn Sie wegen jeder Kleinigkeit so ein Gewese machen.«
Sie wandte sich wieder dem Riegel zu und setzte ihre Versuche fort, ihn loszurütteln. Dieses Mal gab er nach.
Sie drückte das Fenster auf. »Adieu«, sagte sie und kletterte in einer Wolke aus Satin und Spitze hinaus.
Ripley stand noch einen Moment da und versuchte, zu einem Entschluss zu kommen.
Sie wollte gehen, und es schien ihm unsportliches Verhalten, eine Frau gegen ihren Willen festzuhalten.
Er konnte zurückgehen und Ashmont sagen, dass seine Braut dabei war, zu türmen.
Er konnte zurückgehen und es einem der männlichen Mitglieder ihrer Familie sagen.
Sie war nicht Ripleys Problem.
Sie war Ashmonts Problem.
Nun gut, Ashmont hatte Ripley die Verantwortung für die Hochzeitsfeier übertragen. Und gut, Ashmont sorgte sich anscheinend in ungewöhnlichem Maße darum, dass er es nicht vermasselte. Ja, und es stimmte, dass Ripley versprochen hatte, sich um alles zu kümmern: den Ring aufbewahren, das nötige Kleingeld bereithalten, dafür sorgen, dass Ashmont tat, was gefordert war.
Die Braut zurückzuholen, war sicherlich nicht Teil der Abmachung.
Sie zurückzuholen, sollte überhaupt nicht erst nötig sein.
Nur weil sie betrunken gewesen war und geweint hatte …
»Verdammt!«, fluchte er und kletterte aus dem Fenster.
Ripley konnte gerade noch einen Blick auf die Wolke aus weißer Spitze und Satin erhaschen, bevor sie in einem Wall aus hohen Büschen und Bäumen verschwand. Er beschleunigte seine Schritte, wobei er immer wieder zu den Fenstern des Hauses aufsah. Niemand, der hinaussah. Die Hochzeitsgesellschaft hatte sich auf der anderen Seite des Hauses versammelt. Das war auch gut so. Wenn er sie schnell zurückbrachte, konnten sie die Dinge in Ordnung bringen, ohne dass irgendjemand davon Wind bekam.
Er blickte sich um, konnte aber keine Gärtner entdecken. Die Bediensteten waren vermutlich dabei, mit ihren Kollegen zu zechen, oder hatten sich vor dem Regen geflüchtet.
Ripley war sich des Regens bewusst, aber nur als etwas, das sich im Hintergrund abspielte. Obwohl er das Geprassel auf Blättern, Gras und Wegen hören konnte, konzentrierte er sich auf die Braut, die sich recht zügig fortbewegte, wenn man den kilometerlangen Satin- und Spitzenstoff, die sich bauschenden Ärmel und all das bedachte.
Er rief ihr nicht nach, denn sie lief noch nicht vor ihm davon, jedenfalls nicht offensichtlich, und er wollte sie nicht verschrecken und dazu bringen, loszurennen oder möglicherweise etwas noch Absurderes zu tun, auch wenn er sich im Augenblick nicht vorstellen konnte, was das sein sollte.
Für athletische Unternehmungen war sie nicht gekleidet – nicht, dass Frauen das überhaupt jemals gewesen wären – und das Gelände glich einer Art Hindernisparcours. Die Gärten um Newland House waren alt und dicht bepflanzt. Einige der Bäume hier hatten ihre Äste schon über Königin Anne ausgebreitet. Auf dem rutschigen Boden, so aufgetakelt und mehr als nur ein wenig beschwipst, lief die Braut nur allzu schnell Gefahr, sich im Gebüsch zu verfangen oder über ihre Röcke oder die eigenen Füße zu stolpern. Jedenfalls holte er stetig auf.
Er war nahe genug herangekommen, um zu sehen, wie ihre Füße unter ihr wegglitten, ihre Arme wie Windmühlenflügel in der Luft ruderten und sie um Gleichgewicht rang. Er war nur einen Augenblick zu spät, um sie aufzufangen, bevor sie den Kampf verlor und zu Boden ging. Er griff ihr beherzt unter die Arme und zog sie hoch. Sie wand sich hierhin und dorthin. Durch tausende Schichten Kleid und Unterröcke spürte er, wie ihr Hinterteil seine Lendengegend berührte, was ihn für einen Moment aus der Fassung brachte.
Er war schließlich ein Mann. Ein prächtiger Hintern, war sein erster Gedanke. Vergiss es, mahnte er sich selbst. Erledige deine Pflicht und bring sie zurück.
»Verzeihung«, sagte er. »Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Wollten Sie lieber, dass ich Sie im Dreck liegen lasse?«
»Sie ruinieren meine Ärmel!«
Der Regen prasselte auf seinen Kopf.
Sein Hut war noch im Haus und ohne fühlte er sich nackt. Nackter, als wenn er tatsächlich nackt gewesen wäre.
Und nass obendrein.
Er ließ sie los. »Sie haben das Kleid längst ruiniert«, sagte er. »Schlammspritzer und Grasflecken auf der ganzen Rückseite. Es sieht aus, als ob Sie sich mit einem Verehrer im Gebüsch gewälzt hätten. Nun, darüber werden gewiss alle hocherfreut sein. Auf jeden Fall wird Ashmont es sein. Und da ich das einzige männliche Wesen in Ihrer Nähe war, bin ich wohl derjenige, den er herausfordern wird. Anschließend kann ich dann seine Duellverletzungen versorgen. Wieder einmal.«
»Schlagen Sie ihm ins Gesicht«, schlug sie vor. »Er wird zurückschlagen. Dann kann er Sie nicht herausfordern, weil er nicht der Geschädigte ist.«
Der lange Schleier klebte triefend an ihrem Kopf und den Schultern. Die Schläfenlocken lösten sich in Wohlgefallen auf und der Kopfschmuck hatte Schlagseite erhalten.
Ihr Gesicht zuckte, und er dachte, sie würde gleich in Tränen ausbrechen, aber sie biss den Kiefer zusammen und reckte das Kinn vor.
»Sie können jetzt gehen«, sagte sie. »Mit mir ist alles in bester Ordnung. Ich brauche nur einen Moment, um … äh … eingedenk dieses feierlichen Anlasses, der mein Leben für immer und zum Guten verändern wird, ein … ähm … Gebet zu sprechen. Also … au revoir.«
Er warf einen Blick zurück zum Haus.
Was hatte Ashmont getan? Wie schlimm oder wie dumm war es gewesen? War es besser, sie einfach gehen zu lassen, wohin auch immer sie vorhatte davonzulaufen?
Nein, das war nicht Teil der Abmachung. Es war nicht Ripleys Aufgabe, sich den Kopf zu zerbrechen. Seine Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass die Hochzeit seines Freundes reibungslos über die Bühne ging. Das bedeutete, dass er die Braut zurückholen musste.
Ripley wandte sich ihr gerade noch rechtzeitig wieder zu, um zu sehen, wie sie davonlief und auf einen Pfad einbog, der zwischen einer Anpflanzung dichter Rhododendren verlief. Sofort hatten diese sie verschluckt bis auf den einen oder anderen weißen Fleck, der sich hier oder da zeigte. Sie hatte nur darauf gewartet, dass er ihr den Rücken zuwandte – beziehungsweise den Kopf abgewandt hatte – und war getürmt.
Das war … ein kühner Schachzug von ihr.
Dennoch konnte man sie jetzt nicht einfach fröhlich davonlaufen lassen.
Wenn sie Ashmont nicht wollte, musste sie das mit ihm von Angesicht zu Angesicht ausfechten.
Wenn sie Zeit gehabt hatten, etwas auszunüchtern, jedenfalls. Ripley nahm die Verfolgung auf.
Wenngleich sich die Hochzeitsgesellschaft auf der Westseite des Hauses um die Champagnertabletts versammelt hatte, hatte sich Lord Ludford, der älteste Bruder der Braut, auf die Suche nach seiner Schwester gemacht.
Newland House war zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts erbaut und seither stetig erweitert und modernisiert worden. Das Gebäude erstreckte sich über einen großen Teil des zugehörigen Grunds wie ein außer Kontrolle geratener Kaninchenbau. Die Familien standen sich nahe, schließlich waren Ihre Ladyschaften Schwestern. Ihre zahlreichen Nachkommen hatten sich jeweils frei im Haushalt der anderen bewegt, und jeder fühlte sich hier so zu Hause wie zu Hause.
Da Ashmont es mit der Hochzeit eilig hatte und Gonerby House derzeit mitten in Renovierungsarbeiten steckte, hatten sich Ihre Ladyschaften geeinigt, die Hochzeitsfeier hier abzuhalten.
Ludford hatte den Verdacht, dass sie fürchteten, Ashmont könnte es sich anders überlegen, wenn er zu lange wartete. Ludford selbst hätte das sogar vorgezogen. Er hielt Ashmont für Olympias nicht würdig. Wenn sie weggelaufen war, konnte ihr Ludford keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, es erschien ihm ein weiser Entschluss zu sein. Allerdings trotz allem besorgniserregend. Mädchen von gutem Ruf wie Olympia konnten nicht einfach so allein davonlaufen. Unaussprechliche Dinge konnten ihnen zustoßen.
Er hoffte, dass sie sich irgendwo im Haus versteckt hielt.
Olympia, die oft Wochen am Stück hier mit ihren Cousinen verbracht hatte, hatte eine Reihe geheimer Rückzugsorte, die sie aufsuchte, um den einen oder anderen uralten Wälzer zu studieren oder Buchkataloge auswendig zu lernen.
Er nahm an, dass sie das heute getan hatte, auch wenn er nicht wusste, wieso. Wie sein Vater war Ludford kein besonders großer Denker. Als er bemerkt hatte, dass sein Fläschchen verschwunden war, hatte er sofort seine jüngeren Brüder im Verdacht gehabt. Meist genügte es, wenn man sie ordentlich durchschüttelte, bis die Zähne klapperten, um sie geständig zu machen. In diesem Falle jedoch hatten sie aufrichtig ahnungslos gewirkt. Der kleine Clarence schien etwas zu wissen oder einen Verdacht zu haben, aber was es auch war, er wollte damit nicht herausrücken, und er war so stur wie Olympia.
Ludford suchte also Clarence in der Kinderstube auf, in die er verbannt worden war, nachdem allzu wilde Spiele zu zerbrochenen Champagnergläsern geführt hatten. Andrew, sein Komplize, war von ihm getrennt worden und schmachtete im Schulzimmer.
Ludford riss die Tür zur Kinderstube auf.
»Du weißt etwas, du Bengel!«, rief er. »Also spuck es aus, sonst werde ich –«
Er hielt inne, denn Clarence, der gerade noch aus dem Fenster gesehen hatte, hatte sich blitzschnell umgedreht, und sein Gesicht leuchtete verräterisch rot.
Es war nur verständlich, dass er erschrak, wenn Ludford so überraschend hereinplatzte. Das war Sinn und Zweck der Übung, aber Clarence war vom Fenster gewichen, als ob es plötzlich in Flammen aufgegangen wäre, und rief: »Nein, tu ich nicht! Tu ich nicht! Aus mir kriegst du nichts raus!«
Ludford stürmte zum Fenster, gerade noch rechtzeitig, um etwas Weißes ins Gebüsch huschen zu sehen, gefolgt vom Duke of Ripley, der darauf zuhielt, vielleicht nicht im Laufschritt, aber jedenfalls auch nicht in seinem gewöhnlichen lässigen Schlendergang.
Ludford stürzte aus der Kinderstube.
In einer mondbeschienenen Nacht hätte Ripley es genossen, einer lustigen Witwe durch verschlungene Gartenpfade nachzujagen, wobei die hohen Büsche die Jagd erst richtig spannend machten. Aber dies war keine mondbeschienene Nacht, und Lady Olympia Hightower war keine lustige Witwe.
Vor ihm blitzte immer wieder Weiß durch das Geäst und entfernte sich stetig und mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Als er in einen weiteren Pfad abbog, hatte er das aufblitzende Weiß vollständig verloren. Dann hörte er durch den prasselnden Regen ein leises, metallisches Klappern. Er lief weiter, und das dichte Gebüsch öffnete sich zu einer kleinen Lichtung, die zu einem schmiedeeisernen Tor in einer hohen Mauer führte. Ein Tor, das zu öffnen sie sich gerade mühte. Einige schlammig schmatzende Schritte später hatte er sie eingeholt.
Sie hielt in ihren Bemühungen kurz inne und sah ihn über die Schulter an.
»Oh!«, rief sie. »Sie sind es.« Sie keuchte vor Anstrengung, und ihr Busen hob und senkte sich. »Das verdammte Ding ist abgeschlossen.«
»Natürlich ist es abgeschlossen«, entgegnete er. »Oder soll das gemeine Volk hier durchtrampeln und die Rhododendren wildern?«
»Ich pfeife auf die Rhododendren! Wie soll man hier rauskommen?«
»Vielleicht soll man gar nicht?«, schlug er vor.
Sie schüttelte den Kopf. »Wir müssen einen anderen Ausweg finden.«
»Wir?«, fragte er. »Nein. Sie und ich sind kein Wir.«
Sie versteifte sich plötzlich, und ihre Augen weiteten sich.
Er hörte es auch.
Stimmen, die ungefähr von dort kamen, wo sie entlanggelaufen waren.
»Vergessen Sie es«, rief sie. »Es ist zu spät. Sie müssen mir über die Mauer helfen.«
»Nein«, sagte er. »Kann ich nicht tun.«
»Doch, können Sie«, entgegnete sie. »Sie sind hier, und was haben Sie sonst zu tun? Machen Sie sich zur Abwechslung mal nützlich und helfen Sie mir über die Mauer. Jetzt wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt.« Sie stampfte mit dem Fuß auf. »Sofort!«
Ihre Coiffure hatte sich zum Teil gelöst, und einige nasse braune Haarsträhnen klebten in ihrem Gesicht. Das Ding, das auf ihrem Kopf gesessen hatte, hing nun mehr an der Seite, und verirrte Rhododendronblätter und vertrocknete Blüten hatten sich zwischen den Orangenblüten verfangen. Ihr Schleier hatte sich um ihren Hals geringelt wie eine Schlange. Die Spitze ihrer schmalen Nase zierte ein Schmutzfleck.
»Über die Mauer«, wiederholte er, um Zeit zu schinden.
»Ja, genau. Ich kann in diesem Kleid nicht richtig am Efeu hochklettern – schon gar nicht in diesen Schuhen. Beeilen Sie sich! Hören Sie sie nicht?«
Er versuchte, eine Verzögerungstaktik zu ersinnen, aber sein Verstand arbeitete nur langsam. Dann hörte er ein wildes Durcheinander von Rufen, die Assoziationen mit kläffenden Hunden und einem wütenden Mob in ihm weckten.
In diesem Moment veränderte sich etwas in ihm.
Seit seiner Zeit in Eton waren Ripley und seine zwei Spießgesellen dem Zugriff der Autorität entflohen, wütenden Bauern, Geistlichen, Händlern und überhaupt allen möglichen ehrbaren Leuten, nicht zu vergessen Zuhältern, Beutelschneidern, Betrügern und anderen nicht ganz so ehrbaren.
»Beeilen Sie sich!«, rief sie.
Er verschränkte seine Hände ineinander und bückte sich. Sie setzte einen Fuß im schlammigen Seidenslipper in seine Hand, stemmte eine schmutzige Hand gegen die Wand, um das Gleichgewicht zu halten, und drückte sich hoch. Dann kletterte sie mit einer Leichtigkeit, die ihn erstaunt hätte, wäre er zu weiterem Erstaunen zu diesem Zeitpunkt noch fähig gewesen, auf seine Schultern und streckte sich nach der Mauerkrone aus.
Jedenfalls nahm er an, dass sie das tat. Denn er konnte nichts sehen als ein bestrumpftes Bein mit Strumpfband, ein äußerst reizvoller, wenn auch kurzer Anblick. Dann hüllten weißer Satin und Unterröcke und der Duft einer Frau seinen Kopf ein. Er behielt gerade noch die Geistesgegenwart, ihre Knöchel zu fassen, um ihr Halt zu geben.
»Hoch!«, rief sie. »Es ist immer noch zu hoch für mich, um dranzukommen. Hoch, hoch! Schnell!«
Die Stimmen näherten sich.
Er packte ihre Füße und schob sie über seinen Kopf aufwärts. Er spürte, wie ihr Gewicht verschwand, als sie offenbar einen Halt an der Mauerkrone gefunden hatte. Er sah die Rückseite ihrer Beine, als sie sich mühsam auf die Mauerkrone hochzog und eine sitzende Haltung einnahm. Einen Augenblick später verschwand sie aus seinem Blickfeld.
Die Stimmen waren nun sehr nah.
Er hatte eben nicht nachgedacht, und er dachte auch jetzt nicht nach. Als sie über die Mauer verschwunden war, ergriff er eine Efeuranke, zog sich daran hoch und kletterte selbst hinüber.
Er sah nach rechts, dann nach links.
Eine Wolke aus weißem Satin und Spitze bewegte sich rasch die Horton Street entlang.
Er rannte ihr nach.
Kapitel 2
Ripley holte die Braut auf der Kensington High Street ein. Sie war langsamer geworden, blieb aber nicht stehen.
»Hackney«, keuchte sie und nickte in Richtung des Droschkenstands vor ihnen. »Haben Sie Geld bei sich?«
»Erst soll ich Ihnen nur über die Mauer helfen«, sagte er. »Und jetzt wollen Sie Geld.«
»Tja, und doch sind Sie hier«, konterte sie. »Immer noch. Schon wieder.«
»Ja. Weil –«
»Ich«, sagte sie, wobei sie jede Silbe in die Länge zog. »Brauche. Geld. Für. Die. Droschke.«
Sie winkte eines der Fahrzeuge heran und rief: »Hierher!«
Der Kutscher des ersten Hackney Cabs in der Reihe betrachtete sie interessiert, machte aber keine Anstalten, sich in Bewegung zu setzen. Warum sollte er auch? Sie sah aus, als sei sie aus Bedlam entsprungen.
Nicht, dass Ripley nicht auch exzentrisch genug ausgesehen hätte, ohne Hut, Handschuhe oder Gehstock.
Allerdings war er ein Duke und einer der berüchtigtsten Adligen Englands, und es war ein Leichtes, ihn zu erkennen.
Darüber hinaus hatte sie recht, er war nun einmal hier. Ashmont sollte hier sein, aber das war er nicht, und jemand musste schließlich auf sie aufpassen. Man ließ keine junge Dame aus gutem Hause allein herumlaufen, besonders dann nicht, wenn diese junge Dame zu einem seiner dümmsten Freunde gehörte, der nicht vermochte, sie zu halten.
Es war ja schön und gut, wild und rücksichtslos zu sein und sich nicht die Bohne um die bessere Gesellschaft zu kümmern, aber wenn ein Kerl ein Mädchen bat, seine Frau zu werden, sollte er ihr absolut keinen Anlass geben, nicht bei den Hochzeitsfeierlichkeiten zu erscheinen.
Es war nichts als Fahrlässigkeit, ja, zum Teufel, das war es. Aber Ashmonts Problem war, dass er verwöhnt war. Er hatte es nie nötig gehabt, sich für Frauen besonders ins Zeug zu legen.
Höchste Zeit, dass er damit anfing.
Ripley fasste sie an der Schulter. »Halt! Lassen Sie uns doch erst einmal nachdenken.«
»Ich denke nach«, entgegnete sie. »Und zwar darüber, wo der verfluchte Hackney Coach bleibt. Warum kommt er nicht?«
»Denken wir doch einmal darüber nach, wie Sie aussehen«, meinte er. »Sie wissen schon. Hochzeitskleid. Schleier und all das. Könnte eventuell einen merkwürdigen Eindruck machen, finden Sie nicht?«
»Das ist mir gleich«, sagte sie.
»Was Sie nicht sagen«, konterte er. »Aber vielleicht sollten wir versuchen, ruhiger und weniger geistig verwirrt zu wirken.«
»Ich bin nicht geistig verwirrt.« Sie ballte die Hände zu Fäusten. »Ich bin vollkommen ruhig.«
»Gut. Ausgezeichnet. Lassen Sie uns das Schritt für Schritt durchgehen. Wohin sollen wir Ihrer Meinung nach fahren?«
Sie machte eine ausladende Geste. »Fort.«
Sie nickte, und das undefinierbare Gebilde aus aufgetürmten Haaren, Spitze und anderem Firlefanz hing nun noch schiefer an der Seite ihres Kopfes.
»Das ist doch immerhin schon mal ein Anfang«, meinte er trocken.
Er würde einfach das Denken für sie beide übernehmen müssen, eine entmutigende Aussicht. Er übernahm das Denken ja nicht einmal gern für sich selbst.
Er hob die Hand und winkte.
Der erste Hackney Coach scherte aus der Reihe aus und rumpelte auf sie zu, während sie ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trippelte.
Nachdem das Gefährt neben ihnen angehalten hatte, zog Ripley die Tür auf.
Als sie den Fuß auf die Stufe setzte, geriet sie aus dem Gleichgewicht und schwankte bedrohlich nach hinten.
Er gab ihr einen kleinen Schubs vorwärts, und sie plumpste in das Stroh auf dem Boden der Droschke. Er sah ihr dabei zu, wie sie sich hochhievte – den Hintern für einen fesselnden Moment in die Luft gestreckt – und in den Sitz fallen ließ. Sie strich ihre Röcke glatt, rückte die Brille zurecht und funkelte ihn an.
Aus irgendeinem Grund besserte sich seine Laune.
»Wohin, Euer Ehren?«, fragte der Fahrer.
»Euer Gnaden«, verbesserte sie. »Haben Sie nicht bemerkt, dass seine Arroganz das übliche herrschaftliche Maß übertrifft? Ist es nicht offensichtlich, dass er ein Duke ist?«
Ripleys Stimmung besserte sich noch ein wenig mehr.
Wenn der Kutscher sie gehört hatte, ließ er es sich nicht anmerken.
»Battersea Bridge«, sagte Ripley. Er kletterte in die Droschke.
Die Brücke lag ein gutes Stück südlich. Das würde ihm Zeit verschaffen. Zeit, um zu entscheiden, was er tun wollte. Aber sie war nicht so weit entfernt, dass es ihn davon abgehalten hätte, sie nach angemessener Zeit doch noch zurückzubringen, wenn er sich dazu entschließen sollte. Der Vorteil war, dass Battersea Bridge nicht unbedingt der erste Ort war, an dem seine Freunde ihn suchen würden.
»Oder hatten Sie ein bestimmtes ›Fort‹ im Sinn?«, fragte er süffisant.
»Schweigen Sie«, sagte sie. »Ich denke.«
Die Kutsche rumpelte los.
»Seltsam«, meinte Ripley. »Unsere Konversationen waren zwar kurz, aber soweit ich es beurteilen kann, leben Denken und Sie in unterschiedlichen Ländern. Die sich im Krieg miteinander befinden.«
Sie schüttelte den Kopf und winkte mit dem Zeigefinger, wie Betrunkene es gern tun.
»Das wird mich nicht zum Schweigen bringen«, sagte er. »Wenn Sie schon denken müssen, dann sollten Sie vielleicht so freundlich sein und darüber nachdenken, zu erklären.«
»Was zu erklären?«
Er deutete auf ihr schmutziges Brautkleid und das schmutzige Interieur der Kutsche. »Das hier. Ihre Flucht. Denn ich bin noch immer ziemlich durcheinander und absolut nicht sicher, ob das hier die beste Idee ist. Ich überlege noch, ob ich den Kutscher anweisen soll, uns zurückzubringen.«
»Nein«, sagte sie.
»Aber Sie können nachvollziehen, wie verlockend die Vorstellung ist«, wandte er ein.
»Nein«, beharrte sie.
»Die Sache ist die«, erklärte er. »Ich hatte einen ziemlich anstrengenden Morgen, wissen Sie?«
»Sie!«
»Ja. Es läuft nicht so wie vorgesehen.«
»Willkommen im Club«, sagte sie.
»Sehen Sie, ich hatte nicht erwartet, dass ich im Schneckentempo mit einem maroden Hackney Coach zur Battersea Bridge fahren würde«, meinte er. »Oder überhaupt zu irgendeiner Brücke. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht meine Aufgabe war, einer betrunkenen Braut, die im letzten Augenblick kalte Füße bekommt und vor ihrer Hochzeit davonläuft, zur Flucht zu verhelfen.«
»Ich bin nicht betrunken«, widersprach sie. »Und Sie sind nicht der Einzige, der einen anstrengenden Morgen hatte. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, steht es Ihnen frei, die Droschke anzuhalten und auszusteigen.«
»Es steht mir mitnichten frei«, erwiderte er. »Ich bin der … der Dings. Der Sondergesandte des Bräutigams. Oder sein Wärter. Von mir aus bin ich auch die Brautjungfer. Was ich damit sagen will, ist, dass er mich beauftragt hat, und vielleicht muss er eben damit leben, dass ich es vermasseln könnte. Was ich allerdings sicher weiß, ist, dass man Sie nicht einfach allein umherziehen lassen kann. Wenn man das könnte, hätte ich zurückgehen und meinen Hut holen sollen. Oder auch nicht. Ich hätte einfach zurückgehen und Sie jemand anderem überlassen können. Aber das konnte ich nicht, wegen meines Auftrags, wie ich bereits erklärt habe. Es hat keinen Zweck, den Ring und die Heiratserlaubnis und das Geld und all das Zeug mitzubringen, wenn die Braut wer weiß wohin verschwunden ist.«
Ihr Blick hob sich ihm entgegen. »Ihr Haar ist nass.«
Er blieb ungerührt, nasses Haar hin oder her. Er war alkoholbedingte Gedankensprünge gewohnt. »Alles ist nass«, stellte er fest.
»Ja«, sagte sie.
»Keine Sorge«, entgegnete er. »Ich bin nicht aus Zucker.«
»Darum mache ich mir gewiss keine Sorgen«, erwiderte sie. »Die Sache ist die …« Sie schloss für einen Moment die Augen, aber einem Gedankengang bis zum Ende zu folgen, schien zu viel für sie zu sein, denn sie öffnete sie gleich wieder und sagte: »Wenn Sie mich bei der Brücke absetzen –«
»Ein anderer Mann, der sich auf eine friedliche Hochzeitszeremonie, guten Champagner und ein anständiges Hochzeitsfrühstück gefreut hatte – die Newlands haben einen ausgezeichneten Koch, müssen Sie wissen –«, sagte er.
Sie betrachtete ihn mit versteinerter Miene.
»Der Kerl jedenfalls«, fuhr er fort, »der die Mahlzeit verpasst hat, auf die er sich gefreut hatte, und der vielleicht ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen hat – der Kerl könnte versucht sein, Sie bei der Brücke rauszuwerfen. Und zwar direkt in den Fluss. Ich hingegen –«
»Ja, ja, Sie sind die Brautjunger.«
»Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich nur selten Frauen ertränke.«
»Ich werde ein Boot nehmen«, proklamierte sie in einem Ton, den man eher für ein Gebot oder ein Todesurteil reserviert hätte. »Zu Tante Delia. Nach Twickenham.«
Er blinzelte. »Erstaunlich. Sie haben einen Plan.«
»Richtig. Es bedurfte nur der geistigen Anregung durch Ihre anregende Gesellschaft.«
»Besteht eine Chance, dass ich Sie dazu anregen kann, mir zu verraten, wovor genau Sie eigentlich davonlaufen?«, fragte er. »Oder noch besser, besteht eine Chance, dass Sie Ihre Meinung ändern und wie ein braves Mädchen umdrehen? Besteht die Chance, dass Sie irgendetwas tun, was man als, na ja, Sie wissen schon, als ansatzweise vernünftig bezeichnen könnte?«
»Die Würfel sind gefallen«, verkündete sie in ihrem Gebots- beziehungsweise Todesurteil-Tonfall. »Also seien Sie so gut und helfen Sie mir, diese Monstrosität von meinem Kopf zu entfernen.«
Da er nicht annähernd betrunken genug war – genau genommen schien er inzwischen stocknüchtern zu sein –, brauchte er einen Moment, um ihre Bitte, nein, ihren Befehl zu verarbeiten.
»Ihre Haare?«, fragte er. »Sind die nicht dauerhaft befestigt?«
»Sieht dieses architektonische Meisterwerk für Sie aus wie dauerhaft befestigt? Es rutscht herunter und zieht mir dabei die Haare aus, die ich in der Tat auch besitze. Es ist höchst unangenehm und passt überhaupt nicht zu mir. Aus einem Rennpferd macht man keinen Ackergaul. Ich hab es ihnen gesagt, aber es h-hat ja keiner auf mich hören wollen.«
»Ich denke, Sie meinten, aus einem Ackergaul macht man kein -«
Sie brach in Tränen aus.
Oh.
Tränen versetzten manche Männer in Panik.
Nicht so Ripley.
Wäre diese weinende Frau seine Schwester gewesen, hätte er sie sich an seiner Schulter ausheulen lassen, auch wenn sie dabei seinen Frack und seine Halsbinde ruiniert und Rouge auf seinem Einstecktuch hinterlassen hätte. Dann hätte er ihr Geld gegeben und gesagt, sie solle sich etwas kaufen. Wäre sie seine Geliebte gewesen, hätte er ihr ein Rubin- oder Diamantcollier versprochen, je nach Tränenvolumen und -geschwindigkeit.
Diese weinende Frau war allerdings nicht wie seine Schwester oder seine Geliebte, nicht einmal wie seine Mutter. Diese hier gehörte zu einer völlig anderen Spezies. Unter anderem war sie Ashmonts Verlobte. Und eine solche hatte Ashmont bisher nie gehabt. Das war eine brandneue Form von Weinende-Frau-Problem, und Ripley brauchte einen Augenblick, um über sein weiteres Vorgehen nachzudenken.
Der forsche Ansatz, entschied er.
»Reißen Sie sich zusammen«, sagte er. »Sie hatten die Courage, über die Mauer zu klettern. Sie tun ja so, als seien Sie nie zuvor weggelaufen. Das ist doch nicht das Ende der Welt.«
»Doch, das ist es«, schluchzte sie. »Ich habe alles ruiniert. Clarence wird niemals nach Eton gehen, Andrew wird keine Kommission in der Armee erhalten, und ich kann einfach für niemanden etwas Gutes tun, und ich werde nicht einmal eine Bibliothek haben!«
Ripley verstand absolut nicht, wovon sie sprach, und sah auch keinen Sinn darin, seinen Verstand damit zu belasten, dass er es versuchte. Wie oft sagten Frauen schon etwas, das Sinn ergab? Warum sollte das also jetzt ausgerechnet der Fall sein?
Seine Stimme nahm denselben bestärkenden Tonfall an, mit dem man vor einem Pferderennen dem Jockey Mut zusprach. »Die Würfel sind nicht gefallen. Sie können noch zurückkehren. Ashmont ist so betrunken, er wird alles glauben, was wir ihm erzählen. Und morgen wird er sich an nichts als vage Umrisse erinnern. Ich werde ihm weismachen, Sie hätten sich aus Versehen betrunken und –«
»Ich bin nicht b-betrunken.«
»Glauben Sie mir, ich kenne mich mit diesem Zustand aus«, entgegnete er. »Sie sind mehr als nur beschwipst. Sie konnten nicht einmal die Stufe an der Kutsche meistern. Also, wir erzählen ihm Folgendes: Wir sagen, Sie hätten aus Versehen Brandy getrunken, weil sie ihn für … hm … wofür zum Geier könnte man Brandy halten?«
»T-Tee«, schluchzte sie. »Der Brandy war im Tee. Zum-mindest am An-Anfang.«
»Am Anfang«, wiederholte er.
Sie nickte. Dann fischte sie aus ihrem ausladenden Ärmel ein zierliches, elegantes Stück Spitzenstoff, nahm die Brille ab und wischte sich mit dem Spitzenfetzen über Augen und Nase. Sie setzte die Brille wieder auf und gab dem Nasenteil noch einen kleinen Schubs mit dem Finger, um sie zurechtzurücken.
»Aber ich habe ihn getrunken. Und der Rest war aus Stephens Fläschchen.« Sie zerknüllte das angebliche Taschentuch in ihrer Hand. »Ich habe es gestern entwendet. Nachdem Mama mir das mit der Hochzeitsnacht erklärt hat. Also, das heißt, sie hat es mehr oder weniger erklärt. Einige Aspekte der Angelegenheit sind mir noch immer völlig unklar. Aber ich dachte, der Brandy könnte meine Entschlossenheit festigen. Um dem Unausweichlichen zu begegnen.«
»Sie hätte ihre Sache besser machen können«, meinte Ripley, »wenn sie Sie darauf hingewiesen hätte, dass es sich um Ashmont handelt, also nicht um irgendeinen unerfahrenen Volltrottel.«
»Genau, er ist ein erfahrener Volltrottel«, erwiderte sie.
»Wie dem auch sei, das ist nichts, wovor Sie sich fürchten müssten«, sagte er. »Leute tun es ständig. Und selten mit tödlichen Folgen.«
»Die Folge sind Babys«, sagte sie finster. »Ich hätte selbst recherchieren sollen, anstatt mich auf Mama zu verlassen. Ich weiß nicht, ob sie die Verbindung begreift. Also, zwischen dem ehelichen Vollzug und Babys. Sie hatte zu viele davon. Wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich nach dreien aufgehört. Oder nach drei Knaben. Das ist doch eine gute, sichere Anzahl, nicht?«
Er hielt es jedenfalls nicht für eine gute, sichere Idee, sich geistig weiter mit dem ehelichen Vollzug zu beschäftigen. Es war ungewöhnlich lange her, dass er eine Frau gehabt hatte, und gegenwärtig war er auch nicht in der Lage, das zu ändern. Seine Gedanken allerdings ließen sich von dem kleinen Gehirn südlich seines Nabels nur allzu gern dazu verführen, sich auszumalen, wie man dieser Unterlassung möglichst bald entgegenwirken könnte.
Er zwang sich dazu, sich auf das zu konzentrieren, was sie sagte. Zum Glück hatte sie inzwischen das Thema gewechselt.
»Ich konnte es nicht fassen, dass er mich gefragt hat«, sagte sie gerade. »Ich meine, es war kaum anzunehmen, dass er verzweifelt war. Sie wären erstaunt, wie viele Mädchen die Schwächen eines Mannes zu übersehen bereit sind, weil er ein Duke ist. Oder nein, wahrscheinlich wären Sie es nicht.«
Es gab eine Menge solcher Mädchen, aber sie hätten niemals eine passende Duchess für Ashmont abgegeben. Bei all seinen Unzulänglichkeiten hatte er doch seinen Stolz – sogar mehr, als gut für ihn war. Sogar sturzbetrunken hätte er kein Mädchen geheiratet, das nicht attraktiv, aus gutem Hause und im Vollbesitz ihrer geistigen und sonstigen Kräfte gewesen wäre. Er hätte keine genommen, die albern, langweilig oder zänkisch gewesen wäre. Kurz gesagt hätte er Perfektion verlangt. Ob er sie verdiente, war eine andere Sache.
»Ich habe mir gesagt, dass man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen sollte«, erklärte sie.
»Was für ein geschenkter Gaul?«, fragte Ripley. »Er hat Gefallen an Ihnen gefunden. Ist das nicht genug?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es ist mir absolut unbegreiflich.«
Sie musste extrem kurzsichtig sein. Hätte sie nicht das Giftetikett getragen, hätte Ripley schon vor Ewigkeiten versucht, bei ihr zu landen. »Es ist mehr als begreiflich«, erwiderte er. »Wenn Sie ein Mann wären, würden Sie es verstehen. Denn es ist –«
»Und dann bin ich heute in die Bibliothek gegangen, um mich in der Sache schlauzumachen –«
»Sie haben bis zu Ihrem Hochzeitstag damit gewartet?«, fragte er. »Nein, nicht nur bis zum Hochzeitstag, sondern bis zu dem Augenblick, in dem Sie eigentlich hätten ›Ja, ich will!‹ sagen sollen.« Sie hatte den Augenblick abgewartet, in dem sie vollends betrunken gewesen war, ein Zustand, den sie ganz offensichtlich nicht gewohnt war.
»Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken, aber es ließ mich nicht los«, erklärte sie. »Haben Sie schon mal versucht, nicht an etwas zu denken?«
»Das muss ich meistens gar nicht erst versuchen.«
»Sie können es einfach ignorieren?«
»Ja.«
»Ein Segen, ein Duke zu sein«, stellte sie fest.
»Ist es«, bestätigte er.
Es war viel, viel besser, als nur der Sohn eines Dukes zu sein, wenn man nach seiner Erfahrung und der seiner Freunde urteilen wollte. Er war sich nicht ganz sicher, ob ihre Väter die drei schlechtesten Väter im gesamten britischen Adel gewesen waren, aber sie hatten sich jedenfalls definitiv ins Zeug gelegt, diesen Titel zu verdienen.
»Ich kann das nicht«, meinte sie. »Das ist, als ob man versucht, eine Mücke zu verscheuchen, die einem um den Kopf schwirrt. Und Dinge, die man nicht versteht, sind die hartnäckigsten Mücken von allen. Ich konnte allerdings nichts finden außer einem Buch über Viehzucht, und das war der Moment, in dem ich schließlich eins und eins zusammenzählte. Oder zwei und zwei und zwei und eins. Sieben Geschwister und nur ein Mädchen. Und wer auch immer ihn dazu überredet oder mit irgendeinem Trick dazu gebracht hat, zu heiraten, muss zu ihm gesagt haben: ›Nimm doch Gonerbys Mädchen. Man kann kaum besseres Zuchtmaterial finden. Ausgezeichnete Chancen auf einen Erben und ein paar als Ersatz für den Fall der Fälle.‹«
»Da ich Ashmont kenne, finde ich diese Theorie höchst unwahrscheinlich.« Fortpflanzung würde es natürlich geben, denn das war nun einmal das häufige Resultat davon, dass man mit jemandem ins Bett ging, außer man war extrem vorsichtig. »Sie trauen ihm mehr Überlegtheit zu, als er jemals in dieser Sache an den Tag gelegt hätte. Sie haben seine Aufmerksamkeit erregt, weil Sie einmal liebenswürdig zu ihm waren, soweit ich es verstanden habe.«
»Liebenswürdig!«, rief sie. »Ich hätte doch nicht zulassen können, dass er von einer Droschke überfahren wird.«
»Sie haben blitzschnell entschieden und ein gewisses Maß an Beschlagenheit bewiesen.«
»Ich habe sechs Brüder! Die sind ständig irgendwo hinein- oder herausgefallen. Ich handelte instinktiv.«
»Er fand es liebenswürdig, insbesondere dass Sie ihn nach Hause gefahren haben. Im Verlauf der Kutschfahrt hat er Sie, so scheint es, einmal intensiv betrachtet, und Sie haben ihm gefallen. Und da Sie ein Mädchen aus gutem Hause sind, führte der Weg nur über eine Hochzeit.« Und dieses Mädchen aus gutem Hause versprach Ashmont ein aufregenderes Leben, als er erwartet hätte.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß, es muss noch etwas anderes gewesen sein. Ich bin nicht die Art Frau, wegen der Männer den Verstand verlieren.«
Höchstwahrscheinlich war es noch etwas anderes. Ashmont hätte den Vorfall bestimmt vergessen, wären nicht Onkel Freds hinterhältige Methoden gewesen. Ripley würde sie in dieser Hinsicht allerdings nicht erhellen. Er hätte ihr Hinweise geben können, wie man mit Ashmont fertigwurde … aber nein. Sie war ein intelligentes Mädchen. Sie würde das schon bald selbst herausfinden.
»O doch, Sie würden staunen«, sagte er.
»Ich bin eine Frau, die man aus praktischen Erwägungen heiratet«, beharrte sie. »Um einen schwierigen Haushalt zu führen, Verantwortung zu übernehmen. Um Erben und Ersatzerben zu produzieren. Wenn alle Stricke reißen.«
»Das denkt Ashmont ganz und gar nicht.«
Sie sah aus dem Fenster. »Aber w-wissen Sie …« Abermals flossen Tränen über ihre Wangen. »Wir hatten auch Schicksalsschläge, denn wir sollten neun sein, und das war sehr schwer für Mama und Papa. Ich hatte gewiss meine Zweifel daran, wie tröstlich Ashmont in solch einer Lage wäre. Und ich weiß, was die Person, die ihn überredet hat, noch gesagt hat. Sie wird gesagt haben: ›Bei der müssen Sie keine Angst haben, ein Kuckuckskind untergejubelt zu bekommen. Da besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass niemand s-sie je b-berührt hat.‹«
Noch mehr Schluchzen.
Ripley klopfte mit dem Zeigefinger auf seinem Knie herum. Das Schluchzen hielt an.
Diese Situation war nicht wirklich angenehm.
»Wie ich sehe, haben wir die rührselige Phase erreicht«, stellte er fest.
»Ja. Das müssten Sie doch wissen.« Sie wischte wieder mit dem nutzlosen Stück Spitzenstoff über ihr Gesicht. »Nicht, dass es mich interessieren würde, wie Sie es nennen, und ich habe von Ihnen kein Mitgefühl erwartet, nicht einmal Verständnis.«
»Ich tue mein Bestes«, entgegnete er. »Aber mein Verstand, wissen Sie?«
»Ja, ich weiß«, sagte sie. »So wie seiner, mehr oder weniger – wobei weniger schwer vorstellbar ist. Wie dem auch sei, ich dachte, dass ich bereit wäre, dieses Opfer zu bringen, auch wenn mir bewusst ist, dass die meisten Leute es für unerhört erachten würden, dass ich es als Opfer bezeichne, eine Duchess zu werden.«
»Dann gehöre ich wohl zu diesen Leuten«, bemerkte er.
»Es ist mir egal, was Sie sagen«, erwiderte sie.
»Ich bin am Boden zerstört«, gab er zurück.
»Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt versuche, es Ihnen zu erklären«, sagte sie. »Ich bin sicher, er hat alles gesagt, was er sollte, und er kann erschreckend überzeugend sein, und ich hatte meine Gründe dafür, seinen Antrag anzunehmen. Ich dachte, ich wäre bereit. Aber die Ehe ist unbekanntes Terrain. Man denkt, man kennt sie, besonders solche wie ihn, über die sich die Leute schon immer das Maul zerrissen haben, aber wie kann man sie wirklich kennen? Ich weiß, was Sie sagen werden.«
»Das bezweifle ich.« Noch immer hatte er nicht den geringsten Schimmer, wovon sie eigentlich sprach.
»Sie werden sagen, ich hätte ihn einfach fragen sollen, warum er mich gewählt hat – und sagen Sie nicht, er hat Gefallen an mir gefunden, denn das hat noch nie jemand.«
Er war sicher, dass eine Menge Männer an ihr interessiert gewesen sein mussten. Aber er konnte sich nicht erklären, warum niemand sie bisher mit Beschlag belegt hatte. Nicht alle Männer waren wie Ihre Un-Gnaden. Viele wollten tatsächlich heiraten und verwandten eine Menge Zeit und Mühe darauf, das richtige Mädchen zu finden, das sie auch noch wollte.
Er zog sein Taschentuch hervor und reichte es ihr. »Nun, er ist eben nicht wie andere Kerle«, wandte er ein.
Er sah aus dem Fenster der Kutsche. Draußen regnete es noch immer.
Kalte Füße, sagte er sich. Das war alles, was in Wahrheit dahintersteckte.
Er betrachtete ihr schlammbespritztes Kleid und die Spitzen ihrer schlammigen Slipper. Er berechnete im Kopf die Distanz und die Fahrzeit, die man benötigen würde, wenn man über den Fluss nach Twickenham gelangen wollte, wenn man nicht auf Schwierigkeiten stieß, und er war nicht so naiv anzunehmen, dass sie davon verschont bleiben würden.
Wenn man all das bedachte, war ihr Plan praktikabel.
Er rechnete sich ausgezeichnete Chancen aus, sie binnen weniger Stunden sicher in die Obhut ihrer Tante entlassen zu können, noch lange vor Einbruch der Dunkelheit. Ihr Ruf würde nicht leiden. Im Gegenteil, Ashmont davongelaufen zu sein, konnte ihn sogar noch verbessern. Ebenso wenn Ashmont ihr nachliefe, was er gewiss tun würde. Besitzergreifend und stur, wie er war, würde er alles tun, um sie zurückzuholen. Und die gehobene Gesellschaft wäre hocherfreut zu sehen, dass ihn eine Dame letztlich zur Räson zu bringen vermocht hatte. Lord Frederick würde es ganz gewiss freuen.
Daran gewöhnt, dass Frauen von schlechtem Ruf ein Mordsgetue um ihn machten, hatte Ashmont das vermasselt, was eigentlich eine nur allzu simple Angelegenheit gewesen wäre. Er hatte sich noch nie Mühe geben müssen, wie Ripley und Blackwood es oft mussten. Nun gut, keiner von ihnen hatte es oft mit respektablen Frauen zu tun, die ganz offensichtlich eine deutlich größere Herausforderung darstellten. Umso besser. Es war höchste Zeit, dass eine Frau den Lustvollen Lucius einmal dazu brachte, sich ordentlich anzustrengen.
Dieses Exemplar hatte ihm auf jeden Fall die Brautwerbung nicht leicht gemacht. Und die Hochzeit auch nicht. Sie würde es ihm auch in der Ehe nicht leicht machen.
Um seine Braut zurückzuholen, benötigten Seine Gnaden hier und da noch etwas Hilfestellung, aber das sollte nicht schwer sein.
Lady Olympia schien nicht gänzlich abgeneigt, ihn zu heiraten. Wäre der Brandy nicht gewesen, hätte sie es möglicherweise hinter sich gebracht. Aber berauschende Getränke hatten diese Wirkung auf manche Leute: Belanglose Dinge wurden zu unvorstellbarer Größe aufgebauscht. Und hirnverbrannte Lösungen erschienen plötzlich brillant.
Gerade Ashmont wusste, wie das geschehen konnte.
Und wäre es nicht amüsant, ihm dabei zuzusehen, wie er versuchte, mit seiner Braut fertigzuwerden? Mit dieser Braut hier?
»Ich nehme an, Ihre Tante ist respektabel?«, fragte Ripley. »Nicht exzentrisch oder übermäßig extravagant? Setzt sie im unpassenden Moment ihre Kissen in Brand? Lässt sie sich mit Dienern oder Stallburschen ein? Also, so dass es auffällt, meine ich.«
Sie tupfte sich Augen und Nase ab. »Nun, sie ist ein klein wenig extravagant, zumindest behaupten das Tante Lavinia und Mama. Aber Tante Delia ist noch immer respektabel genug, hin und wieder die Königin begrüßen zu können.«
»Warum war Ihre Tante dann nicht bei der Hochzeit?«
»Eine kleine Unpässlichkeit hielt sie davon ab, die Reise anzutreten. Das jedenfalls hat sie Mama geschrieben. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sie gern gekommen wäre. Sie findet es in Newland House zu laut mit all den Kindern, die kommen und gehen. Dasselbe denkt sie von Gonerby House, wo es wegen der Renovierungen derzeit noch chaotischer zugeht.«
»Aber sie wird tatsächlich zu Hause sein, wenn wir dort ankommen.«
Sie nickte, und der Kopfschmuck rutschte noch ein Stück herunter. Sie zuckte schmerzvoll zusammen. »Sie können nicht von mir erwarten, dass ich Ihre indiskreten Fragen beantworte, während mir die Haare mit den Wurzeln herausgerissen werden. Es sei denn, Ihnen gefällt es, die Methoden der Inquisition anzuwenden. Wenn Sie mir nicht sofort helfen, dieses Ding von meinem Kopf zu nehmen, kann ich nicht für die Folgen garantieren.«
»Soll das eine Drohung sein?«, fragte er. »Sie könnten nämlich nicht weniger bedrohlich aussehen. Man möchte sich totlachen.«
Sie schob ihre Brille zurecht, die während des Tränenflusses ein winziges Stück heruntergerutscht war, und sah ihn geradeheraus an. Zumindest so gerade, wie der Grad ihrer Trunkenheit erlaubte.
»Vergessen Sie es«, entgegnete sie. »Wenn es für Sie zu kompliziert ist, werde ich es selbst tun. Aber wenn es schiefgeht und Ihnen alles um die Ohren fliegt, sind Sie selbst schuld.«
»Das hat Sie also davon abgehalten, es selbst zu versuchen?«, spottete er. »Die Möglichkeit, Ihre Coiffure könnte explodieren?«
»Ich habe keinen Spiegel«, entgegnete sie. »Ich kann meinen Oberkopf nicht sehen – also eigentlich meinen gesamten Kopf nicht. Aber was soll’s? Lassen Sie sich von mir nicht stören.«
Sie griff sich an den Kopf und stocherte mit den Fingern in dem Haarschmuck herum. Das hatte einige Verrenkungen zur Folge, die auf verlockende Weise Bewegung in die Bereiche direkt über und unter dem Ausschnitt ihres Kleides brachten. Sie erinnerten ihn an die sogenannten Ägyptischen Tänzerinnen, die er mal in irgendeinem Theater gesehen hatte. Schließlich gelang es ihr, eine einzige Haarnadel zu lösen, die ihr durch die Finger glitt und ins Stroh fiel. Sie murmelte etwas.
Eine verlorene Haarnadel war keine Katastrophe. Ihre Tante würde jede Menge davon besitzen.
Aber die Verrenkungen und seine inneren Bilder von tanzenden Mädchen erinnerten ihn beziehungsweise seine Fortpflanzungsorgane daran, wie sie sich gewunden hatte, als er sie aus dem Dreck aufgeklaubt hatte. Und zwar nur allzu lebhaft, in Anbetracht der Umstände und der Zeitspanne seit …
Richtig. Des Problems sein Zölibat der vergangenen Monate betreffend würde er sich später annehmen. Besser gesagt noch heute Nacht. Wenn dieses Brautproblem gelöst war.
Ripley würde sie sicher bei ihrer Tante abliefern. Nach ein paar Ellenbogenstößen und vagen Hinweisen würde Ashmont sie zurückholen.
Es war doch alles ein großer Spaß, über so etwas konnte sich Ashmont prächtig amüsieren, wenn er sich erst einmal etwas beruhigt hätte.
Er hatte schließlich selbst eine Menge Späße gemacht.
»Ich habe beschlossen, Ihnen zu helfen«, sagte Ripley. »Ich möchte ein Nickerchen machen, und das ist unmöglich, wenn Sie herumhampeln und vor sich hin fluchen.«
»Ich habe nicht –«
»Ich verstehe Französisch, wissen Sie? Mein Verständnis hat seine Grenzen, aber die Schimpfwörter überschreiten sie noch nicht.«
Dank des Regens und des gesammelten Schmutzes einiger Jahrzehnte auf der Scheibe war es im Innern der Kutsche ungefähr so hell wie in einer durchschnittlichen Gruft. Dennoch konnte Olympia den Duke of Ripley gut genug sehen. Sie hätte ihn wohl auch kaum übersehen können, denn er nahm ja den Großteil der Kutsche ein. Sie war sich seiner lang ausgestreckten Beine, nur wenige Zentimeter von ihren entfernt, deutlicher bewusst, als ihr lieb war.
Sie nahm die Hände von ihrem Haarschmuck und betrachtete ihr Gegenüber. Obwohl sein Gesicht im Schatten lag, konnte sie die lange, herrschaftliche Nase erkennen und die scharf geschnittenen Konturen seiner Wangenknochen und seines Kiefers. Sie wusste, dass seine Augen grün waren.
Das war ihr bei ihrer ersten Ballsaison aufgefallen, als man sie einander vorgestellt und sie sich so schrecklich unbehaglich gefühlt hatte. Zum Teil war das darauf zurückzuführen gewesen, dass er so … überwältigend war. Sie wusste, dass er nicht größer war als Ashmont. Ihre Un-Gnaden waren alle drei groß und athletisch gebaut. Und sie waren gewiss alle nicht anständig. Aber Ripleys Blick war es gewesen, dessentwegen sie sich gefühlt hatte, als wäre sie nicht vollständig angezogen. Seine wölfische Art zu lächeln hatte sie sprachlos gemacht.
Aber damals war sie naiv und unsicher gewesen.
Damals hatte man die drei Dukes für recht wild, aber durchaus begehrenswert erachtet. Sie hielten sich allerdings vom Heiratsmarkt fern. Für gewöhnlich mieden sie sogar die schönen und weit beliebteren jungen Damen.
Das war der Grund dafür, dass Olympia ihn, wenn sie ihm über die Jahre einmal begegnet war, für gewöhnlich nur aus der Ferne gesehen hatte. Am anderen Ende eines vollen Ballsaals. Bei Ausritten oder Ausfahrten im Hyde Park. Bei einer öffentlichen Veranstaltung wie einer Regatta oder einem Pferderennen. Im vergangenen Jahr hatte sie ihn überhaupt nicht gesehen, weil er im Ausland gewesen war.
Soweit sie es im Augenblick beurteilen konnte, hatte er sich nicht verändert. Er hatte noch immer diesen verhangenen Blick, der sie innerlich ganz kribbelig machte. Das sollte er nicht, denn er verriet einem nichts. Man behauptete, Augen seien die Fenster zur Seele. In seinem Fall waren die Läden geschlossen. Und das war vermutlich auch gut so.
Nicht, dass sie in der Lage gewesen wäre, seine Laune einzuschätzen, selbst wenn er die Fenster zu seiner Seele geöffnet hätte. Ihr Verstand war derzeit nicht besonders zuverlässig. Wenn sie versuchte zu denken, schwirrten ihre Gedanken davon, außerhalb ihrer Reichweite.
Außerdem verursachte der Kopfschmuck ihr beim Denken Schmerzen.
Eins nach dem anderen, sagte sie sich. Wenn sie Battersea Bridge erreichten, würde sie sich um das Nächste kümmern, was auch immer das sein mochte. Jetzt war die Hauptsache, dass sie fortkam. Fort von allen.
»Rutschen Sie auf die Kante des Sitzes vor und beugen Sie sich zu mir«, sagte Ripley.
Aufgrund der ruckelnden Fortbewegung der Kutsche und der Auswirkungen des Brandys war sie sich nicht sicher, ob sie das Gleichgewicht würde halten können. Das wollte sie ihm gegenüber aber keinesfalls zugeben. Er amüsierte sich auch so schon genug über sie, da war sie sicher. Allerdings war er auch nicht unbedingt dafür bekannt, besonders ernsthaft zu sein.
Außerdem, um fair zu sein, gab sie im Augenblick tatsächlich keine besonders würdevolle Figur ab.
Vor allem musste diese Monstrosität von Brautschmuck von ihrem Kopf herunter. Es fühlte sich an, als trüge sie einen Uhrenturm auf dem Kopf.
Sie rutschte vor und beugte sich zu ihm.
Dann wäre sie beinahe vom Sitz aufgesprungen, als seine langen Finger in ihr Haar griffen und auf ihrer Kopfhaut herumtasteten. Die Rüschen an seinen Handgelenken kitzelten sie im Gesicht. Sie erschnupperte den Duft von feuchtem Leinen und noch etwas anderem, Rasierwasser oder Rasierseife, überaus maskulin.
In diesem Augenblick erinnerte sie sich in einer inneren Rückblende an die Gefühle, die sie durchströmt hatten, als seine Hände unter ihre Arme gegriffen und sie aus dem Schlamm gezogen hatten … die schiere Größe seiner Hände und wie sich sein beherzter Griff angefühlt hatte … seine Größe … und ihr Rücken gegen einen Oberkörper gepresst, der wie ein Felsen anmutete. Ein warmer Felsen. Dann dieselben Hände mit den langen Fingern ineinander verschränkt, um ihrem Fuß Halt zu geben … um ihre Knöchel geschlungen.
Ihre Brüder hatten ihr auch schon über Mauern und Zäune geholfen, aber er war nicht ihr Bruder. Er war ein Mann, unter dessen Blick sich ein Mädchen fühlte, als hätte sie vergessen, sich etwas anzuziehen. Er war ganz und gar nicht wie ein Bruder – und wenn sie sich Mamas unzusammenhängende Ausführungen über das in Erinnerung rief, was in der Hochzeitsnacht geschehen würde, trug das nicht gerade dazu bei, dass sie gelassener wurde.
Olympia erschrak.
Aber nein. Sie würde jetzt nicht darüber nachdenken, was der Duke of Ripley gesehen haben mochte, als sie auf seinen Schultern gestanden hatte. Nur daran zu denken machte sie schwindlig. Noch schwindliger. Und unbehaglich.
»Hören Sie auf zu zappeln«, schimpfte er.
»Ich zapple nicht«, protestierte sie.
»Sie halten aber auch nicht still«, sagte er. »Ich muss tasten, weil es nicht hell genug ist, um richtig zu sehen. Wenn Sie sich bewegen, kann ich das nicht.«
»Ich kann nichts dafür, dass die Kutsche ruckelt«, entgegnete sie. »Und es ist fürchterlich unbequem.« Das war eine Untertreibung. Alles kribbelte. Ihr war heiß. Und sie war verwirrt.
»Ich mache ja schon so schnell, wie ich kann, aber Ihre Zofe oder Ihr Friseur hat die Nadeln verflucht gut versteckt. Ist dieses Ding festgeklebt?«
»Nein, es sind nur etwa tausend Nadeln und etwas Pomade.«
»Strecken Sie die Hand aus und ich gebe Ihnen die Nadeln«, forderte er. »Die Überreste von Rhododendron brauchen wir wohl eher nicht, richtig? So erinnern Sie mich an Ophelia, nachdem sie ins Wasser gegangen ist.«
»Der Schleier hat sich überall verfangen«, erklärte sie. Dann erst bemerkte sie, was er gesagt hatte. »Sie kennen Hamlet?«
»Ich mag Shakespeares Dramen«, entgegnete er. »Viel Gewalt und zotige Witze.«
Warum überraschte sie das nicht?
Sie streckte die Hand aus. Seine Finger berührten ihre kurz, als er ihr einige Nadeln in die Handfläche legte, und das Gefühl der flüchtigen Berührung schlängelte sich über ihre Haut. Sie wünschte, sie hätte ihre Handschuhe angezogen, bevor sie aufgebrochen war. Aber dafür hätte sie zurück in ihr Zimmer gehen müssen, um sie zu holen, und irgendwer hätte dort auf jeden Fall auf sie gewartet: Mama, Tante Lavinia. Olympia hätte in der Falle gesessen. Umkehren war keine Option gewesen.
Zu Recht. Sie hätte nicht bis zum letzten Moment warten sollen, um einen Rückzieher zu machen. Sie hätte überhaupt keinen Rückzieher machen sollen. Was stimmte nicht mit ihr?
Sie sah zu, wie Blütenblätter, manche kirschrot, andere blassrosa, ins Stroh hinabsegelten. Teile glänzender grüner Blätter flatterten ihnen hinterher.
Was hatte sie getan?
Schon gut, schon gut. Eins nach dem anderen.
Sie hatte sich geirrt, was die Zahl der Haarnadeln betraf.
Ripley schätzte, es mussten mindestens zehntausend sein. Aber als er einmal ein Muster gefunden hatte, gelang es ihm etwas besser, sie zu entfernen. Ihr dichtes, glänzendes Haar verströmte den Duft von Lavendel und einem Hauch Rosmarin. Es war ein erschreckend züchtiger Duft. Er war an die schweren Düfte gewöhnt, mit denen Schauspielerinnen, Kurtisanen und extravagante Damen aus dem Hochadel ihre Pomade versetzten.
Ihm wurde bewusst, dass er den Kopf näher herabgebeugt hatte. Er zog ihn zurück.
Selbst mit etwas Übung war es eine langwierige Prozedur, nicht nur die Haarnadeln, sondern auch die Orangenblüten und das komplexe Gebilde aus Spitze zu entfernen, ohne dabei ihr Haar vollständig zu verunstalten.
Schlimm genug, wenn eine Frau in einem Brautkleid herumrannte. Aber selbst in einem anderen Kleid, mit offenen Haaren würde man sie für eine Prostituierte oder eine Verrückte halten.
Eine Lady ließ die Haare nicht offen, außer sie war im Begriff, zu Bett zu gehen.
Offenes Haar, offenherzige Dame.
Anders ausgedrückt war diese Dame Freiwild für die eine oder andere Art von Jagd.
Natürlich nicht für ihn. Er war die verfluchte Brautjungfer.
Er konnte sie nirgends unbegleitet hingehen lassen.
Nicht, dass das an sich schlecht gewesen wäre. Sie war unterhaltsam. Und er freute sich darauf, ihr dabei behilflich zu sein, Ashmont in den Wahnsinn zu treiben.
Allerdings wünschte Ripley wirklich, er hätte seinen Hut.
Auch der ärmste Schlucker brachte es noch zu irgendeiner Art von Kopfbedeckung, wie zerlumpt sie auch sein mochte. Wen wunderte es da, dass der Duke of Ripley, der gesellschaftliche Etikette für ein Witzbuch hielt, sich innerlich bei dem Gedanken krümmte, ohne Hut in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein.
Am besten, er dachte nicht über seinen nackten Kopf nach.
Es war wohl auch ganz sinnvoll, nicht zu viel über den Duft nachzudenken, der ihrem Haar entströmte, und darüber, dass er in ihm innere Bilder eines sonnendurchfluteten Gartens in der Toskana hervorrief.
Keine toskanische Villa in der Nähe. Keine unartigen Contessen.
Bloß Ashmonts zukünftige Braut.
Und dies war auch nicht die Toskana oder hatte auch nur Ähnlichkeit mit der Toskana. Es war London, und wie es sich gehörte, regnete es, und Seine Gnaden, der Duke of Ripley, saßen in einem schmutzigen Hackney Coach, der sich Richtung Battersea Bridge vorwärtsquälte, und spielte die Zofe.
Zumindest war es eine neue Erfahrung.
Es gelang ihm, den Kopfschmuck von ihrem Kopf zu lösen, ohne dass dabei allzu viel geschrien wurde – weder von ihr noch von ihm. Aber es stellte sich heraus, dass einige der Zöpfe ihre eigenen waren, und die Schläfenlocken hatten sich aufgelöst, kurz zusammengefasst, alles löste sich und fiel herunter. Er klaubte die Haarnadeln aus ihrer Handfläche und steckte eilig die sich lösenden Strähnen wieder auf. Es sah nicht elegant aus, aber hochgesteckt war hochgesteckt. Dann endlich legte er die Krone und den daran befestigten Schleier in ihren Schoß und lehnte sich zurück.
Sie betrachtete die undefinierbare Masse von Spitze und Orangenblüten auf ihrem Schoß.
»Es ist französische Klöppelspitze, sehr teuer«, sagte sie. »Die sollte mir beim Pfandleiher etwas einbringen. Mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen.«
»Ich werde nicht Ihren Brautschleier versetzen«, sagte er.
»Habe ich Sie darum gebeten? Ich bin sehr wohl in der Lage –«
»Gestern waren Sie vielleicht in der Lage zu manchen Dingen«, widersprach er. »Aber jetzt ist nicht gestern. Jetzt ist heute. Sie sind betrunken. Sie tragen ein Brautkleid. Wenn Sie auch nur einen Schritt ohne mich machen, werden Sie überfallen. Wenn Ihnen etwas zustößt, wäre es meine Schuld, und ich kann nicht ausdrücken, wie sehr mich Duelle langweilen.«
Sie öffnete den Mund, zweifelsohne um zu widersprechen. Doch dann schloss sie ihn wieder und wandte ihren Blick erneut dem zerlegten Kopfschmuck in ihrem Schoß zu.
Hatte sie es sich anders überlegt? Damit konnte er arbeiten, obwohl –
»Haben Sie genug Geld für den Fährmann?«, fragte sie. »Ich meine, nachdem Sie den Kutscher bezahlt haben? Ja, sicher, Sie sind ein Duke, aber meiner Erfahrung nach tragen Gentlemen selten viel Geld mit sich herum.«
Er starrte sie eine Weile an, den Dreck auf ihrer Nase und die Flecken auf ihren Brillengläsern von den Tränen oder vom Regen und das bizarre Arrangement, zu dem er ihr Haar zusammengesteckt hatte.
Seit seiner unerfreulichen Kindheit hatte ihn keine Frau mehr gefragt, ob er genug Geld für irgendetwas hatte. Es war ziemlich rührend.
Aber seine Aufgabe war es nicht, gerührt zu sein. Seine Aufgabe war, die Dinge in die Hand zu nehmen und einer erwünschten Lösung zuzuführen. Es war doch ganz einfach.
Sie zu ihrer Tante schaffen, Ashmont dazu bringen, dass er sie zurückholte, und dann alle davon überzeugen, dass es alles nur ein typischer Ulk Ihrer drei Un-Gnaden gewesen war.
»Wie es der Zufall will, habe ich genug Geld dabei für Trinkgelder, Bestechung und andere Zwecke«, entgegnete er. »Ashmont war offensichtlich zu … aufgeregt … darüber, dass er heiraten würde, um sich mit solch profanen Angelegenheiten zu befassen.«
»Aufgeregt«, wiederholte sie. »So nennen Sie das also? Ich würde sagen, er war extrem betrunken, als Sie drei in die Bibliothek platzten.«
»Da schimpft wohl ein Esel den anderen Langohr«, meinte er.
Rumpelnd kam die Kutsche zum Stehen wie schon so viele Male zuvor auf der Reise. Ripley sah aus dem verdreckten Fenster. Es hätte alles Mögliche zu sehen gewesen sein können, vor Kratzern und Dreck wäre es nicht zu erkennen gewesen. Er schob das Fenster herunter. Der Regen war nur noch ein leichtes Nieseln.
Der Kutscher rief: »Battersea Bridge, Euer Gnaden.«
»Wir könnten noch immer umdrehen«, schlug Ripley vor.
»Nein«, erwiderte sie.