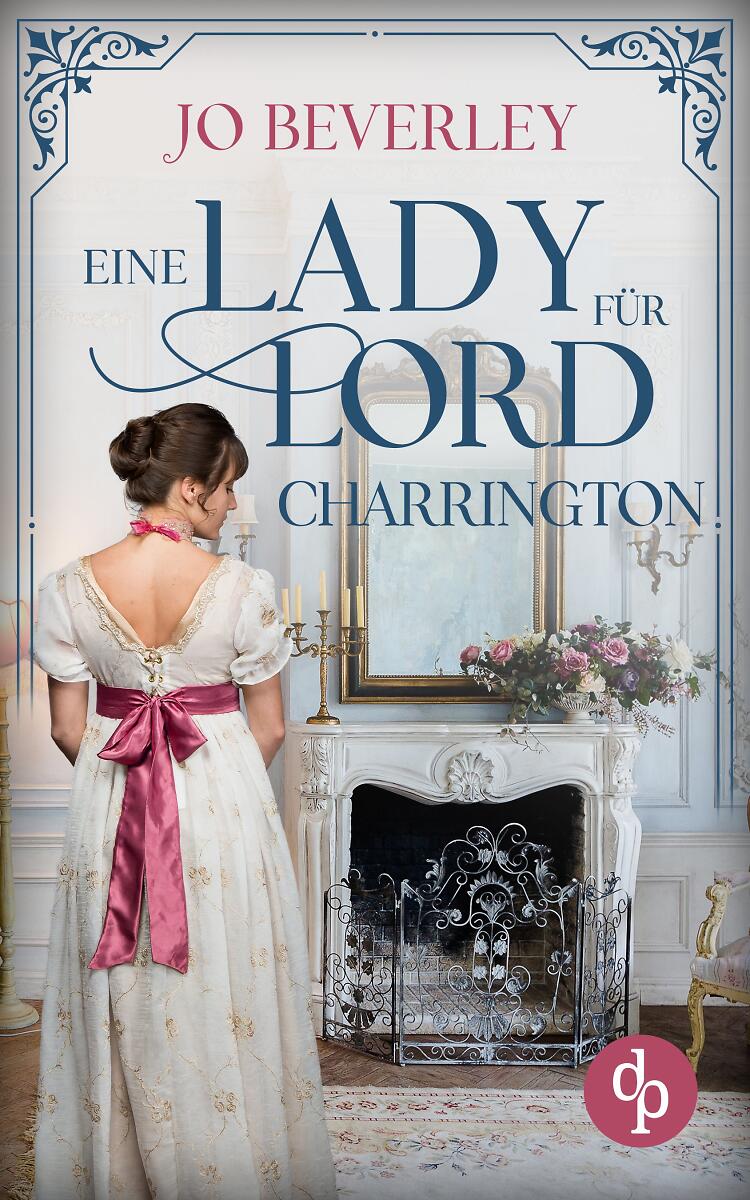Erstes Kapitel
»Wenn sie sich nur nicht immer gleich in mich verlieben würden.«
Leander Knollis, Earl of Charrington, lehnte das Haupt an die hohe Lehne seines Stuhls und blickte ernst an die in Halbdunkel gehüllte Decke. Es war spät an einem Abend im November. Nur ein knisterndes Feuer und wenige Kerzen in einem Leuchter erhellten spärlich den kleinen Salon von Hartwell, dem bezaubernden Landhaus des Marquis of Arden in Surrey.
Den besagten Marquis schien Leanders kummervoller Ton jedoch nicht zu Tränen des Mitgefühls zu rühren. Lucien de Vaux brach vielmehr in Lachen aus, und selbst Beth, seine Gemahlin, musste ein Grinsen verbergen.
»Was sollte ein gut aussehender Kriegsheld denn schon anderes zu erwarten haben?«, fragte Lucien.
»Mein Lieber, Kriegshelden kriegst du jetzt, nur ein paar Monate nach Waterloo, doch regelrecht nachgeworfen.«
»Ich sprach aber von einem gut aussehenden Kriegshelden. Hör auf, den hoffnungsvollen jungen Damen im Almack’s zuzulächeln. Die Wirkung deines Lächelns ist dir doch sehr wohl bewusst.«
Leander warf ihm einen so humorvollen wie bitteren Blick zu. »Durchaus, mein lieber Luce. Aber mit einer Leichenbittermiene kann ich ja wohl kaum auf Brautschau gehen.«
Die drei pflegten einen angenehm zwanglosen Umgangston miteinander. Leander und Lucien hatten ihre Halstücher abgelegt und die Hemdkragen aufgeknöpft. Beth trug ein weites Tuchkleid und einen großen Norwich-Schal um die Schultern. Sie saß auf einem Schemel vor dem Stuhl ihres Mannes, lehnte zufrieden an seinem Knie und genoss die angenehme Wärme seiner Hand auf ihrem Nacken.
»Ich weiß nicht«, sagte sie nachdenklich und betrachtete Leander mit einem Funkeln im Blick. »Eine gequälte Seele hat etwas Unwiderstehliches. Und ich denke, so ziemlich jede Frau glaubt, sie allein könne einer solchen Seele den nötigen Trost spenden. Einer derartigen Herausforderung können wir Frauen einfach nicht widerstehen.«
»Ich stelle keine Herausforderung dar«, protestierte Leander. »Ich verhalte mich seit Wochen schon geradezu vorbildlich – tanze mit den Mauerblümchen, bin höflich zu den Anstandsdamen und gehe bei meiner Brautschau nicht allzu offensichtlich ans Werk.«
»Dann«, meinte Lucien, »schlage ich vor, dass du dir schnellstmöglich eine erwählst. Ich kann nämlich bestens bezeugen, dass die Ehe das Leben in vieler Hinsicht erfreulicher macht.« Seine Finger spielten mit den Locken in Beths Nacken und übermittelten dieser eine heimliche Botschaft, und sie blickte lächelnd zu ihm auf.
Sie waren frisch verheiratet. Zumindest sahen sie selbst sich immer noch so. Die Hochzeit war im Juni gewesen, doch wirklich begonnen hatte ihre Ehe erst einige Wochen später, und eine Reihe von Ereignissen hatte die beiden bis zum September von ihren Flitterwochen abgehalten.
Und nun, nach nur sechs Wochen seliger Ungestörtheit, war ein ungeladener Gast bei ihnen aufgetaucht.
Bis zu diesem Abend war Leander Knollis, Earl of Charrington, neuerdings bei den Guards, für Beth nicht mehr als ein Name gewesen. Aber er war einer der »Rogues«, und so hatte es sie nicht überrascht, als Lucien ihm ohne zu zögern ihr Refugium auf dem Land mitteilte.
Die Company of Rogues, die Gesellschaft der »Schurken« oder »Spitzbuben«, war in Luciens ersten Tagen in Harrow von dem unternehmungslustigen Nicholas Delaney gegründet worden. Er hatte zwölf sorgsam ausgewählte Jungen um sich geschart und mit ihnen einen »Schutzverein« ins Leben gerufen. Während ihrer Schulzeit hatten sie einander gegen Ungerechtigkeiten und Schikanen verteidigt. Danach blieben sie in erster Linie als eine gesellige Gruppe zusammen, die sich traf, wenn sich die Gelegenheit ergab, doch es herrschte Einigkeit darüber, dass ihr Bund unverbrüchlich Bestand hatte. Jeder konnte auf die anderen zählen, wenn er jemanden brauchte.
Beth kannte inzwischen sieben der Rogues, und drei waren in den Kriegen gegen Napoleon Bonaparte gefallen. Die zwei restlichen waren Simon St. Bride, der eine Verwaltungsposition in Kanada innehatte, und Leander Knollis. Alles, was sie von ihm wusste, war, dass er eine vielversprechende Laufbahn im diplomatischen Dienst aufgegeben hatte, um in die Armee einzutreten; er hatte Vittoria, Toulouse und Waterloo überlebt, und nun suchte er offenbar eine Frau – und sträubte sich dagegen, dass sich die jungen Damen reihenweise in ihn verliebten.
Also hatte er London und der gesellschaftlichen Saison den Rücken gekehrt und sich natürlich zum nächsten seiner Rogues aufgemacht – Lucien.
»Ich würde mir liebend gerne eine Braut suchen«, sagte Leander in einem etwas scharfen Ton. »Ich dachte, die Welt ist voll von Frauen, für die nichts weiter zählt als Geld und Titel. Und hier bin ich nun, bereit, beides ohne Vorbehalte einer passenden Lady zu Füßen zu legen, wenn sie sich nur nicht in mich verliebt.«
»Und das tun sie alle?«, fragte Beth skeptisch. Ihrer Meinung nach war Leander Knollis ein wenig zu hochtrabend, um ihn wirklich ernst nehmen zu können.
Leander wandte sich ihr zu. »Sie scheinen mir eine vernünftige Frau zu sein. Sie würden sich nicht in mich verlieben, habe ich recht?«
Beth musterte ihn, betrachtete ihn zum ersten Mal wirklich eingehend. Und stellte fest, dass sie sich ihrer Antwort nicht sicher war.
Er bemerkte ihr Zögern, sprang mit einem Stöhnen auf und zog Lucien neben sich in die Höhe. »Sehen Sie uns an! Ich bin kein besonders gut aussehender Mann!«
Beth studierte die beiden. Man konnte diesen Vergleich kaum fair nennen, denn Lucien sah einfach umwerfend gut aus, und das nicht nur aufgrund ihrer Voreingenommenheit als seine Frau. Schon als sie ihn das erste Mal gesehen, als sie ihn gefürchtet und gehasst hatte, hatte sie ihn in Gedanken mit einem griechischen Gott verglichen. Er war über sechs Fuß groß, mit prägnanten Gesichtszügen, goldblonden Locken und wunderschönen Augen mit Wimpern, die sie ihren noch nicht empfangenen Kindern nur wünschen konnte.
Lord Charrington war einen ganzen Kopf kleiner. Er war zwar gut gebaut und wirkte elegant, doch außer einem etwas fremdländisch wirkenden Aussehen hatte er nichts Außergewöhnliches an sich. Und dieses Aussehen war nicht überraschend, war er doch im Ausland geboren und aufgewachsen. Beth war sich nicht sicher, was diese Andersartigkeit bewirkte, denn seine Kleidung, seine Sprache und sein Benehmen waren untadelig englisch. Vielleicht war es seine gelegentlich beredte Gestik, die vielen Worte, in die er eine simple Aussage gern kleidete, oder die lebhaften Mienen, die häufig über sein schmales Gesicht huschten.
Der Durchschnittsengländer war wesentlich weniger agil.
Von diesen Manierismen abgesehen, war er allerdings ganz gewöhnlich. Sein Haar war so schlicht braun wie das ihre, wenngleich er es gewellt und ziemlich lang trug, so, als würde er sich nicht darum kümmern, was wiederum sehr ansprechend wirkte.
Aber dann waren da seine Augen.
Während Beths Augen einfach blau waren, glänzten die seinen in einer seltsamen, blassen Farbe, vielleicht einem hellen Braun; im spärlichen Licht der Kerzen war das schwer auszumachen. Sie schienen etwas tief liegend und die Lider schwer, aber dennoch waren sie von einer strahlenden Intensität, die Aufmerksamkeit erregte und sofort das Herz dessen berührte, den sie ansahen. Sie leuchteten, und dennoch zeigten sie Schatten, die einen verborgenen Schmerz andeuteten. Zweifellos war das lediglich eine Sinnestäuschung, die daher rührte, dass sie tief in den Höhlen lagen, doch in Kombination mit Leanders fremdländischem Gebaren wirkte es äußerst verführerisch.
Er sah nicht nur anders aus, sondern auch verletzt, und, so fügte Beth zu ihrer eigenen Überraschung hinzu, auch gefährlich.
Nicht unbedingt physisch gefährlich, wie Lucien, aber mit seinen Geheimnissen und seinem Willen furchterregend oder beeindruckend.
Sie schüttelte diese Gedanken ab; sicher waren sie der späten Stunde und dem Portwein geschuldet, den sie getrunken hatte. »Nein, Sie sehen nicht außergewöhnlich gut aus«, sagte sie, »aber ich kann verstehen, dass eine Frau leicht ihr Herz verlieren könnte …«
»Das reicht!«, unterbrach Lucien. »Muss ich ihn etwa hinauswerfen?«
Beth lächelte ihm zu. »Ich wollte gerade noch ›wenn es frei ist‹ hinzufügen.« Sie wandte sich dem Earl zu. »Sagen Sie mir, Mylord, warum sträuben Sie sich dagegen, dass eine junge Frau, der Sie den Hof machen, sich in Sie verliebt? Eigentlich sollte das doch mehr als wünschenswert sein.«
»Vielleicht, wenn ich mich bereits für eine entschieden hätte.«
»Nur vielleicht?«
Er nahm mit einem Seufzen seinen Platz wieder ein, und sie dachte, er werde ihr nicht antworten. Es bereitete ihm sichtlich Unbehagen, über seine Gefühle zu sprechen. Doch dann sagte er: »Ich scheine zu romantischer Liebe nicht fähig zu sein. Ich habe so etwas noch nie erlebt und zweifle deshalb daran, ob ich es jemals erleben werde.« Er zuckte die Achseln. »Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ein Leben lang an eine Frau gebunden zu sein, die mich abgöttisch liebt, während ich meinem Lieblingspferd mehr zugetan bin als ihr.«
Das war so schockierend direkt, dass es Beth die Sprache verschlug. Instinktiv ergriff sie die Hand ihres Mannes. »Ich erinnere mich nicht daran, dass du im Ruf stehst, enthaltsam zu sein«, stellte Lucien fest.
Leander blickte kühl auf. »Was hat das damit zu tun?«
»Und all die Frauen verlieben sich in dich?«
Leander warf einen Blick auf Beth. »Ich denke, diese Diskussion heben wir uns lieber für später auf.«
Nach einem kurzen, verdutzten Schweigen lachte Lucien auf. »Du hast doch nicht etwa Angst, wir könnten die empfindsamen Ohren meiner Herzensdame beleidigen? Die würde dich bei den Eiern packen!«
Leander blickte entsetzt.
»Lucien!«, rief jetzt Beth, »dass ich in vielem einer Meinung mit Frauenrechtlerinnen wie Mary Wollstonecraft bin, bedeutet noch lange nicht, dass ich eine derart unanständige Sprache toleriere!«
Er erwiderte ihren Blick mit einer Andeutung von Herausforderung. »Ich habe es dir gesagt, ich behandle dich als Gleichberechtigte – oder als Lady auf einem Podest. Es ist deine Wahl.«
Beth ließ das Thema fallen. Diese schwierigen Fragen hatten sie noch nicht für sich gelöst, und vielleicht würden sie niemals so weit kommen. Sie arrangierten sich. Sie lächelte dem Earl zu. »In Wahrheit, Mylord, würde es mich ärgern, beschützt zu werden, vor allem vor so gemeinen Dingen wie den amourösen Abenteuern eines Gentleman.«
Leander zog verwundert die Brauen hoch. »Ich versichere Ihnen«, erklärte er, »an den meinen ist wirklich nichts Gemeines daran … Aber wenn ich Sie wirklich in mein Schlafzimmer einlassen soll, dann bestehe ich darauf, dass wir aufhören, so förmlich miteinander umzugehen. Wie du weißt, heiße ich Leander. Meine Freunde nennen mich Lee.«
»Und ich heiße Elizabeth. Meine Freunde nennen mich Beth. Also, Lee, dann erzähl uns doch einmal, weshalb deine Geliebten sich nie in dich verliebt haben.«
Er nippte gedankenvoll an seinem Glas. »Um aufrichtig zu sein, Beth, ich weiß nicht ganz sicher, ob das zutreffend ist, und das beunruhigt mich auch. Ich sehe mich nicht gerne als einen grausamen oder gedankenlosen Menschen.« Er zuckte mit den Schultern. »Aber das ist nun einmal der Lauf der Welt. Ein unverheirateter Mann geht mit verheirateten Frauen oder Huren ins Bett. Und von diesen erwartet er nicht, dass sie sich in ihn verlieben. Das wäre ganz und gar sinnlos.«
»Heißt das, du glaubst, dass die Menschen ihre Gefühle beherrschen?«
Er begegnete ihrem Blick. »Ja, das glaube ich – zumindest, was törichte Liebesgefühle anbelangt. Allerdings befürchte ich, dass es nicht möglich ist, sich zur Liebe zu zwingen. Wenn das ginge, wäre ich glücklich zu Füßen von Diana Rolleston-Stowe – sie stammt aus gutem Hause, ist intelligent, gesund und besitzt dreißigtausend Pfund.«
»Und sie ist eine der verliebten Ladys, vermute ich stark. Aber wenn sich die Liebe so leicht zurückhalten lässt, weshalb ist Diana dann in dich verliebt? Alles, was sie erreichte, ist, dass sie dich vertrieben hat.«
Er bemerkte ihren sarkastischen Unterton und lächelte bitter. »Ja, das ist eben das Falsche an unserer modernen Romantik. Früher wurde eine Ehe ohne große Rücksichtnahme auf Gefühle arrangiert. Sehr kultiviert. In unserer degenerierten Zeit hingegen, glauben die Mädchen, sie müssten sich in ihre Ehemänner verlieben, und sobald ein infrage kommender Kandidat der jungen Frau besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt, lässt sie ihrem Herzen freien Lauf. Ich habe noch keinen Weg gefunden, auch nur ein verhaltenes Interesse an einer Heirat zu zeigen, ohne diese Reaktion auszulösen.«
Lucien schaltete sich in die Debatte ein. »Du solltest vorgeben, aus finanziellen Gründen heiraten zu wollen.«
»Das habe ich bei Miss Rolleston-Stowe versucht. Die Reaktion war leider dieselbe. Dass ich ein großes Vermögen und Temple Knollis besitze, hilft mir natürlich nicht gerade bei dem Versuch, als Mitgiftjäger durchzugehen.« Seine Miene verriet, dass er sich selbst verhöhnte, und die gespreizten Hände unterstrichen dies noch. »Ich bin ein reicher Earl, vor Kurzem aus dem Krieg heimgekehrt und erst fünfundzwanzig Jahre alt. Wer würde glauben, dass ich mir eine junge Frau aus einem anderen Grund auserwählte als jenem, dem Impuls meines Herzens zu folgen?«
Beth bemerkte mit Interesse, dass Lord Charringtons Sprache umso blumiger wurde, je mehr sie sich dem eigentlichen Problem näherten. Sie überließ es Lucien, die naheliegende Frage zu stellen.
»Und warum erwählst du sie?«
Leanders Miene wurde ausdruckslos, und Beth wusste, er würde nun lügen oder zumindest ausweichend antworten. »Ich bin ein Einzelkind. Auf dem Schlachtfeld habe ich gelernt, dass das Leben voller Risiken ist. Und deshalb denke ich, ich sollte heiraten.«
»Andererseits«, konterte Lucien verbindlich, »hast du eine ganze Menge Cousins, soweit ich weiß.«
Wenn es überhaupt ging, wurde die Miene des Earl noch leerer. »Ja, mein Onkel hat elf Kinder in die Welt gesetzt, zehn davon leben, acht sind Jungen. Name und Titel sind also relativ gesichert.«
»Dann rate ich dir, jeglichen Gedanken an Heirat erst einmal beiseitezustellen. Es ist nicht gut, solche Dinge zu überstürzen. Wenn du dir Zeit lässt, wirst du eine Frau kennenlernen, die deine Gefühle wirklich anspricht.«
»Ich möchte aber jetzt heiraten.«
»Aber weshalb denn, um Gottes willen!«
Leander gestikulierte rechtfertigend. »Entschuldigung. Ich glaube, das ist nicht besonders fair von mir, was? Erst platze ich hier herein und bitte um Hilfe, und dann werde ich obstruktiv. Ich habe meine Gründe, Luce, aber sie tun nichts zur Sache. Es ist ein simples Bedürfnis zu heiraten und mich niederzulassen.« Ein wehmütiges Lächeln erhellte auf eine merkwürdige Weise seine Züge. Selbst die durch ihre Liebe zu Lucien gewappnete Beth spürte, wie ihr Herz einen kleinen Salto schlug. »Ich hätte mich nur wegen eines Anfalls von Bammel nicht so bei euch aufdrängen sollen.« Er erhob sich.
Auch Lucien stand auf. »Es ist mitten in der Nacht; du kannst jetzt nirgendwo mehr hingehen.«
»Natürlich kann ich das. Es ist Vollmond.«
Lucien stellte sein Glas ab. »Du verlässt dieses Haus nur über meine Leiche.«
Leanders Augen leuchteten auf. »Willst du dich mit mir prügeln?«
Beth sprang auf. Sie kannte die Rogues. »Wenn ihr jetzt eine Rauferei anfangt, dann fliegt ihr beide auf die Straße hinaus. Lee, es ist jetzt schon nach zehn Uhr. Du wirst auf jeden Fall hier schlafen. Wenn du willst, gebe ich dir morgen ein sicheres Geleit zu den Ställen. Aber du bist wirklich eingeladen zu bleiben. Wirklich.«
Er musterte sie einen Augenblick, und ein kurzer Anflug von Freundlichkeit in seiner Miene stahl ihr tatsächlich eine winzige Ecke ihres Herzens. Er wirkte jungenhaft und liebenswert, doch dahinter lauerten die Schatten und diese Andeutung von Gefahr. Kein Wunder, dass die jungen Damen im Almack’s ihm hingebungsvoll zu Füßen gelegen hatten. Er ergriff in einer ausgesprochen fremdländischen Manier ihre Hand und drückte einen samtenen, warmen Kuss auf ihre Fingerknöchel. »Du bist ein Schatz, Beth. Warum finde ich keine Frau wie dich?«
»Lucien hat mich in einer Schule gefunden, nicht in einem Ballsaal«, erklärte sie ernst und versuchte, die Wirkung, die er auf sie ausübte, zu zerstreuen. »Vielleicht solltest du auch dort suchen. Und überschätzen Sie nicht meinen gesunden Verstand, Sir. Ich vermute, wenn Sie mir den Hof gemacht hättest, dann wäre ich ebenso weggeschmolzen wie all die anderen.«
Lucien entzog sie dem Earl. »Ich habe es mir anders überlegt, Lee. Du kannst gehen, wann immer du willst.«
***
Später, als sich ihr Gast eingerichtet hatte und sie in ihrem Schlafzimmer waren, musterte Lucien sie gedankenvoll. »Hättest du dich in ihn verlieben können?«, fragte er schließlich.
Beth verbarg ein Lächeln. Es erstaunte sie noch immer, wie eifersüchtig er sein konnte, obwohl er einer der bestaussehenden, begehrtesten Männer in ganz England war und sie eine ganz gewöhnliche Frau. »Damals, als ich noch unterrichtet habe, war ich zwar kaum in der Stimmung, mich zu verlieben, aber ja, ich denke, ich hätte es gekonnt.«
Er runzelte die Stirn. »Wieso? Du hast dich nur mit größtem Widerstreben in mich verliebt, obwohl es mir ja auch nicht gerade an Charme fehlt.«
Beth streifte ihren Seidenschal ab. »Aber du warst mein Unterdrücker. Es ist schwer, einen Eroberer zu lieben, auch wenn er noch so gut aussieht. Ich begann erst, dich zu lieben, als ich sah, dass du auch ein Opfer warst.«
Er packte sie an den Schultern; in seinem Blick flackerte Zorn. »Willst du mir damit sagen, es war Mitleid?«
Beth lachte laut auf. »Lucien. Sogar als es dir am schlechtesten ging, warst du kaum ein Objekt für Mitleid, höchstens dafür, dass du dich mit mir eingelassen hast.« Sie legte die Arme um seinen Nacken. »Aber ich habe begriffen, dass du mich brauchst. Gebraucht zu werden ist ein gutes Gefühl.«
Er legte liebevoll die Arme um sie. »Worin liegt dann Lees Zauber? Er war schon immer höllisch reserviert, hat nichts und niemanden gebraucht, wie eine Katze. Eine sehr vornehme, geschmeidige Perserkatze. Und zurzeit liegt ihm die Welt zu Füßen.«
Beth lehnte sich bequem an seine Schulter. »Das könnte man meinen, mein Liebster. Aber es ist eine große Bedürftigkeit in ihm. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wie ein klaffendes Loch. Und ich glaube, das ist es, was all die Frauen im Almack’s dahinschmelzen lässt. Sie wollen diese Leere füllen.«
Lucien lachte vergnügt. »Hast du das nicht geändert, Schatz?« Beth errötete, was sie nach Monaten, die sie nun schon verheiratet waren, überraschte. »Du bist ein ganz schlechter Mann!« Sie befreite sich aus seiner Umarmung, warf ihm ein unanständiges Grinsen zu und ließ ihr seidenes Nachthemd über die Schultern nach unten gleiten, sodass es auf die Hüften fiel. »Willst du mir jetzt wieder beweisen, dass nur ein schlechter Mann einer ist, den zu haben sich lohnt?«
Er zog sie in seine Arme und presste sich an ihre Brüste. »Für immer und immer«, murmelte er in sie hinein.
»Amen«, hauchte Beth.
Sie schafften es nicht bis zum Bett.
Als Beth ihren heißen, verschwitzten Körper regte, blickte sie nach unten in die dunklen, übersättigten Augen ihres Gemahls. Sie waren sogar vom Teppich herunter auf die Eichendielen unter dem Fenster gerollt. Er lag auf dem Boden. Sie lag auf ihm.
Sie strich ihm die feuchten Haare aus der Stirn. »Du hast bestimmt Abdrücke von den Brettern auf dem Rücken.«
»Das beweist lediglich, dass Galanterie noch nicht tot ist.« Er umfasste Beths Kopf und küsste sie mit vollendeter Leidenschaft. »Wann habe ich dir das letzte Mal gesagt, dass ich dich liebe?«
»Das ist schon Stunden her.«
»Ich bin ein nachlässiges Schwein. Vielleicht sollten wir dem armen Lee helfen. Die Ehe ist eine wunderbare Erfindung.«
»Zu einer Ehe ohne Liebe? Das wäre nicht nett von uns.« Beths Finger glitt sanft über Luciens wunderschöne Gesichtszüge. »Wann habe ich dir das letzte Mal gesagt, dass ich dich liebe?«
»Das ist schon Stunden her.«
»Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich.«
Sie küssten sich. Irgendwie schafften sie es ins Bett. Und liebten sich noch einmal.
Schon mehr schlafend als wach murmelte Beth: »Die trauernde Witwe.«
»Was?«
Sie holte sich so weit aus dem Schlaf zurück, dass sie verständlich sprechen konnte. »Wenn Lee wirklich eine Ehe ohne Liebe eingehen will, dann sollte er die trauernde Witwe heiraten. Eine, die ihren ersten Ehemann so angebetet hat wie Judith Rossiter, wird sogar Leander Knollis widerstehen können.«
»Sei kein Einfaltspinsel«, erwiderte Lucien, ebenfalls bereits halb schlafend. »Er hat einfach nur Grillen im Kopf. Der wird schon wieder vernünftig.«
Doch der Earl schien seine Meinung nicht ändern zu wollen.
Nachdem sie ihn dazu gedrängt hatten, erklärte er sich einverstanden, ein paar Tage zu bleiben, und erwies sich als ein untadeliger Gast. Er war höflich, charmant und rücksichtsvoll und wusste, wann er sich rar machen sollte. Beth begann an den Schatten, die sie am ersten Abend meinte bemerkt zu haben, zu zweifeln.
Und Lucien hatte recht gehabt, was seine Unabhängigkeit anbelangte. Niemand ist eine Insel, schrieb der Dichter John Donne, aber Leander Knollis war zumindest nicht weit davon entfernt. Er bewegte sich durch den Tag mit der Gewandtheit eines Höflings – charmant und mit besten Manieren, aber ohne sich auf jemanden einzulassen.
Es überraschte Beth nicht, zu erfahren, dass seine erste Laufbahn die diplomatische gewesen war; diesbezüglich war er in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Der verstorbene Earl of Charrington war für seine Fähigkeit zu schlichten und zu vermitteln berühmt gewesen, und er hatte dieser Aufgabe sein ganzes Leben gewidmet. Leander hatte diese Gabe ganz eindeutig geerbt und war auf ein entsprechendes Leben vorbereitet worden. Er war in Istanbul geboren und an vielen verschiedenen Orten aufgewachsen. Erst mit acht Jahren hatte er England zum ersten Mal betreten.
Sein nächster Aufenthalt fand statt, als er zwölf war und auf die Schule nach Harrow kam. »Und ich bin mir nicht sicher«, gestand er Beth eines Tages im Rosengarten, »ob ich ohne Nicholas und die Rogues dort überlebt hätte. Ich weiß nicht, weshalb er mich auswählte, aber ich bin ihm auf ewig dafür dankbar. Ich konnte mit Königen und Prinzen jeder Nationalität Umgang pflegen, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mit anderen Jungs auskommen sollte, und von allen möglichen englischen Bräuchen wusste ich auch nichts.«
Es war ein herrlich sonniger Tag für November, und Beth kam dem Gärtner ins Gehege, indem sie die letzten toten Blätter von den Rosen abschnitt. »Es kommt mir ein wenig gedankenlos von deinen Eltern vor, dass sie dich so unvorbereitet nach Harrow schickten.«
»Oh, ich hatte die besten Privatlehrer. Ich spreche acht Sprachen.«
Sie blickte irritiert auf. Das war absolut keine Antwort auf ihre implizierte Frage. Es kam Beth vor, als würde die Konversation jedes Mal, wenn Leanders Eltern ins Spiel kamen, eine geschickte Wendung erfahren. Er konnte das gut, wirklich sehr gut, aber es fiel ihr trotzdem auf. Und so beschloss sie, der Sache auf den Grund zu gehen.
»Wann ist dein Vater gestorben?«, fragte sie.
»Vor einem Jahr in Schweden.«
»Und deine Mutter?«
»Drei Jahre davor in Sankt Petersburg.«
Er wich ihren Fragen nicht aus, doch er zeigte eine deutliche Zurückhaltung. Sah er sein Leben ausschließlich in geografischen Zusammenhängen? Vielleicht gab es darin einfach keinen anderen Fixpunkt.
Beth ließ den Korb mit den abgeschnittenen Blättern für den Gärtner stehen, ging in Richtung Haus voraus und streifte die Handschuhe ab. »Ich nehme an, du hast sie während deiner Schulzeit nicht viel gesehen. Wo hast du die Ferien verbracht? In Temple Knollis?«
Er hielt ihr eine der Glastüren auf. »Nein. Mein Großvater mütterlicherseits hatte ein Haus in London und ein Anwesen in Sussex. Manchmal war ich auch bei dem einen oder anderen der Rogues. Diesbezüglich gab es nie ein Problem. Ich war immer ein willkommener Gast.«
Ein professioneller Gast, sozusagen. Aber, dachte Beth, wo war dein Zuhause? Sie war selbst als eine Art ausgesetztes Kind in Miss Mallorys Mädchenschule in Cheltenham aufgewachsen, aber sie hatte sich dort zu Hause gefühlt, weil es eine permanente Bleibe gewesen war und weil zwischen ihr und Miss Mallory eine echte Zuneigung geherrscht hatte. Hatte Leander Knollis jemals irgendein Zuhause gehabt?
Sie argwöhnte, dass es wohl klüger war, über das Wetter zu reden, und so fragte sie: »Ich nehme an, es wäre eine lange Reise gewesen bis ins West Country, aber du hast doch sicher bedauert, dass du in Temple Knollis keine Zeit verbringen konntest. Es soll ja eines der schönsten Häuser in ganz England sein.«
Er hielt inne, und sie bemerkte, dass seine Augen wieder diesen ausdruckslosen Blick angenommen hatten. Die Stille zog sich zu lange hin und wurde beinahe peinlich, bis er endlich erwiderte: »Mein Vater hasste den Tempel, und er brachte mir bei, ihn ebenso zu sehen wie er – als eine törichte, kostspielige und gefährliche Narretei. Ich habe ihn bis Anfang dieses Jahres, als ich nach England zurückkam, nie besucht.« Er hob leicht das Kinn an, und sie hatte den Eindruck, er habe zur Abwechslung einmal mehr gesagt, als er wollte.
Hier lag etwas verborgen, und es musste aufgedeckt werden.
»Und findest du ihn schön?«, fragte sie, einfach nur, um eine Reaktion zu provozieren.
Er begegnete ihrem Blick, doch alle Mauern waren bestens platziert. »Oh ja«, sagte er. »Er ist ganz zweifellos sehr schön. Entschuldige mich.«
Im nächsten Moment war er ohne eine weitere Erklärung verschwunden.
Beth machte sich in Gedanken versunken auf die Suche nach Lucien und fand ihn in den Ställen. »Was weißt du über Temple Knollis?«, fragte sie ihn.
Er war in Hemdsärmeln und schmutzig und ließ sich nicht von der genauen Inspektion eines Pferdehufs abbringen. Beth fand es noch immer bemerkenswert, wie sehr Gentlemen es liebten, den Stallburschen zu spielen.
»Den Tempel? So hat Lee immer davon gesprochen. Ich nehme an, sein Vater mochte das Haus nicht, deshalb fuhren sie nie dorthin. Sie waren ohnehin kaum in England, und der erste Earl – Lees Großvater – starb erst um achtzehnhundertzehn, und so war das nicht einmal ihr Zuhause.«
»Aber es war offensichtlich, dass Lee es einmal erben würde. Da sollte man doch meinen, jeder hätte gewollt, dass er diesen Ort kennenlernt.«
»Ich vermute, sein Großvater hat vieles versucht, um ihn dorthin zu bekommen.« Lucien beendete seine Inspektion und stand auf. »Weshalb dieses Interesse?«
»Er sagte mir gerade, er sei dazu erzogen worden, es zu hassen.«
Lucien nickte. »Das könnte sein. Er hat nie etwas von seiner Familie erzählt, und ich wollte ihn nicht bedrängen. Meine Beziehung zu meinem Vater war ja auch nicht gerade die beste.« Er betrachtete Beth etwas von oben herab. »Weißt du was? Ich glaube, du wirst ein bisschen zudringlich. Ich denke, du brauchst ein paar Lektionen Griechisch, damit du mit deinen Gedanken auf eine höhere Ebene kommst.«
Beth war zwar gut in Latein, doch Griechisch hatte sie nie gelernt; deshalb brachte Lucien es ihr, wenngleich eher lustlos, bei. Im Augenblick interessierte sie sich jedoch nicht fürs Studieren. »Ich hoffe, dass sich meine Gedanken niemals über das Wohlergehen meiner Mitmenschen stellen. Dein Freund hat Probleme.«
Lucien wurde wieder sachlich. »Das kommt mir auch so vor. Aber ich bezweifle, dass wir etwas anderes für ihn tun können, als da zu sein, falls er uns braucht.«
»Wieso glauben die Männer immer gerade das? Es gibt vieles, was wir tun könnten. Wir könnten ihm zum Beispiel von der trauernden Witwe erzählen.«
Lucien wusch sich in einem Eimer die Hände. »Nicht das schon wieder. Er hat seit diesem ersten Abend nicht mehr vom Heiraten gesprochen, und selbst wenn er darauf bestünde – Mrs. Rossiter wäre wohl kaum eine Kandidatin. Sie hat zwei kleine Kinder, sie trägt lange nach dem Tod ihres Mannes noch immer Trauerkleidung, und sie muss um Jahre älter sein als er.«
»Bestimmt nicht.«
Er drehte sich zu Beth um und trocknete sich mit einem Tuch die Hände. »Was denkst du denn, wie alt sie ist?«
Beth überlegte. »Sie sieht jünger aus als ich …«
»Das ist nur wegen ihrer großen Augen, aber denk daran ihr Sohn ist gerade elf geworden.«
»Du lieber Gott. Dann muss sie auf die Dreißig zugehen.« Beth seufzte. »Und ich hatte praktisch schon beschlossen, dass sie die Erhörung aller unserer Gebete sein würde. Sie ist zu stolz, um es zuzugeben, muss aber schrecklich knapp bei Kasse sein. Es würde mich wundern, wenn ihr verträumter Poet ihr auch nur eine Guinee hinterlassen hätte. Sie ist zwar sehr reserviert, aber ich denke, ich könnte sie mögen, wenn sie nur aufhören würde, mich als die Grande Dame des Orts zu sehen. Und wenn Lee wirklich eine Ehe ohne Liebe will, dann wäre sie doch ideal.«
»Wer wäre ideal?«
Beth wandte sich schuldbewusst um und erblickte ihren Gast an der Stalltür.
»Tut mir leid, wenn ich mitgehört habe«, sagte er, »aber wenn der eigene Name genannt wird, kann man einfach nicht widerstehen zu lauschen. Habe ich das richtig verstanden – du hast eine Heiratskandidatin für mich?«
Es klang alles sehr unbeschwert, doch Beth spürte ein ernsthaftes Interesse. Was immer Leander Knollis antrieb, es war keine Laune, die bald vergessen sein würde. Sie blickte absichtlich nicht zu Lucien. »Das dachte ich, aber Lucien meint, dass sie absolut nicht infrage kommt.«
Leander spielte mit einem Strohhalm. »Absolut nicht ist sicher falsch. Du bist viel zu klug, um ganz und gar daneben zu liegen, Beth. Also, inwiefern kommt sie infrage?«
Beth zuckte die Achseln. »Sie würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dich verlieben. Sie ist sozusagen das hiesige Melodrama. Ihr Mann war Sebastian Rossiter, ein Dichter, der Mayfield House im Dorf gemietet hatte. Er starb, bevor ich Lucien heiratete, deshalb habe ich ihn nie kennengelernt, aber jeder hier in der Gegend wird dir schon beim geringsten Anlass die ganze zu Herzen gehende Geschichte erzählen.«
»Dir wird übel davon«, warf Lucien ein und schlüpfte in seine Jacke. »Sebastian Rossiter war ein absoluter Träumer mit langen, flachsblonden Locken – ich wette, er hat Papierhaarwickel benutzt – und schlanken, biegsamen, weißen Händen. Ich frage mich, wie er es fertiggebracht hat, zwei Kinder in die Welt zu setzen.«
»Er war sehr schön«, konterte Beth bestimmt, »zumindest sagen das die hiesigen Frauen. Und er war nett, freundlich und seiner Frau zutiefst ergeben. Sie waren verrückt aufeinander und trennten sich nie. Er schrieb fast alle seine Gedichte über sie oder für sie. Ich glaube, eines wurde einigermaßen bekannt ›Meine Engelsbraut‹.«
Lucien zitierte gefühlsbetont: »Wenngleich im Himmel sich die Engel hindern, / um des Menschen Gram zu lindern, / fehlt dem gemeinen Mann in diesen öden Breiten / doch ein Engel an seiner Seiten.« Obwohl sein Vortrag satirisch war, konnte selbst er die Schönheit des Sentiments nicht gänzlich zunichtemachen. »Es geht noch weiter. Warte …« Er überlegte kurz. »Judith erstrahlt in göttlichem Schein, / unser Kind an ihrem Busen rein. / Und Tau, der funkelnd hängt am Gras / spiegelt Engelsneid in seinem Nass.«
»Damit könnte ich bei meinem Werben sicher nicht konkurrieren«, kommentierte Leander.
Lucien schüttelte den Kopf. »Ich wollte nichts mit dir zu tun haben, wenn du es auch nur versuchen würdest.«
»Nun«, sagte Leander, »und was sind die Hinderungsgründe für eine Ehe?«
»Zwei Kinder«, antwortete Beth.
»Wie alt?«
»Ein Junge von elf und ein Mädchen von sechs Jahren.«
Lee überlegte kurz. »Darin sehe ich kein Problem«, erklärte er dann. »Der Junge ist alt genug, um sich nicht für eines unserer eigenen Kinder und meinen Erben zu halten. Es dürfte bezüglich des Erbes also keine Schwierigkeiten geben. Und eigentlich«, fuhr er mit einem plötzlichen, unerklärlichen Leuchten in den Augen fort, »würde mir so eine fertige Familie ganz gut gefallen.«
Beth blickte zu Lucien.
»Lee«, meinte dieser, »denk daran, wie alt sie demnach schon sein muss.«
Lee überlegte. »Über dreißig?«
»Vielleicht noch nicht ganz, aber du bist erst fünfundzwanzig.«
»Wieso dann die Aufregung? Fast alle meine Geliebten waren älter als ich. Mein Vater hat mir sogar den guten Rat gegeben, mich nicht mit einer Frau einzulassen, die jünger ist als ich, bis ich mindestens dreißig bin. Ich hätte auf ihn hören sollen. Wenn ich von Anfang an bei den älteren Semestern auf Brautschau gegangen wäre, hätte ich mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit eine vernünftige Frau gefunden, eine, die zu klug ist, um sich bezüglich meiner Person etwas vorzumachen.«
Er nickte zufrieden. »Auf dem Kontinent sind Zweckehen noch immer sehr verbreitet, wisst ihr. Dieser Gedanke hat für mich nichts Unangenehmes. So lange diese Witwe mir noch ein paar Kinder gebären kann, ist mir ihr Alter gleichgültig. Ich sehe allerdings keinen Grund, weshalb diese Frau mich in Erwägung ziehen sollte, wenn sie noch immer so sehr um ihren Mann trauert, wie ihr sagt.«
Beth erklärte es kurz und bündig: »Geld.«
»Poesie ist nicht lukrativ?«
»Offenbar nicht, wenngleich ›Meine Engelsbraut‹ vor ein paar Jahren von jedem sentimentalen Schulmädchen rezitiert wurde. Aber es kann wohl nicht jeder ein Poet wie der große Byron sein, denke ich. Als Mister Rossiter starb, musste die Witwe aus Mayfield House ausziehen und eine Kate im Dorf mieten. Ich nehme an, sie entstammt einer großen Pfarrerfamilie und kann von daher wenig Hilfe erwarten. Ihr Sohn kommt jetzt in das Alter, in dem er in die Schule gehen muss und einen guten Start ins Leben braucht. Möglicherweise hat sie es geschafft, für die Zukunft ihrer Kinder ein wenig Geld auf die Seite zu legen, aber ich bezweifle es.«
Lee lehnte sich an den Pfosten einer Stallbox und streichelte die Nüstern des Pferdes. »Ich muss zugeben, das klingt nach einer Situation, die mir sehr zupasskommt.« Er blickte zu Lucien. »Was bedrückt dich?«
»Meinetwegen kannst du ja mit einem Handkarren zur Hölle fahren«, erwiderte sein Freund kurz angebunden. »Aber«, fügte er dann hinzu und legte eine Hand auf Beths Schulter, »in einer Ehe sollte man die Liebe nicht so einfach außen vor lassen.«
Zweites Kapitel
Mit einem Seufzer richtete sich Judith Rossiter vom Waschzuber auf, weil ihr Rücken schmerzte. Sie hasste den Waschtag. Betttücher und Unterwäsche kochten in einer Ecke der kleinen Küche, und sie wrang gerade die Buntwäsche aus. Ihre Hände waren krebsrot, der Raum mit übel riechendem Dampf angefüllt.
Sie war fast fertig, und doch schien es, als sei die Arbeit nie, nie zu Ende. Sie hatte jetzt das Geld zusammengebracht, um noch mehr Trockenfrüchte zu kaufen, und musste sie für die Pastetenfüllung für Weihnachten noch zerhacken. Das bedeutete auch Rosinen zu entkernen, eine weitere Arbeit, die sie nicht mochte.
Vielleicht sollte sie die Sache ja von der positiven Seite sehen. Arm zu sein hatte die Zahl der zu entkernenden Rosinen merklich verringert.
Bei diesem Gedanken seufzte sie erneut. Wenn sie mehr Äpfel beigab, würde vielleicht niemand den Mangel an importierten Früchte bemerken. Auf jeden Fall wollte sie ihren Kindern irgendwie ein richtiges Weihnachten bereiten.
Sie warf das letzte Wäschestück in den Zuber und rief Rosie, um ihr beim Wäscheaufhängen zu helfen. Dann nahm sie den Behälter auf und ging damit in den Garten hinaus.
Köstliche, frische, kühle Luft schlug ihr entgegen; sie blieb eine Sekunde stehen, um zu genießen.
Es war ein herrlicher Spätherbsttag. Die Luft war klar, der Himmel strahlend blau, und die Blätter an den Bäumen waren rostbraun und goldfarben. Während Judith dastand und beobachtete, fielen ein paar zu Boden und fügten sich in den goldbraunen Teppich ein.
Als Sebastian noch lebte, gingen sie an Tagen wie diesem gerne hinaus, wanderten über Felder und durch Wälder. Die Kinder liefen um sie herum und erforschten, während Sebastian elegante Sätze erfand und in sein Büchlein notierte. Judith nahm alles, was zu sehen war, in sich auf, dazu Geräusche, Klänge und Düfte, und war zufrieden.
Damals hatten sie auch noch Geld gehabt. Nicht viel, aber genug, um sich mit einer sorgsamen Haushaltsführung eine Köchin, zwei Dienstmädchen und einen Gärtner leisten zu können. Und Freizeit.
Zeit und Sicherheit, diese beiden Dinge vermisste sie am meisten.
Rosie, mit ihren sechs Jahren ein hübsches Mädchen mit dem hellblonden, fliegenden Haar des Vaters und den großen blauen Augen ihrer Mutter, kam angerannt, um zu helfen. Sie reichte ihr die Wäscheklammern und hielt die herunterhängenden Enden der Wäschestücke hoch, die Judith an der Leine befestigte.
Als sie den Zuber geleert hatten, kam Bastian, wie ihr zweiter Sebastian immer genannt wurde, aus dem Haus. »Kann ich euch mit dem Stützpfahl helfen, Mama?«
Judith lächelte. »Danke, mein Lieber. Das wäre wunderbar.«
Die beiden Kinder schoben das gegabelte Ende der langen Stange unter die Wäscheleine, drückten sie nach oben und stemmten das andere Ende fest in die Erde. Dann prüften sie, ob die Wäsche weit genug von Boden und Büschen entfernt war und der Pfahl gut stand, um sich schließlich zufrieden mit sich selbst abzuwenden.
Judith umarmte die beiden herzlich. Sie war mit wunderbaren Kindern gesegnet, die sich nicht über ihr einfaches Leben beschwerten und ihr Bestes taten, um bei den Arbeiten ihrer Mutter mitzuhelfen. Sie waren ihre größte Freude, aber auch ihre größte Sorge. Bastian, bemerkte sie, reichte ihr nun schon bis an die Schulter. Ihr Großer wuchs rasch, zu rasch.
Allein ihn einzukleiden kostete schon viel Geld, und sie hatte keine Ahnung, wie sie für seine Zukunft Vorsorgen sollte. Sie wusste, ihre Familie würde ihr und den Kindern immer ein Dach über dem Kopf bieten, aber mehr als das war einfach nicht machbar.
Auch Sebastians Familie war nicht gerade reich zu nennen. Dennoch hatte sie ihm eine kleine Rente bezahlt, als er sich entschloss, seiner Berufung als Dichter zu folgen. Dieses Einkommen war sogar nach dem Ableben der Eltern weiter geflossen, und es war ausreichend gewesen. Allerdings hatte Judith nicht geahnt, dass es mit Sebastians Tod versiegen würde.
Dieser Schlag, der zum unerwarteten Tod ihres Mannes noch hinzukam, hatte sie beinahe zugrunde gerichtet. Sie hatte seinem Bruder geschrieben und Hilfe bekommen. Dem Himmel sei Dank für Timothy Rossiter. Würde er ihr nicht diese kleine vierteljährliche Summe zukommen lassen, sie wüsste nicht, was sie tun sollte. Seine Briefe ließen sie befürchten, dass auch er sich das Geld vom Mund absparen musste, aber sie konnte sich nicht weigern, es anzunehmen.
Wenn Sebastians Gedichte nur etwas eingebracht hätten, auch nur ein wenig. Stattdessen hatte er dafür, dass sie gedruckt wurden – auf Schreibpergament und in Korduanleder gebunden – sogar bezahlt und die ansehnlichen Exemplare dann verschenkt. So lange sie Geld gehabt hatten, war ihr das wie eine harmlose Gefälligkeit vorgekommen, doch nun weinte sie jedem einzelnen der prächtigen Lederbände nach.
Ein Exemplar von jedem Werk hatte er behalten. Sie standen in einer Reihe im vorderen Zimmer des Hauses – acht dünne Bändchen voll mit Gedichten über sie. Ihre einzige Erbschaft.
Manchmal wurde sie von dem verräterischen Gedanken heimgesucht, dass wahre Hingabe vorausschauender gewesen wäre.
Das Geld reichte gerade so für dieses kärgliche Leben; erübrigen konnte sie nichts. Selbst die Kosten für eine Lehre von Bastian würden eine risikovolle Ausgabe bedeuten, und dabei hatte er wirklich mehr verdient als das.
»Mama.« Bastians Stimme riss sie aus ihren betrüblichen Gedanken. »Du kennst doch Georgies Ratte?«
Judith schauderte. Sie kannte Wellington nur zu gut. Georgie war Bastians bester Freund, und Wellington und Georgie waren unzertrennlich. Das Tierchen war zahm und schien sogar stubenrein zu sein, doch sie hätte es trotz allem am liebsten mit einem Besen erschlagen.
Bastian nahm ihr Schaudern als eine Art Antwort und seufzte. »Du möchtest wohl nicht, dass ich auch eine habe …«
»Nein!«
»Aber sie brauchte gar nicht viel zu fressen, und Georgie hat schon wieder einen neuen Wurf Babys gefunden. Eines nimmt er selbst, weil Wellington allmählich alt wird …«
»Nein, Bastian. Es tut mir leid, aber eine Ratte im Haus, das halte ich einfach nicht aus. Und jetzt geht, ihr beiden, und seht zu, dass ihr mit eurer Arbeit fertig werdet.« Sie beschloss spontan, dass die Rosinen warten konnten. »Wenn ich mit der Weißwäsche fertig bin«, versprach sie, »gehen wir zum Fluss hinunter spazieren.«
Sie eilten ins Haus zurück. Judith seufzte. Sie baten wirklich um so wenig, und sie bekamen noch weniger … Aber eine Ratte! Die Katze der Hubbles hatte gerade Junge bekommen. Vielleicht sollte sie eines nehmen, und das würde dann auch Genüge tun.
Judith ging zu ihrer Wäsche zurück, schaute auf dem Weg ins Vorderzimmer, um nachzusehen, ob die Kinder ihre Arbeit gut verrichteten, und lobte sie dafür. Sie waren beide so gescheit und so anständig. Sie verdienten eine Chance im Leben. Sollte sie zusehen, wie sie als Dienstboten endeten?
Während sie die dampfende Kochwäsche aus dem Waschkessel ins Spülwasser zog, dachte sie verbittert, dass eine tüchtigere Frau in der Lage wäre, etwas Geld zu verdienen – vielleicht mit Romanschreiben oder Bildermalen. Dass sie etwas tun könnte, das sich verkaufen ließ. Das einzig Hervorragende, das Judith produzieren konnte, war Holunderwein. Sie blickte auf die Reihen frisch abgefüllter Flaschen, ihre Hoffnung auf einen kleinen Zuverdienst, und seufzte.
Sie würden ihre verzweifelte Lage um nichts verbessern können.
***
Leander saß auf seinem Grauen, Nubarron, und betrachtete Judith Rossiters Häuschen. Es war eines in einer Reihe an einem gewundenen Weg, der von der Hauptstraße von Mayfield abzweigte. Wie die anderen auch war es klein und mit Stroh gedeckt – das man ruhig einmal hätte erneuern können –, doch es hob sich ab durch Rosen, die sich um den Eingang rankten. Sie hatten jetzt keine Blüten, aber im Frühjahr und Sommer trugen sie vermutlich sehr dazu bei, das Haus zu verschönern.
Wahrscheinlich war es drinnen feucht und eng. Er kannte solche Bauernkaten; sie waren schön anzusehen, aber nur selten war es auch schön, in ihnen zu wohnen. Auf dem Weg hierher war er an Mayfield House vorbeigekommen; im Vergleich dazu bedeutete dies hier für die trauernde Witwe einen gewaltigen Abstieg.
In Wahrheit hatte die Beschreibung seiner Freunde ihn eher auf Abstand zu dieser Frau gebracht, denn wenn er auch keine wollte, die ihn abgöttisch liebte – eine voller Kummer war wohl nicht unbedingt wünschenswerter. Eine bleichgesichtige Kreatur ganz in Schwarz, so etwas konnte schnell zermürbend werden. In der Tat würde er, wenn er dieser Frau die Ehe anbot, darauf bestehen, dass sie ihre Trauer sofort beendete. Das konnte man wohl kaum für eine unvernünftige Forderung halten.
Er meinte, auf der Rückseite des Hauses Stimmen zu hören, und suchte nach einem Weg dorthin. Am Ende der Reihe gab es einen Pfad, dem er folgte, und wie erhofft brachte dieser ihn zu einer Stelle, von der aus man die rückwärtigen Gärten überblicken konnte.
Der Garten der Witwe diente hauptsächlich dem Anbau von Gemüse, und er war größtenteils umgegraben und leer; nur ein paar Pflanzen standen noch. Leander hatte keine Ahnung, was sie anbauten; derlei Dinge waren nicht Teil seiner Erziehung gewesen. Auf einem Pfad standen drei Personen und unterhielten sich. Sie waren gerade damit fertig, Wäsche aufzuhängen; drei kleine Kleider und ein größeres schwarzes bewegten sich im Wind. Die Gestalten waren ein blondes Mädchen in einem hellen Baumwollkleid mit einem Schultertuch, ein dunkelhaariger Junge mit rötlichgelber Nanking-Hose und einer Jacke und die Witwe in Schwarz.
Ihr Haar war so dunkel wie ihr Kleid. Sie trug es zu einem Knoten gebunden, doch einzelne Strähnen waren lose und wehten lockig um ihr Gesicht. Ab und zu strich sie sie nach hinten. Sie war von ihm abgewandt, sodass er ihre Züge nicht sehen konnte, aber sie hatte eine gute Figur, und sie vermittelte den Eindruck von Energie und geschmeidiger Kraft. Er fand sie absolut nicht unattraktiv. Und vom Typ her war sie mit Sicherheit nicht lethargisch oder langweilig.
Plötzlich fühlte er sich befangen, wie er hier saß und die Äußerlichkeiten dieser Lady begutachtete wie bei einem Pferd, das er zu kaufen beabsichtigte. Er zog den Kopf des Grauen herum und trottete zu dem Weg zurück, an dem die Häuser aufgereiht waren. Doch er wusste nun, dass er definitiv daran interessiert war, die Angelegenheit einer Ehe mit dieser trauernden Witwe weiterzuverfolgen. Und so überlegte er sorgfältig, wie er als Nächstes vorgehen sollte.
Er konnte natürlich zu ihr hinreiten und sie einfach fragen. Doch dagegen sprach einiges. Erstens konnte er ohne wenigstens ein kurzes Treffen zuvor nicht sicher sein, ob sie ihm genügen würde. Wenngleich seine Anforderungen an eine Braut minimal waren, glaubte er doch nicht, dass er etwa ein ständig geistlos schnatterndes Wesen oder eine besonders schrille Stimme auf Dauer ertragen konnte. Und zweifellos gab es auch noch andere Charakteristika, die ein Leben in ihrer Gesellschaft unmöglich machen konnten.
Zweitens hatte die Erfahrung ihn gelehrt, dass, mochte die ganze Sache für ihn auch noch so vernunftgemäß sein, die Menschen – und Frauen ganz besonders – sogar Geschäfte lieber in Glitzerschmuck und Spitze machten. Wenn er also zu direkt vorging, würde er womöglich schon aus Prinzip abgelehnt werden. Andererseits besaß er viel diplomatisches Geschick – zumindest sagte man das über ihn –, und sollte somit bestens in der Lage sein, diese Aufgabe zu bewältigen.
Also, was könnte er unternehmen, um sich der trauernden Witwe anzunähern?
Er ritt langsam auf die Hauptstraße des Dorfes zurück und war sich dabei der neugierigen Blicke der Menschen von Mayfield wohl bewusst. Sie hätten wohl noch mehr gestarrt, wenn sie seine Gedanken hätten lesen können.
Manchmal fragte er sich selbst, ob er verrückt war, doch das bereitete ihm keine große Sorge. Einige der interessantesten Menschen, die er getroffen hatte, waren auch nicht ganz so wie die meisten anderen Leute gewesen.
Er wollte sich in England niederlassen und hier Wurzeln schlagen, und er wollte dieses Ziel so direkt und zügig erreichen wie möglich.
Trotzdem fragte er sich manchmal noch, ob er nicht Lord Castlereaghs Angebot eines Postens in Wien hätte annehmen sollen. Der Mann hatte ihm praktisch nahegelegt, dass es seine Pflicht sei, seine Fähigkeiten in den Dienst des Vaterlandes zu stellen, aber Leander hatte vom unsteten Leben einfach genug gehabt.
Unter den interessierten Blicken einiger alter Dorfbewohner, die sich die Nachmittagssonne ins Gesicht scheinen ließen, hielt er Nubarron vor dem »Hund und Rebhuhn« an. Das Pferd übergab er einem Stallburschen und trat in das Gasthaus ein, um sich ein Ale zu genehmigen.
Er erklärte dem Wirt, dass er ein Gast des Marquis of Arden sei, und hatte den dicken Mann schon bald so weit, dass er plauderte. Es war eine seiner natürlichen Gaben, dass sich mit ihm alle möglichen Menschen rasch wohl und unbefangen fühlten.
»Und wie ich gehört habe, hattet ihr in dieser Gegend einen berühmten Dichter«, erwähnte er irgendwann wie beiläufig.
»Jaja, Sir. Mister Rossiter. Der konnte wirklich schöne Reime verfassen, ja. Hat sie dann droben in London drucken lassen.«
»Er ist verstorben, habe ich gehört.«
»Ja, ist jetzt schon ein gutes Jahr her«, sagte der dicke Wirt kopfschüttelnd. »Hat sich eine Erkältung geholt und nicht mehr losgebracht. So richtig gesund und kräftig war er ja nie, wenn Sie wissen, was ich meine. Ein-, zweimal habe ich zu ihm gesagt, ›Sie sollten sich mal angewöhnen, dunkles Bier zu trinken, Mister Rossiter‹, hab ich gesagt. Aber meistens hat er nur Tee und Wasser getrunken, Bier überhaupt nie. Und da sehen Sie nun, was aus ihm geworden ist.«
Leander nahm einen kräftigen Schluck von seinem Ale, um zu beweisen, dass er nicht so dumm war. »In der Tat, aber vielleicht war es ja auch seine poetische Natur. Viele unserer Dichter hat der Tod ja eher früher geholt. Hat er denn eine Familie hinterlassen?«
»Kam aus London, wie ich gehört habe, Sir. Aber er hat ein Mädchen aus Hunstead geheiratet. Seine Frau und die Kinder wohnen noch immer im Dorf. Wenn Sie ihn kennen, dann kennen Sie auch sie. Weil er fast alle seine Gedichte seiner Judith gewidmet hat.«
»Ah ja.« Leander setzte eine sentimentale Miene auf. »›meine Engelsbraut‹!«
»Genau, Sir, genau!«, rief der Mann mit einem erfreuten Grinsen. »Kann ja nicht behaupten, dass ich selber viel für solche Verse übrig habe, aber das Weibsvolk mag sie nun mal gern.«
»Das war schon ein sehr anrührendes Gedicht. Wohnt die Lady hier in der Nähe? Ich würde sie gern einmal zu Gesicht bekommen.«
Der Wirt warf ihm einen Blick aus zusammengekniffenen Augen zu und zuckte die Achseln. »Sie scheint ziemlich bekannt zu sein. Es hat mich schon mal einer nach ihr gefragt.« Dann erklärte er Leander den Weg zum Haus der Frau. »Vielleicht möchten Sie ja auch Mister Rossiters Grab aufsuchen, Sir. Die Witwe hat ihm einen sehr ergreifenden Grabstein aufstellen lassen, muss man sagen.« Er beugte sich vertraulich zu Leander. »Hier in der Gegend wird sie die trauernde Witwe genannt, weil sie sich den Tod des Mannes doch sehr zu Herzen nimmt.«
Nun ja, warum nicht? Ein kluger Soldat erkundet erst das Terrain, bevor er zum Angriff übergeht. Leander bezahlte sein Ale, schaute nach seinem Pferd und spazierte dann in Richtung Kirche und Friedhof.
Die Kirche war uralt – er meinte angelsächsische Architektur zu erkennen –, der Friedhof mit mächtigen, ausladenden Bäumen und zahlreichen alten, moosbewachsenen und zum Teil schiefen Grabsteinen bestanden. Jenseits der Steinreihen fiel das Land zu demselben Fluss hin ab, der sich an den Gärten von Hartwell entlangschlängelte.
Er schlenderte auf der Suche nach dem Grab des Dichters durch den Friedhof. Es war noch neu und von auffallender Pracht und deshalb leicht zu finden. Auf diesem Friedhof wirkte es sogar ziemlich unpassend. Ein Engel, der weinend auf einem Podest saß, und an seinem – ihrem? – Knie zwei Cherubim.
Er las die Inschrift.
In liebendem Gedenken an
Sebastian Arthur Rossiter
Poet
geboren am 12. Mai 1770, gestorben am 3. Oktober 1814
Tief betrauert von seiner Ehefrau Judith
und seinen Kindern Bastian und Rosie
Er war also um einiges älter gewesen als seine Frau. Leander hatte den Eindruck gehabt, dass er ein junger Mann gewesen sei. Weiter unten war noch ein Gedicht eingraviert:
Wenn ich gegangen bin, Geliebte, sei gewiss,
dass jede Trän’ ich seh’n und achten werde.
In Himmelshöh’n, für immer treu, wart sehnsüchtig ich
auf meinen Engel an der Himmelspforte.
Offenbar hatte der Herr Poet seine Grabinschrift selbst verfasst. Leander hielt das für geschmacklos, morbid und selbstsüchtig; er bemerkte aber auch, dass das Grab mit frischen Blumen geschmückt war. Und er stellte seinen Plan infrage. Würde er sich am Ende einen Geist mit ins Ehebett legen?
Versunken in Gedanken über sein Vorhaben schlenderte er durch die Gräber den Hang hinunter zum Fluss, wo er müßig Steinchen ins seichte Wasser warf.
Er fragte sich, ob Judith Rossiter ihrem toten Gatten wirklich nachfolgen wollte; wie es wohl war, solch starken Kummer zu fühlen. Er hatte seine Eltern nicht betrauert, denn sein Vater war immer viel zu sehr von seiner Arbeit in Beschlag genommen gewesen, um Zuneigung hervorrufen zu können, und seine Mutter war zu sehr von seinem Vater in Beschlag genommen gewesen. Er hatte um einige gefallene Waffenbrüder getrauert, dabei aber auch einen verdammt starken Wunsch gespürt, deren Schicksal zu teilen.
Wenn dieses elende Klammern eine Konsequenz von Liebe war, dann war er ohne Liebe tatsächlich besser daran.
Doch dann kamen ihm plötzlich Lucien und Beth in den Sinn. Sie hatten ihn willkommen geheißen, und er hatte sich bei ihnen wohlgefühlt – obwohl er das Band zwischen ihnen mit aller Macht gespürt hatte. Sie stritten sich – was angesichts Luciens blaublütiger Arroganz und Beths egalitären Prinzipien kein Wunder war –, aber sie hielten auf eine Weise zusammen, der geringfügige Unstimmigkeiten absolut nichts anhaben konnten.
Das, vermutete er, war Liebe. Aber er konnte sich nicht vorstellen, dass, falls einer von beiden starb, der andere wünschen würde, ihn oder sie möglichst bald im Jenseits wiederzusehen. Es würde die Hölle sein, mit einer Frau zu leben, die nur daran dachte, ihrem ersten Mann ins Grab nachzufolgen. Er lachte über seine groteske Situation. Es sah aus, als habe er lediglich die Wahl zwischen einer Frau, die aus exzessiver Ergebenheit an seiner Seite schmachtete, oder einer, die dasselbe aus exzessivem Kummer tat.
Wien wäre in der Tat eine ungleich vernünftigere Alternative gewesen …
Er hörte Kinder lachen, drehte sich um, gerade als sie zwischen den Grabsteinen in Sicht kamen, und sah, wie sie den Hang hinunterliefen. Er vermutete, dass es die Rossiter-Kinder waren. Sie blieben kurz stehen, doch dann kamen sie auf ihn zu – verwundert über einen Fremden, aber ohne Furcht.
Sie schienen sich jedoch nicht sicher zu sein, ob sie ihn ansprechen sollten, und so ergriff er die Initiative. »Guten Tag. Wohnt ihr hier in der Nähe?«
Der Junge verbeugte sich leicht. »Ja, Sir. Im Dorf.« Er war hübsch, mit dunklen Locken und von einem Selbstvertrauen, das ihn attraktiv wirken ließ.
»Ich bin zu Gast beim Marquis of Arden«, empfahl sich Leander. »Er hat ein Anwesen ein Stück den Fluss hinunter, wie ihr sicherlich wisst. Mein Name ist Charrington. Lord Charrington.«
Der Junge verbeugte sich erneut. »Sehr erfreut, Mylord. Ich bin Bastian Rossiter, und das ist meine Schwester Rosie.«
Sie waren es tatsächlich. War dies ein Zeichen der Götter?
Die Kleine, sie hatte bezaubernde blaue Augen und flachsblondes, seidiges Haar, das ihr auf die Schultern fiel, richtete sich groß auf. »Rosetta«, erklärte sie bestimmt.
Ihr Bruder stöhnte, doch Leander verbeugte sich ganz korrekt vor ihr. »Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Rosetta Rossiter.«
Sie erwiderte seine Ehrerbietung mit einem Knicks und einem Grinsen, das zwei charmante Grübchen zeigte.
Als Leander aufblickte, stellte er fest, dass auch die Mutter der beiden hier war. Ihre Miene war indifferent, doch ihr Blick aus großen blauen Augen – wie die ihrer Tochter, dachte er, aber durch dichte Wimpern wirkten sie noch feiner – verriet Vorsicht. Und sie wirkte nicht wie von Kummer gebeugt, Gott sei Dank. Nein, sie sah gesund und munter aus und sie war ein Bild von einer Frau. Er blickte bedeutungsvoll zu Bastian, und der Junge verstand seinen Wink sofort.
»Mama, darf ich dir Lord Charrington vorstellen? Er wohnt in Hartwell. Sir, dies ist meine Mutter, Mrs. Rossiter.« Er schaute eifrig bemüht zwischen beiden hin und her. »Habe ich das richtig gemacht?«
»Perfekt«, antwortete Leander und erhielt dafür einen warmherzigen Blick von der Witwe. Sie reichte ihm ihre in einem schwarzen Handschuh steckende Hand. »Mylord.«
Er ergriff sie und machte geistig eine rasche Bestandsaufnahme. Sie war überdurchschnittlich groß, sodass ihre schönen Augen fast auf gleicher Höhe mit den seinen waren. Ihr dunkles Haar war im Moment fest unter einem schlichten, schwarzen Bonnet zusammengefasst. Bis auf die Augen war ihr Gesicht nicht ungewöhnlich, abgesehen von einer angedeuteten Rundung der Wangen. Er vermutete, wenn sie jemals lächelte, würde auch sie Grübchen bekommen. Diese Rundung und ihre Augen verliehen ihr einen Eindruck von Jugendlichkeit, um den die meisten Frauen sie wohl beneideten.
Vielleicht war es diese Illusion von Jugend, die ihm plötzlich das Gefühl eines Beschützers oder das eines fahrenden Ritters gab, der gekommen war, das Burgfräulein zu erretten. Er fühlte sich zu ihr hingezogen. Er hätte überhaupt nichts dagegen gehabt, sie sofort zur Frau zu nehmen. Sollte er die Gunst des Augenblicks nutzen?
Wenn er etwas erreichen wollte, musste er sie in ein Gespräch verwickeln. Und der leichteste Beginn war vermutlich ein Bezug auf den geliebten Verblichenen. »Wenn ich es mir herausnehmen darf«, sagte er, »dann würde ich vermuten, dass Sie mit Mister Rossiter, dem Dichter, in Beziehung stehen.«
»Das ist richtig«, erwiderte sie ohne eine besondere Herzenswärme, die Aufmerksamkeit größtenteils auf ihre Kinder gerichtet. »Ich bin seine Witwe.«
»Welch trauriger Verlust. Mein aufrichtiges Beileid.«
»Danke schön.«
Dieses Thema begeisterte sie ganz eindeutig nicht. Die Kinder waren vorausgelaufen, um seichte Stellen im Fluss zu erforschen, und sie folgte ihnen.
Leander schritt neben ihr her. Es war erfrischend, dass sie beim ersten Kontakt nicht mit Erröten oder affektiertem Lächeln reagierte, doch er stellte fest, dass er zum ersten Mal in seinem Leben um Worte verlegen war. »Dies ist ein wunderschöner Friedhof, um darin die letzte Ruhe zu finden.«
Sie blickte ihm ins Gesicht. »Es ist in der Tat ein sehr schöner Ort, Mylord, wenngleich ich keinen Grund, weder sentimentaler noch spiritueller Art, sehen kann, weshalb sich die Toten um so etwas kümmern sollten.«
Sie ging weiter. Leander erkannte, dass er sich selbst zum Narren machte. Mochte der Kummer dieser Witwe auch noch so tief sein, auf die sentimentale Tour war an sie nicht heranzukommen. Einen Moment lang ärgerte er sich über die absurde Situation, in der er sich befand, doch dann lächelte er und rückte den schrägen Sitz seines eleganten Zylinders zurecht.
Mit ihrem unterkühlten Benehmen hatte die Lady den letzten Test bestanden. Er fand nichts an ihr, was zu beanstanden gewesen wäre.
Jetzt war es wohl das Klügste, einen ganz konventionellen Weg dafür zu finden, um ihre Hand anzuhalten, doch das konnte sich als schwierig erweisen. Beth hatte ihm erzählt, dass sich die Witwe nicht am gesellschaftlichen Leben beteiligte und kaum Freizeit hatte. Er wollte, dass dies alles geklärt wurde, damit er seine Pläne weiterverfolgen konnte. Er konnte sich nicht monatelang hier in Surrey aufhalten.
Warum also sein Anliegen nicht einfach dringlich machen? Schließlich hatte er es auch fertiggebracht, den Herzog von Braunschweig versöhnlich zu stimmen, nachdem er von einem der geringeren Bourbonen beleidigt worden war und mit dem Gedanken spielte, seinen Staat hinter Napoleon zu stellen. Eine mittellose Witwe zu überreden, Gräfin zu werden, sollte für ihn also ein Kinderspiel sein.
Dennoch zögerte er.
Er zögerte, wie er erkannte, weil ihm das Resultat etwas bedeutete. Diese ruhige, gefasste Frau hatte etwas an sich, das in ihm den Wunsch erweckte, sie besser kennenzulernen und ihr Leben zu erleichtern. Und er fühlte sich zu ihren Kindern hingezogen.
Guter Gott, er wollte sie tatsächlich heiraten!
Sie hielt an und schaute zu ihm zurück, ganz offenbar über sein Verhalten verwundert. Ein kleines Lächeln spielte um ihre Lippen. »Sollte ich mich entschuldigen, Mylord? Ich fürchte fast, ich habe Sie schockiert.«
In ihrem Gesicht war eine leise Andeutung von Grübchen zu erkennen.
Sie bezog sich auf ihre Bemerkung über die Toten. Er trat vor sie. »Nein«, sagte er, »aber ich fürchte, ich bin im Begriff, Sie zu schockieren.«
Vorsicht flackerte in ihrem Blick auf; sie schaute kurz zu ihren Kindern und ging auf sie zu.
»Bitte«, fuhr er rasch fort, »ich werde nichts tun, was Sie nicht wollen … Du lieber Himmel! Würden Sie glauben, dass man mir eine goldene Zukunft als Diplomat bescheinigt hat?«
Ihre Anspannung ließ etwas nach, und ihre Lippen zuckten. Die Grübchen wurden kurz wieder sichtbar. Er spürte einen starken Wunsch, sie in all ihrer Schönheit zu sehen.
»Im Augenblick nicht, nein«, antwortete sie. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mylord?«
Er nahm sich zusammen und schenkte ihr sein schönstes Lächeln. »Ja, das könnten Sie in der Tat. Ich möchte mit Ihnen darüber reden. Ich sehe dort drüben einen Stein, auf dem man gut sitzen könnte, falls es Ihnen nicht zu kalt ist.«
Nach einem fast unmerklichen Zögern ging sie darauf zu. »Ganz und gar nicht. Ich sitze hier oft, wenn die Kinder spielen. Sie nennen ihn meinen Thron.«
Sie nahm auf dem Granitblock Platz und raffte ihre schwarzen Bombassin-Röcke ordentlich zusammen. Mit ihrer Erlaubnis setzte er sich zu ihr. Es war nicht viel Platz, doch sie erhob keinen albernen Protest darüber, dass sie so nahe nebeneinandersaßen. Er mochte sie mit jedem Augenblick mehr.
Mit erwartungsvoller Miene wandte sie sich ihm zu.
»Sie werden das etwas eigenartig finden …«
»Und sogar schockierend«, fügte sie spöttisch hinzu.
Humor hatte sie also auch noch. »Das, hoffe ich allerdings, nicht allzu sehr.« Er wusste noch immer nicht recht, wie er das Thema eröffnen sollte.
Ihr Blick verriet eindeutig Belustigung. »Ich werde wahrscheinlich so sehr von meiner Neugier überwältigt, Mylord, dass ich gleich einen Schwächeanfall bekommen und Sie zu Tode erschrecken werde. Haben Sie bitte Mitleid mit mir.«
Er lachte. »Eine der ersten Lektionen eines jungen Diplomaten, Mrs. Rossiter, ist, wie er mit einer Lady umgehen muss, die einen Schwächeanfall erlitten hat.« Doch er konnte sich diese Frau in einem derartigen Zustand nicht einmal vorstellen. Einen Augenblick lang fragte er sich, ob er die falsche Person vor sich hatte und am Ende im Begriff war, der Gattin des Vikars oder sonst einer Frau einen Heiratsantrag zu machen. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass sie erklärt hatte, die Witwe des Dichters zu sein.
Er fasste sich ein Herz. »Trotz meiner diplomatischen Erfahrung, Mrs. Rossiter, weiß ich wirklich nicht recht, wie ich mein Anliegen für mich vorteilhaft vorbringen könnte.« Er bemühte sich sehr um eine Miene voller Ernst und Würde. »Die simple Wahrheit ist, dass ich Sie heiraten möchte.«
Sie erbleichte. In der nächsten Sekunde war sie aufgefahren und hatte den Blick abgewandt. »Du lieber Himmel!«, stieß sie hervor. Es klang nach unverfälschter Empörung.
Mit einer solchen Reaktion hatte Leander nicht gerechnet. Auch er stand rasch auf. »Vielleicht bin ich zu überstürzt«, erklärte er angespannt, »aber es ist ein ehrliches Angebot, Ma’am.«
Sie wandte sich ihm zu, ihre Augen blitzten vor Zorn. »Ehrlich! Obwohl Sie über die Frau, der Sie einen Heiratsantrag machen, absolut nichts wissen?«
»Ich weiß genug.«
»Ach, wirklich? Ich wüsste nicht woher. Nun, aber dann weiß ich auch genug. Die Antwort, Sir, ist Nein!«
Sie entfernte sich. Leander eilte ihr nach; er fühlte sich mehr wie ein unreifer Junge als damals, mit sechzehn, als er versucht hatte, eine Tochter des Herzogs von Ferrugino zu küssen, und dafür eine ordentliche Ohrfeige kassierte. Wenn die Rogues dies je erfahren sollten, würden sie sich kugeln vor Lachen.
Er holte sie ein. »Mrs. Rossiter. Bitte hören Sie mich an! Ich kann Ihnen sehr vieles bieten!«
Sie wirbelte inmitten rauschender schwarzer Röcke herum und hielt das Gesicht so nah an das seine, dass sich ihre Nasen beinahe berührten. »Nennen Sie mir nur einen. Und nein, ich will nicht noch eine Ode an meine wunderschönen Augen zu hören bekommen!«
Er starrte sie fassungslos an. Diese wunderschönen Augen waren so von Wut erfüllt, dass er versucht war, es zu probieren. Doch stattdessen sagte er: »Ist ja gut. Ich wüsste nicht, wie ich so etwas anfangen sollte.«
Sie trat einen Schritt zurück. »Sie sind kein Dichter?«
Er bot ihr seine Hand. »Diplomat. Linguist. Soldat. Graf. Ich verfasse keine Oden über irgendetwas, darauf haben sie mein Wort.«
»Graf?«, fragte sie verwirrt.
Er verbeugte sich und glaubte, nun endlich doch noch punkten zu können. »Leander Knollis, zu Ihren Diensten, Ma’am. Earl of Charrington, von Temple Knollis in Somerset.«
»Temple Knollis?«, fragte sie mit schwacher Stimme und ließ damit die ihm nur allzu geläufige Ehrerbietung erkennen. Doch im Augenblick war er bereit, jeden Vorteil aufzugreifen, an den er kommen konnte.
»Jawohl. Ich habe ferner ein Haus in London und eine Jagdhütte. Ein Anwesen in Sussex und einen Besitz in Cumberland, den ich aber noch nie gesehen habe.« Du lieber Himmel, dachte er bei sich. Ich klinge wie der dümmste Emporkömmling, so wie ich meine Besitztümer hier aufliste!
Offenbar hatte sie so ziemlich den gleichen Gedanken. Ihre Wangen waren kräftig gerötet. »Ich weiß nicht, was Sie für ein Spiel betreiben, Sir, aber ich halte es für unverschämt von Ihnen, dass Sie sich auf meine Kosten amüsieren. Bastian! Rosie!«, rief sie. »Kommt sofort! Wir müssen gehen!«
Die Kinder kamen angerannt. Bastian warf einen Blick auf seine Mutter und wandte sich dann mit streitbarer Miene Leander zu.
Der trat zurück. »Kämpfe nicht mit mir, mein Junge. Ich müsste dich gewinnen lassen, oder deine Mutter wird mich niemals heiraten.«
Die Kinder schauten sie beide mit großen Augen an.
Judith Rossiter jedoch starrte mit einem Blick so voller Wut auf ihn, als wollte sie sich am liebsten selbst mit ihm prügeln. Er sah, dass ihre Hände zu Fäusten geballt waren. »Einen guten Tag!«, herrschte sie ihn an und stürmte dann den Hang hinauf, ihre Kinder im Gefolge. Die drei wirkten wie ein Kriegsschiff mit seinen Beibooten; Leander konnte sich lebhaft vorstellen, dass Judith Rossiter jeden Augenblick beidrehen und ihn mit einer Breitseite ins Jenseits befördern könnte.
Er beobachtete, wie sie sich entfernten, und fragte sich geknickt, was ihn dazu getrieben hatte, die Sache so falsch anzupacken.