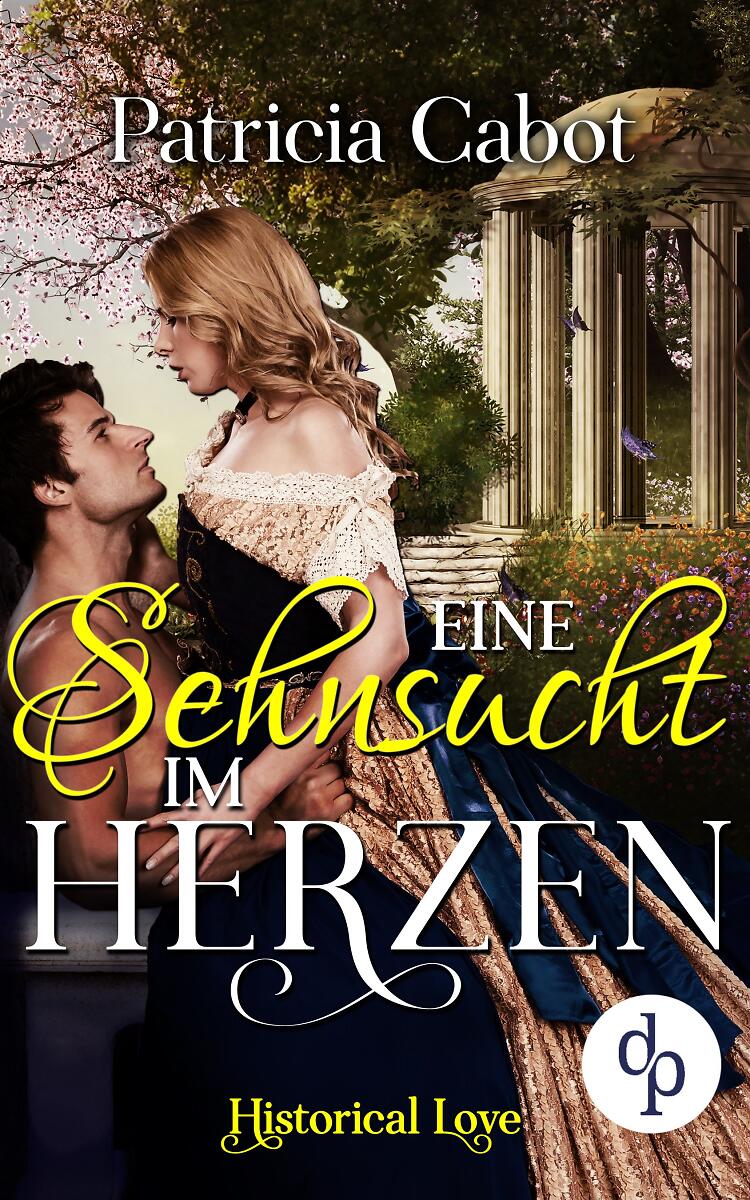Prolog
London, Mai 1832
Er kam zu spät.
Das sah ihm nicht ähnlich. Der Earl von Denham kam niemals zu spät. Seine mit Smaragden besetzte goldene Taschenuhr, im vergangenen Jahr in Zürich zu einem, wie Emma vermutete, fürstlichen Preis erworben, ging auf die Minute genau. Er stellte sie nach den Zeigern der großen Uhr von Westminster, und diese Zeiger gaben weiß Gott immer die richtige Zeit an.
Außerdem ging der Earl von Denham nach dem Tee regelmäßig in seine Bibliothek, um sich zu vergewissern, ob Nachrichten für ihn eingetroffen waren.
Wo steckte er bloß?
Wenn sich James verspätete, dann nur deshalb, weil jemand seinen festen Tagesablauf unterbrochen hatte. Und Emma hatte nicht den leisesten Zweifel, wer dieser Jemand sein konnte.
Schön und gut für Penelope. Sollte sie sich dem Earl ruhig an den Hals werfen, wenn es ihr gefiel. Heute Morgen beim Frühstück hatte Penelope Emma anvertraut, dass sie die Absicht habe, noch an diesem Tag ihr Glück zu versuchen.
»Und wenn er im Moment noch nicht ans Heiraten denkt, werde ich ihm den Gedanken eben in den Kopf setzen«, hatte Penelope ihr zugeraunt, während sich ihre Eltern, Emmas Onkel und Tante, über ihr Rührei beugten. Die beiden litten an Kopfschmerzen, da sie dem Champagner am Vorabend bei Lady Ashforths Ball zu kräftig zugesprochen hatten. »Verlass dich darauf«, hatte Penelope hinzugefügt.
Emma zweifelte nicht daran, dass Penelope imstande war, jeden Mann dazu zu bringen, ans Heiraten zu denken. Schließlich war ihre Cousine mit Schönheit gesegnet. Nicht, dass Emma unansehnlich gewesen wäre. Nein, sie wusste, dass auch sie hübsch war … zumindest passabel.
Aber Penelope hatte schwarzes glattes Haar, die Glückliche, und die funkelnden dunklen Augen einer Spanierin, während Emma mit ganz gewöhnlichen blauen Augen und blondem Haar gestraft war, das sich hartnäckig weigerte, sich glätten zu lassen. Es kräuselte sich ungebärdig und wirkte dadurch um einiges kürzer, als es tatsächlich war. Abgesehen davon war Penelope mit ihren eins siebzig im Gegensatz zu Emma, die mit ihrer Größe bei knapp eins fünfundfünfzig lag, eine wirklich eindrucksvolle Erscheinung. Kein Wunder also, dass die schmächtige Emma in der Familie immer noch als Baby angesehen wurde. Sie sah aus wie eine Puppe und wurde auch so behandelt.
Aber bald nicht mehr. Nach heute nicht mehr. Nicht, nachdem sie James mitgeteilt hatte, was sie ihm mitteilen musste.
Sie verübelte es Penelope nicht, dass sie vorhatte, sich den Earl zu schnappen. Ganz und gar nicht. Emma hatte durchaus Verständnis für diesen Wunsch. James Marbury, dunkel und attraktiv und noch dazu schwer reich, war einer der begehrtesten Junggesellen von ganz London. Für die Damen der ersten Kreise war es geradezu ein Ärgernis, dass es ihm bisher gelungen war, dem Ehejoch zu entkommen.
Aber lange würde er seine Freiheit nicht mehr genießen, davon war Emma überzeugt. Nicht, nachdem Penelope es sich in den Kopf gesetzt hatte, Lady Denham zu werden. Kein Mann, nicht einmal ein so überzeugter Junggeselle wie der Earl von Denham, konnte Penelope Van Courts Reizen widerstehen.
Emma wünschte nur, ihre Cousine würde sich damit beeilen, diese Reize spielen zu lassen. Es musste einen recht eigenartigen Eindruck machen, dass sich beide Cousinen so kurz, nachdem der Earl selbst gegangen war, auch aus dem Salon von Lady Denham, der Gräfinwitwe, zurückgezogen hatten. Emma fragte sich, ob sich Stuart und seine Tante, Lady Denham, wohl vernachlässigt fühlten. Nun, Stuart würde ihr sicher verzeihen, wenn er das Ergebnis ihrer Unterredung erfuhr … ein sensationelles Ergebnis, davon war sie überzeugt.
In diesem Moment öffnete sich die Tür zur Bibliothek des Earls von Denham. Emma sprang von dem Diwan auf, auf den sie sich gesetzt hatte, und glättete die schimmernde blaue Seide ihres Kleides. Seltsam, aber bis jetzt war sie wegen der bevorstehenden Unterredung nicht nervös gewesen, kein bisschen. Warum auch? Zugegeben, wenn sie mit James über ihre Pläne sprach, handelte sie in krassem Widerspruch zu Stuarts Wünschen …
Emma hatte das Gefühl, dass Stuart nicht ganz gerecht war, wenn es um James ging. Stuart fand, dass sein Cousin James, so sehr er ihn auch mochte, ein Verschwender und ein Zyniker war. Und es traf zu, dass der Earl Unsummen seines märchenhaften Vermögens für Dinge wie Schweizer Taschenuhren und den einen oder anderen Vollblüter ausgab.
Aber es war James’ Geld, er konnte damit machen, was er wollte. Und er öffnete seine Börse stets bereitwillig, wenn Emma ihn um Spenden für einen der vielen wohltätigen Zwecke bat, denen sie ihre Zeit widmete. Oh, natürlich beklagte er sich … aber nur im Scherz. Emma hatte die Bibliothek des Earls von Denham noch nie mit leeren Händen verlassen.
Und es ließ sich nicht leugnen, dass James mehr als großzügig war, was seine Verwandten anging. Seine Mutter lebte in größtem Luxus in seinem Stadthaus in Mayfair, und seinem verwaisten Cousin Stuart hatte er nichts als Wohltaten bewiesen, indem er Stuart, auf dessen eigenen Wunsch hin, eine Ausbildung als Geistlichen ermöglicht und ihn in jeder Beziehung so behandelt hatte, als wären sie Brüder und nicht nur Cousins.
Angesichts dieser Großzügigkeit musste Emma einfach der Meinung sein, dass das, was Stuart plante, falsch war. James würde schrecklich verletzt sein, von seiner Mutter ganz zu schweigen. Und was war mit Penelope und ihren Eltern? Emma schuldete ihrem Onkel und ihrer Tante sehr viel. Es war besser – viel besser – , alles so zu machen, wie es sich gehörte, offen und ehrlich, damit sich niemand hintergangen fühlte.
Und das würde Emma Stuart beweisen, indem sie persönlich mit James sprach. Wenn er erst einmal sah, wie begeistert sein Cousin die Idee aufnahm – und Emma zweifelte nicht daran, dass James das, was sie ihm zu sagen hatte, im richtigen Licht sehen würde – würde Stuart zur Besinnung kommen und sich angemessen verhalten.
Als sie allerdings den Ton des Earls hörte, der gerade mit jemandem sprach, der noch hinter der Bibliothekstür auf dem Flur stand, war sie sich nicht sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt war, dieses spezielle Thema mit James zu erörtern.
»Ja, das ist alles höchst interessant, Miss Van Court«, sagte James, wobei er, wie Emma feststellte, nicht einmal den Versuch machte, die Ungeduld in seiner tiefen Stimme zu unterdrücken, »aber ich muss mich jetzt leider um wichtige Angelegenheiten kümmern. Wenn Sie mich also bitte entschuldigen würden …«
»Ja, aber«, hörte Emma ihre Cousine Penelope sagen, »es ist wirklich schrecklich wichtig, dass ich mit Ihnen spreche, Mylord. Wenn ich nur …«
»Vielleicht ein anderes Mal, Miss Van Court«, sagte der Earl, und als Nächstes war er allein im Raum mit Emma und schloss erleichtert die Tür hinter sich.
Die Erleichterung wich allerdings rasch Verwirrung, als er Emma auf einmal bemerkte, die mit ergeben gefalteten Händen in seiner Bibliothek vor ihm stand.
»Oh, Lord Denham«, sagte sie nervöser denn je. »Verzeihen Sie bitte. Ich wollte kurz mit Ihnen sprechen, aber wie ich sehe, ist jetzt vielleicht nicht der beste Augenblick …«
Was für eine Untertreibung! Emma hegte keinerlei Zweifel, dass sich Penelope nach dieser schroffen Abfuhr in die nächste Wäschekammer geflüchtet hatte, wo sie sich schon als Kinder oft versteckt hatten, um sich ungestört die Augen ausweinen zu können. Es würde schwer werden, sie zu trösten, das wusste Emma. Und sie mussten heute Abend noch auf den Ball bei Lord und Lady Chittenhouse. Penelope würde sich bestimmt nicht rechtzeitig beruhigen.
Aber Lord Denham, der über Emmas unerwartete Anwesenheit in seiner Bibliothek keineswegs verärgert schien, wandte sich lediglich mit einem Schulterzucken, als müsste er etwas Unangenehmes abschütteln, von der geschlossenen Tür ab und sagte lächelnd: »Ein Besuch von Ihnen, Emma, kommt nie ungelegen. Welchem Umstand verdanke ich das Vergnügen dieses Mal? Dem Damenzirkel zur Obsorge des Wohlergehens weiblicher Insassen in Newgate? Oder ist es wieder einmal die christliche Mission?«
»Oh«, sagte Emma, als James hinter seinem Schreibtisch aus massivem Mahagoni Platz nahm und nach Feder und Papier griff, um seinen Sekretär schriftlich aufzufordern, einen Scheck auszustellen. »Weder noch, ehrlich gesagt.«
James blickte überrascht auf. »Weder noch? Erzählen Sie mir nicht, dass Sie noch einem Wohltätigkeitsverein beigetreten sind, Emma! Sie sollten nicht all diesen Leuten erlauben, an Ihr weiches Herz zu appellieren. Gute Menschen wie Sie werden leicht ausgenutzt und letzten Endes aufgerieben, glauben Sie mir.«
»Diesmal geht es nicht um einen wohltätigen Zweck, Mylord«, sagte Emma, die das Gefühl hatte, dass ihr irgendetwas die Kehle zuschnürte. Sie räusperte sich. Es würde wirklich nicht so leicht werden, wie sie es sich vorgestellt hatte. Bei all ihren Plänen hatte sie die Augen des Earls vergessen, Augen, die veränderlich waren und je nach Licht goldbraun oder sogar grünlich wirkten. Aber welche Farbe sie auch zeigten, der Ausdruck blieb immer derselbe, eindringlich … und manchmal bohrend. Emma, die alles verlor, was sie zuvor an Mut besessen haben mochte, stand mit schlaff herabhängenden Armen vor dem Schreibtisch.
Der Earl, dem dieser Umstand nicht entging, legte die Feder nieder, lehnte sich in seinem Sessel zurück und sagte: »Na schön, Emma. Raus mit der Sprache. Was haben Sie angestellt?«
»Ich?«, rief Emma entsetzt. Wirklich, es machte sie rasend, dass sie so reagierte, als wäre sie ein schuldbewusstes Kind. Schließlich war er nicht ihr Vormund. Die Tatsache, dass Regina Van Court, die Emma großgezogen hatte, und Lady Denham eng befreundet waren, machte sie nicht zu Familienangehörigen. Sie waren nicht miteinander verwandt – noch nicht, zumindest. Aber Emma war sicher, dass es der größte Wunsch der beiden Damen war, ihre Familien eines Tages durch eine Heirat verbunden zu sehen.
Was sie nicht wussten, war, dass dieser Tag praktisch bevorstand. Leider jedoch waren es die falschen Sprösslinge, die vor den Altar treten wollten.
»Ich habe überhaupt nichts angestellt«, beeilte sie sich, zu erklären. »Wirklich nicht. Es … es geht eigentlich um Stuart.«
»Stuart?« James zog eine seiner dunklen Augenbrauen hoch. Der Earl hatte in vielerlei Hinsicht, von der Finanzierung von Stuarts Ausbildung bis zu großzügigen Spenden für Stuarts wohltätige Zwecke, bewiesen, dass ihm sein Cousin am Herzen lag … aber das hieß nicht, dass er immer einer Meinung mit ihm war, genauso, wie Stuart nicht immer mit dem Earl einverstanden war. Ganz im Gegenteil, um genau zu sein. Stuart schaffte es immer wieder, James zu reizen, der die Lebensphilosophie seines jüngeren Cousins nicht verstand und noch weniger billigte. Es sei schön und gut, wie James oft bemerkte, den Armen zu helfen. Aber wäre es nicht besser, den Armen zu helfen, sich selbst zu helfen?
Stuart war der Überzeugung, genau das zu tun, wenn er die Armen in ihrem Glauben an Gott stärkte. James hingegen neigte zu der Ansicht – aus der er keinen Hehl machte – dass die Armen wesentlich mehr von Unterweisungen in Hygiene und Familienplanung sowie soliden finanziellen Investitionen profitieren würden. Eine Seele mit leerem Magen sei schwer zu ernähren, fand er.
»Falls es um seinen hirnrissigen Plan geht«, fuhr James streng fort, »die Stelle eines Hilfsgeistlichen in der Einöde der Shetlands anzunehmen, lassen Sie es sich von mir gesagt sein, Emma, dass auch die charmantesten Bitten Ihrerseits mich in diesem Punkt nicht umstimmen werden. Es ist schlicht und einfach Wahnsinn. Ich habe nicht all das Geld für ein Studium in Oxford ausgegeben, damit er seine Ausbildung an ein Pack bedürftiger Schotten wegwirft. Er wird hier in London eine Stelle als Kaplan antreten oder vielleicht sogar die Pfarrei in Denham Abbey übernehmen, wenn er weiß, was gut für ihn ist. Wenn nicht, nun, ich kann ihn natürlich nicht aufhalten, genauso wenig, wie ich ihn daran hindern kann, von der Church of England zur Church of Scotland überzuwechseln. Aber ich kann ihm die Sache durchaus erschweren, indem ich es ablehne, seine Absichten zu finanzieren. Soll er ruhig sehen, wie man von den Einkünften eines Kaplans lebt. Innerhalb eines Monats ist er wieder da, glauben Sie mir!«
Emma ärgerte sich zwar über diese großspurigen Töne, schluckte aber die scharfen Worte hinunter, die ihr auf der Zunge brannten, als sie ihren Liebsten so geschmäht hörte. Ihr war klar, dass es zu nichts führen konnte, zu diesem Zeitpunkt einen Streit mit dem Wohltäter ihres zukünftigen Ehemannes anzufangen.
»Darum geht es nicht«, sagte Emma. »Es geht um … na ja…«
Sie brach ab und fragte sich, ob Stuart nicht vielleicht recht gehabt hatte, als er sie davor warnte, die Angelegenheit mit James zu erörtern. Sein Cousin schien dem Shetland-Projekt nicht sehr wohlwollend gegenüberzustehen und es war wenig wahrscheinlich, dass er für den Teil, den sie ihm erläutern wollte, empfänglicher sein würde.
Andererseits war James immer sehr nett zu ihr gewesen, und nicht erst seit damals, als sie im zarten Alter von vier Jahren beide Eltern verlor und von den Van Courts aufgenommen wurde. James war ihr mit seinem vorgerückten Alter von vierzehn Jahren sehr klug vorgekommen, als er ihr den brüderlichen Rat gab, den Bienen, die sie so gern streicheln wollte, lieber aus dem Weg zu gehen. James war ihr so weise erschienen wie Stuart, der nur sechs Jahre älter war, als sie und düster und unzugänglich wirkte, romantisch.
Aber auch in jüngerer Zeit war James auffallend freundlich zu ihr gewesen. Seit sie ihr Debüt in der Gesellschaft gegeben hatte und ihre erste Saison in London genoss, hatte James sie nie so behandelt, als wäre sie ein junges Ding, das gerade aus dem Schulzimmer entlassen worden war – nun ja, zumindest nicht sehr oft – , und das war mehr, als man von den meisten Mitgliedern ihrer eigenen Familie sagen konnte. Wann immer auf einem Ball Mangel an Tanzpartnern herrschte, wie es gelegentlich vorkam, konnte sie sich darauf verlassen, mindestens einmal vom Earl von Denham aufgefordert zu werden.
Und wenn sie wegen James’ Cousin Stuart Liebeskummer hatte – was manchmal der Fall war, vor allem, wenn Stuart kaum zu merken schien, dass sie existierte – , zog James sie deshalb nie auf. Zugegeben, er schien nicht übermäßig entzückt zu sein, als sie ihm anvertraute, wie sehr sie Stuart verehrte, aber er hatte den beiden auch nicht verboten, einander zu sehen. Er schien das, was er Emmas ›Schwärmerei‹ für seinen Cousin nannte, eher amüsant zu finden.
Sie bezweifelte allerdings, dass ihm aufgefallen war, welche Ergebnisse seine Duldsamkeit gezeitigt hatte.
Trotzdem hoffte sie, er würde sich freuen. Natürlich würde er sich freuen. Es war nicht recht von Stuart, seinen Cousin so falsch einzuschätzen. James war ein sehr großzügiger Mensch und hatte ein gutes Herz. Es war nur nicht immer sichtbar, dieses Herz … wie zum Beispiel eben im Flur bei der armen Penelope. Aber das bedeutete nicht, dass es nicht vorhanden war.
»Stuart und ich …« Emma schluckte schwer. Bitte. Sie hatte es beinahe herausgebracht. Komisch, dass es so viel schwieriger war, als sie gedacht hatte. Sie hatte immer gefunden, dass man sehr gut mit James reden konnte und dass er keineswegs das Ungeheuer war, das Stuart häufig aus ihm machte. Wie konnte er ein Ungeheuer sein, wenn er trotz seiner Ansichten über die Kirche – in seinen Augen dummes Zeug – Stuarts Ausbildung zum Geistlichen bezahlte? Er hätte durchaus darauf bestehen können, dass sein Cousin stattdessen Jura studierte. Aber das hatte er nicht getan.
Nein, Stuart irrte sich. Hunde, die bellen, beißen nicht, das galt für James. Er würde die Neuigkeit, die Emma ihm mitzuteilen hatte, freudig begrüßen. Freudig deshalb, weil ihre beiden Familien dadurch endlich verbunden wären. Das würde seine Mutter glücklich machen. Und es gab nichts, was James nicht tun würde, um seine Mutter glücklich zu machen.
Außer natürlich zu heiraten, bevor er voll und ganz dazu bereit war. Was, wie es im Moment schien, möglicherweise erst der Fall sein würde, wenn er die vierzig überschritten hatte, eine bittere Pille für so manche Dame der Gesellschaft, die heiratsfähige Töchter unter die Haube zu bringen hatte.
»Stuart und Sie?«, wiederholte James – ziemlich frostig, wie Emma fand.
»Stuart und ich«, platzte Emma heraus, um es endlich hinter sich zu bringen, »wollen heiraten. Und Sie müssen unbedingt mit ihm reden, Mylord, weil er nämlich die absurde Vorstellung hat, dass Sie es nicht erlauben werden und wir beide durchbrennen müssen. Ich habe ihm gesagt, dass Sie nicht die geringsten Einwände haben werden, aber Sie wissen ja, wie eigensinnig er sein kann. Und ich hatte gehofft … also, ich hatte gehofft, Sie könnten mit ihm reden. Ich wünsche mir nämlich eine richtige Hochzeit, wissen Sie, mit Ihnen und Penny, Tante Regina und Ihrer Mutter und allen anderen. Könnten Sie nicht mit Stuart sprechen, Mylord? Ich wäre Ihnen sehr dankbar.«
Da. Es war heraus. Es war ausgesprochen und jetzt würde alles gut werden. James würde die Sache in die Hand nehmen, und zwar genauso geschickt und erfolgreich, wie er sich um alles andere kümmerte. Emma hatte noch nie ein Problem gehabt, das James Marbury nicht hätte lösen können. Probleme mit ihrer Schularbeit? James war zur Stelle, um ihr zu helfen. Probleme mit dem Besitzer einer Halle, die sie für eine Wohltätigkeitsveranstaltung mieten wollte? James wurde mit einem einzigen, sorgfältig abgefassten Brief damit fertig.
James machte immer alles gut. Oh, er schimpfte natürlich jedes Mal, aber letzten Endes löste er jedes Problem. Immer. Bei diesem Gedanken fühlte sich Emma gleich besser. Aber nur so lange, bis sie einen Blick auf das Gesicht des Earls warf.
»Heiraten?«, wiederholte James in einem Ton, der, wie sie bestürzt feststellen musste, nicht sehr freundlich klang. »Was soll der Unsinn? Heiraten? Das kann nicht Ihr Ernst sein, Emma.«
Emma blinzelte. »Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mylord«, sagte sie leicht indigniert. »Aber das ist ganz gewiss mein Ernst.«
»Aber … aber Sie sind viel zu jung, um zu heiraten«, erklärte der Earl. »Sie sind noch ein Kind!«
»Wohl kaum, Mylord! Ich bin vor kurzem achtzehn geworden. Sie waren letzten Monat bei meiner Geburtstagsfeier, wissen Sie noch?«
»Achtzehn?« James schien zum ersten Mal, seit sie ihn kannte, um Worte verlegen. »Achtzehn ist immer noch viel zu jung, um zu heiraten. Stuart heiraten? Jetzt? Wissen Ihr Onkel und Ihre Tante Bescheid?«
Emma verdrehte die Augen. »Nein, natürlich nicht. Ich habe Ihnen doch gerade erklärt, dass niemand etwas weiß. Stuart will es geheim halten. Er will, dass wir durchbrennen. Er will, dass ich mitkomme, nach Schott…«
Emma brach ab, als James unvermittelt aufsprang. Er war so viel größer als sie, dass sie stets gezwungen war, sich den Hals zu verrenken, wenn er so dicht vor ihr stand wie jetzt, auch wenn der Schreibtisch zwischen ihnen war. Als sie jetzt in sein Gesicht hinauf starrte, regte sich plötzlich leise, aber unverkennbare Furcht in Emma. James sah geradezu gefährlich aus. Sie hatte ihn natürlich schon wütend erlebt. Er war sehr aufbrausend, wenn es um Dinge wie schlampige Bedienung bei Tisch oder die Misshandlung von Pferden ging, Tiere, für die er eine große Schwäche hatte.
Aber Emma hatte ihn noch nie so gesehen wie jetzt. Er sah so … nun, es gab kein anderes Wort dafür.
Mörderisch.
»Wollen Sie mir etwa erzählen«, sagte James mit einer Stimme, die wesentlich beherrschter war als sein Kiefermuskel, der unkontrolliert zuckte, »dass mein Cousin vorhat, Sie mit zu den Shetlands zu nehmen?«
Emma stellte fest, dass sie einem schweren Irrtum unterlegen war. Stuart hatte völlig recht gehabt, als er behauptete, dass sie, wenn überhaupt, nur heimlich heiraten könnten … zumindest, wenn das hier ein Beispiel für die Reaktion war, die ihre Verbindung hervorrufen würde.
»Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört«, versicherte sie ihm hastig. »Ich bin überzeugt, Stuart wird bald eine eigene Pfarrei bekommen. Die Stelle als Kaplan wird er nicht lange …«
»Ich habe ihm gesagt«, donnerte James so laut, dass Emma beinahe einen Satz gemacht hätte, »dass er überhaupt keine Zeit als Kaplan zu verschwenden braucht. Er kann die verdammte Pfarrei von Denham Abbey übernehmen. Das habe ich ihm nicht einmal, sondern tausendmal gesagt.«
»Ja … ja«, stammelte Emma, »ich bin sicher, dass er Ihnen dafür wirklich dankbar ist. Aber wissen Sie, er will an einen Ort – und ich bin ganz seiner Meinung – , wo er Gutes tun kann, wo die Menschen tatsächlich geistlichen Beistand brauchen, und ich fürchte, auf Denham Abbey trifft das nicht …«
»Also will er stattdessen Hunderte von Meilen entfernt einen Posten antreten, auf einer verlassenen Insel mitten in der Nordsee? Einen Posten, der mit so gut wie keinen Einkünften verbunden ist und ihn höchstwahrscheinlich umbringen wird, entweder durch den Hungertod oder durch Krankheiten? Und er will Sie mitnehmen?«
Das Haselnussbraun seiner Augen hatte sich in dunkles, feuriges Bernstein verwandelt. Emma fürchtete sich fast, ihn anzuschauen, so unheimlich wirkte die Farbe. Ach du meine Güte , war alles, was sie denken konnte. Sie hätte besser den Mund gehalten, das war ihr jetzt klar. Leider zu spät.
Angst – davor, was der Earl tun mochte und mit wem – machte Emma mutig. Sie hatte die beiden Cousins schon einmal bei einer Rauferei gesehen – wegen eines Pferdes, das Stuart angeblich zu hart herangenommen hatte – , und es war kein schöner Anblick gewesen. Eine weitere derartige Auseinandersetzung musste um jeden Preis vermieden werden.
Mit einem Gefühl, von dem sie sich einredete, es wäre Zorn, das in Wirklichkeit aber an Verzweiflung grenzte, rief sie: »Wirklich, Mylord, Sie brauchen nicht so zu schreien! Stuart und ich sind beide erwachsen und in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich bin in der Hoffnung zu Ihnen gekommen, gerade Sie würden Verständnis und Sympathie für unsere Pläne hegen. Aber wie ich sehe, habe ich Ihr Feingefühl stark überschätzt!«
»Das ist nicht das Einzige, was Sie überschätzt haben, Mädchen«, sagte James mit einem kurzen Lachen, das gänzlich unfroh klang. »Wenn Sie auch nur eine Minute glauben, ich würde einem von Ihnen beiden erlauben, diesen dummen und unüberlegten Plan auszuführen …«
Wieder einmal hätte Emma lieber den Mund halten sollen. Aber sie war zu wütend.
»Das möchte ich sehen, dass Sie uns aufhalten«, gab sie zurück und warf hochmütig den Kopf in den Nacken, sodass ihre dichten Locken auf und ab wippten. »Im Gegensatz zu Ihnen, Mylord, geben Stuart und ich uns nicht damit zufrieden, die Hände in den Schoß zu legen und zuzuschauen, wie andere sinnlos leiden. Wir wollen beide aus dieser Welt einen besseren Ort für diejenigen machen, die weniger gut dran sind als wir. Auf den Shetlands werden wir Menschen helfen, die uns wirklich brauchen.«
»Soweit ich sehen kann, ist der Einzige, der etwas braucht«, sagte der Earl drohend, »mein Cousin Stuart – und zwar eine anständige Tracht Prügel.«
Emma zog den Atem ein. »Wagen Sie es nicht, Hand an ihn zu legen«, warnte sie den Earl. »Wenn Sie das tun … wenn Sie das tun, spreche ich nie wieder ein Wort mit Ihnen.«
»Das, Emma«, sagte der Earl, »wäre nicht schwer.«
Ohne ein weiteres Wort schob er sich hinter seinem Schreibtisch hervor, stürmte zur Tür und riss sie auf.
Er war schon auf dem Flur, als Emma hörte, wie er den Namen seines Cousins brüllte. In diesem Moment jagte sie ihm nach.
»Nein, Mylord«, rief sie. »Bitte, tun Sie es nicht!«
Aber es war zu spät. Sie hörte ein Krachen und dann einen erschrockenen Aufschrei von Lady Denham.
»Lieber Himmel!« Penelope kam mit rotgeweinten Augen aus einer Kammer gestürzt. Ihr Tränenstrom war vor Überraschung versiegt. »War das Lord Denham? Was in aller Welt hast du zu ihm gesagt, Emma?«
»Zu viel«, antwortete Emma mit einem Stöhnen. Und dann rannte sie davon, um ihren Verlobten davor zu bewahren, umgebracht zu werden.
Kapitel 1
Shetlandinseln, Mai 1833
Emma Van Court Chesterton hatte einen schlechten Tag.
Nicht, dass dieser Tag wesentlich schlimmer gewesen wäre als jeder andere, wohlgemerkt. Sie kannte jetzt seit fast einem Jahr nichts anderes. Oh, es hatte innerhalb dieser zwölf Monate den einen oder anderen guten bis mittelmäßigen Tag gegeben, aber im Großen und Ganzen hatten die schlechten überwogen.
Sie wusste nicht genau, was sie getan hatte, um eine solche Pechsträhne zu verdienen. Sie hatte jeden einzelnen Halfpenny aufgehoben, den sie gefunden hatte, und darauf geachtet, unter keiner Leiter hindurchzugehen.
Nicht etwa, dass sie an solche Sachen glaubte. So etwas war rückständig und abergläubisch.
Aber um ganz sicher zu gehen, war sie erst in der vergangenen Woche zum Wunschbaum gegangen und hatte Stuarts Hausschuhe an den Stamm genagelt. Von ihren eigenen Schuhen konnte sie kein Paar entbehren, und Stuart würde seine ohnehin nicht mehr brauchen.
Aber als sie am nächsten Morgen aufwachte, stellte sie fest, dass die Schuhe kein bisschen genützt hatten. Ihre Pechsträhne ging unerbittlich weiter.
Der Hahn war wieder einmal ausgerissen.
Sie wurde vom Pech verfolgt, das war die einzige Erklärung. Ein Blick aus ihrem Schlafzimmerfenster verriet ihr, dass der Tag schon weit fortgeschritten war. Der bleierne Himmel war hell genug, um darauf hinzuweisen, dass der Morgen schon mindestens vor einer Stunde angebrochen war, aber kein Hahnenschrei hatte sie geweckt.
Sie war also spät dran. Wieder einmal.
Die Vorstellung, die Bettdecke zurückzuschlagen und den Tag in Angriff zu nehmen, war nicht unbedingt verlockend. Emma blieb nach dem Aufwachen eine volle Minute liegen und fragte sich, ob es sich überhaupt lohnte, einen Fuß aus dem Bett zu setzen. Erst das ungeduldige Winseln ihres Bettgenossen – ein freundlicher Hund unbestimmter Rasse, aber mit unleugbarem Charme, den Emma vor einer Woche von den Docks gerettet hatte – trieb sie schließlich aus den Federn.
Besser, sich einem wenig vielversprechenden Tag zu stellen, dachte sie bei sich, als zu riskieren, dass ihrem neuen Gast ein Malheur passierte.
Hastig schlüpfte Emma in Hausschuhe und Morgenmantel, während der Hund – eigentlich eine Hündin, die in Emmas zugegebenermaßen unerfahrenen Augen jeden Moment Junge bekommen würde – , aufgeregt um ihre Knöchel herumwuselte, wobei er in freudiger Erregung, endlich nach draußen zu dürfen, mehrmals an die Schienbeine seiner neuen Herrin stieß.
Als Emma die Haustür öffnete, um den Hund hinauszulassen, stellte sie fest, dass alles noch schlimmer – viel schlimmer – war, als sie erwartet hatte. Nicht nur, dass ihr Hahn weggelaufen war, fiel noch dazu Regen, schwerer, undurchdringlicher Frühlingsregen, der den Garten um ihr Häuschen in eine Sumpflandschaft verwandelte. Während der Nacht war auf See ein Sturm aufgezogen, der jetzt mit aller Kraft über die kleine Hebrideninsel tobte.
Nach einem halben Dutzend Schneestürmen seit Oktober war der Anblick von ganz normalem, kräftigen Regen nicht direkt unwillkommen. Emmas Freude über den Frühlingsschauer wurde allerdings durch die Vorstellung getrübt, dass sie sich durch dieses Unwetter kämpfen musste, um ins Dorf zu gelangen, wo ein Dutzend Kinder in der Schule darauf warteten, dass sie ihnen Unterricht gab.
Emma war nicht die Einzige, die den strömenden Regen mutlos betrachtete. Ihr kleiner Gast setzte zögernd eine Pfote in den Matsch und drehte sich dann zu Emma um, als wollte er sagen: Muss ich? Muss ich wirklich?
Aber genau in diesem Moment wurde der vertrauensvolle, leicht ratlose Gesichtsausdruck misstrauisch, und ein tiefes Knurren drang aus der Kehle der Hündin, das Emma anzudeuten schien, dass nicht nur die Abneigung gegen die Nässe der Grund war. Sie folgte der Blickrichtung des Tieres und entdeckte eine massige Gestalt, die reglos im Schatten unter dem Vorsprung des Strohdachs stand.
»Du lieber Gott«, murmelte Emma und legte eine Hand auf ihre Brust. Ihr Herz fing laut zu pochen an. Wirklich, sagte sie sich, das ist einfach zu viel! Dass man mir vor meinem eigenen Cottage auflauert, während ich noch im Morgenmantel bin … du meine Güte! Und es passierte auch nicht zum ersten Mal. So geht es nicht. So geht es ganz einfach nicht, dachte sie.
Sie öffnete die Augen, die sie geschlossen hatte, um ein kurzes, stummes Dankgebet zu sprechen, dass sie diesen speziellen Eindringling zumindest kannte, und sah die unbewegliche Gestalt an.
»Also wirklich, Mr. MacEwan«, sagte sie mit leicht schlaftrunkener Stimme. »Was machen Sie hier draußen im Regen? Sie haben mich beinahe zu Tode erschreckt.«
Der Riese – denn das war er tatsächlich, ein Riese von eins achtundneunzig, der zusammen mit seiner betagten Mutter auf einem benachbarten Bauernhof lebte – neigte den Kopf. Das Regenwasser, das sich in seiner Hutkrempe gesammelt hatte, ergoss sich in einem Schwall über die Kappen seiner schweren Stiefel.
»Morgen, Mrs. Chesterton«, sagte er in seinem breiten schottischen Akzent und machte ein betretenes Gesicht. »Ich wollte Ihnen keine Angst machen. Ich … ich bringe Ihnen Ihren Hahn zurück.«
Erst jetzt fiel Emma auf, dass ein magerer, leicht zerzauster Vogel unter Cletus MacEwans Arm steckte.
»Ach herrje«, sagte sie. »War er wieder hinter Ihren Hennen her, Mr. MacEwan? Es tut mir ja so leid …«
»Schätze, er hat vergessen, dass er nicht mehr dort lebt.«
Cletus setzte den Hahn auf den Boden. »Aber ich glaube nicht, dass er wieder weglaufen wird. Unser Charlie hat ihm ganz schön Beine gemacht. Wundert mich, dass Sie das Gekreische der beiden nicht bis hierher gehört haben.«
Emma musterte den Hahn, der unter den dürftigen Schutz des Vordachs flüchtete und dann hochmütig im harten Boden scharrte, als hätte er keine Ahnung, dass von ihm die Rede war, finster.
»Nein, ich habe nichts gehört«, erwiderte Emma, »und deshalb bin ich heute spät dran. Ich danke Ihnen herzlich, Mr. MacEwan, dass Sie ihn mir zurückgebracht haben.«
Cletus nickte. »Tja, ich denke, ab jetzt bleibt er hier, nach den Hieben, die Charlie ihm versetzt hat.« Dann streckte er verlegen den anderen Arm aus, an dem ein Korb hing, dessen Inhalt mit einem blau-weiß-karierten Tuch bedeckt war.
»Hätte ich fast vergessen«, sagte er. »Meine Mam hat sie gerade gemacht. Scones. Ganz frisch aus dem Backofen.«
Emma nahm den Korb aus seinen schwieligen, wettergeröteten Händen und stellte fest, dass er wieder einmal seine Handschuhe vergessen hatte. Der erste wärmere Frühlingstag und schon ließ Cletus MacEwan seine Handschuhe zu Hause, ohne wie Emma daran zu denken, dass sich das Wetter auf den Shetlands nicht immer an den Kalender hielt. Es konnte mitten im Winter sommerlich warm sein und mitten im Mai kalt wie im Februar, so wie heute.
»Oh, Mr. MacEwan«, sagte sie, wobei sie die Stimme hob, damit er sie trotz des stetigen Rauschens des Regens verstehen konnte. »Vielen, vielen Dank. Aber ich wünschte, Sie hätten das nicht getan …«
Emma wollte nicht einfach höflich sein. Sie wünschte wirklich, er hätte es nicht getan. Obwohl ihr Mrs. MacEwans Gebäck eindeutig lieber war als das Präsent der vorigen Woche – ein frisch geschlachtetes Schwein – , war es trotzdem zu viel. Cletus MacEwan war Emmas ergebenster und körperlich eindrucksvollster Verehrer, aber auch der, dem es am meisten an gesundem Menschenverstand mangelte.
»Sie werden mit Ihrer Arbeit nicht nachkommen, wenn Sie mir jeden Morgen etwas zum Frühstück bringen«, tadelte sie ihn milde.
Cletus lächelte sie nur, mit dem vertrauensvollen, freundlichen Lächeln eines Kindes an. Und er war tatsächlich noch sehr jung, achtzehn Jahre alt, und somit ein Jahr jünger als Emma.
»Meine Mam sagt, wir müssen schauen, dass Sie ordentlich essen«, antwortete Cletus. »Sie sagt, dass Sie zu dünn geworden sind und dass Sie noch ganz von Kräften kommen, wenn Sie nicht …«
»Ja, ja, schon gut«, unterbrach Emma ihn. Mrs. MacEwans düstere Prophezeiungen kannte sie zur Genüge. Mit Emmas Gesundheit stand alles zum Besten, aber Cletus’ Mutter prahlte gern vor ihren Freundinnen in der Stadt mit ihren Bemühungen, die »arme Witwe Chesterton« aufzupäppeln. Es konnte kein Zweifel bestehen, dass gute Nachbarschaft nicht der einzige Grund war, der hinter Mrs. MacEwans Fürsorge steckte. Sie hatte ein handfestes Motiv und dieses Motiv stand jetzt eben vor Emmas Augen und zitterte in seinen nassen Sachen wie ein Lamm vor der Schlachtbank.
Unter normalen Umständen zeigte Emma keinem ihrer zahlreichen Verehrer besonderes Entgegenkommen. An diesem Tag jedoch beschloss sie, eine Ausnahme zu machen. Vielleicht lag es an dem Anblick von Cletus MacEwans aufgesprungenen Händen, vielleicht auch an dem köstlichen Duft der Scones, die seine Mutter gebacken hatte. Wie auch immer, Emma entschied, ihn ins Haus zu bitten, und sagte deshalb freundlich: »Wollen Sie nicht hereinkommen, Mr. MacEwan?« Sie trat beiseite, um ihn eintreten zu lassen.
Cletus MacEwan brauchte keine weitere Aufforderung. Schnell wie der Blitz duckte er sich unter dem niedrigen Türrahmen hindurch und baute sich in ihrem Wohnzimmer auf.
»Sehr nett von Ihnen, Ma’ am«, sagte er und neigte erneut den Kopf, wobei es ihm gelang, einen Schwall Wasser auf ihrem sauberen Holzboden zu verteilen. »Vielleicht kann ich auf eine Tasse Tee bleiben, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Emma beobachtete lächelnd, wie ihr Nachbar dem Kamin zustrebte. Cletus MacEwan war zwar nicht sehr aufgeweckt, aber als Nachbar ganz nützlich, hatte sie festgestellt, vor allem, wenn es darum ging, ein Hühnchen für ihr Abendessen zu schlachten, eine Aufgabe, für die Emma weder Talent noch Neigung hatte.
Aber diese Eigenschaft erweckte in ihr nicht den Wunsch, ihn zu heiraten. Emma hatte nicht den Wunsch, überhaupt zu heiraten.
Und das war die Wurzel all ihrer gegenwärtigen Probleme – den Hahn nicht eingeschlossen.
Der hellbraune Mischling, den Emma am Vorabend beschlossen hatte, nach der Figur eines Romans, den sie gerade las, Una zu nennen, hatte sein Geschäft erledigt und kehrte eilig in die Wärme des Hauses zurück. Emma trat beiseite, um nicht von den Wassertropfen besprüht zu werden, die in alle Richtungen spritzten, als Una ihr Fell ausschüttelte.
Als Emma in ihrem Schlafzimmer gerade damit kämpfte, ihr Haar zu bändigen – ein Kampf, der Tag für Tag zwischen den dicken blonden Locken, die ihren Kopf wie ein Heiligenschein umrahmten, und der steifen Rosshaarbürste stattfand, die dieser Aufgabe nicht im Geringsten gewachsen zu sein schien – , blickte sie zufällig auf und bemerkte etwas Ungewöhnliches.
In ihrem Gemüsegarten stand ein Leichenwagen.
Emma, die mehrere Haarnadeln, mit denen sie den Knoten auf ihrem Kopf zu befestigen versuchte, zwischen den Zähnen hielt, hätte diese beinahe verschluckt, als sie das lange schwarze Gefährt entdeckte. Die schäbige Kutsche – das einzige Fahrzeug des entlegenen Inseldorfes, das über eine Art Dach verfügte – wurde von einem Zweiergespann gezogen und beide Pferde schnupperten an Emmas Kohlköpfen, die eben erst zaghaft aus dem Boden sprossen.
Emma, deren Hände vor Überraschung wie festgefroren über ihrem Kopf verharrten, starrte den Wagen an. Was in aller Welt hatte der Leichenwagen des Dorfes in ihrem Gemüsegarten verloren? Hier in der Gegend hatte es keine Todesfälle gegeben – zumindest keine, von denen Emma gewusst hätte. Emmas Cottage lag auf einer einsamen Klippe über der See. Ihre nächsten Nachbarn, Cletus MacEwan und seine Mutter, lebten beinahe eine Meile weiter unten an dem steilen Abhang, der zum Anwesen der Chestertons führte. Mr. Murphy, der Besitzer des Wagens, konnte unmöglich glauben, dass einer der beiden MacEwans tot war. Und auch sie selbst war ganz offenkundig am Leben.
Zugegeben, Stuart, Emmas Ehemann, war gestorben, aber das lag sechs Monate zurück. Und auch wenn Mr. Murphy gern ein Glas zu viel trank, konnte nicht einmal er vergessen haben, dass er diese schicksalhafte Fahrt bereits gemacht hatte.
Außer – Emma ließ die Arme sinken, als sich ein kaltes Grauen in ihr regte – außer, Samuel Murphy wäre aus einem ganz anderen Grund hier. Nicht, um eine Leiche abzuholen, sondern um sich der Schar von Verehrern anzuschließen, die ihr wie Cletus MacEwan so eifrig den Hof machten, seit sich die Kunde von ihrer ungewöhnlichen Erbschaft auf der Insel herumgesprochen hatte.
»Oh nein!«, sagte Emma laut. Una, die zu ihren Füßen lag und glaubte, Emma spräche mit ihr, wedelte freudig mit dem Schwanz. »Nicht Mr. Murphy! Oh, bitte nicht auch noch Mr. Murphy!«
Schlimm genug, dass Cletus MacEwan jeden Morgen auf ihrer Türschwelle stand. Schlimmer noch, dass sie jedes Mal, wenn sie ins Dorf kam, von heiratswilligen Junggesellen aller Altersgruppen und Arten belagert wurde, von denen etliche Fischer waren und versuchten, sie mit ihrem Tagesfang zu beeindrucken.
Aber all das wäre nichts, rein gar nichts, im Vergleich zu der Aussicht, tagein, tagaus von einem großen schwarzen Leichenwagen verfolgt zu werden, dessen Dach noch dazu mit einer schwarzen Rüsche verziert war!
Wild entschlossen, diesem Schicksal zu entgehen, trat Emma an ihr Bett, wo sie am Vorabend ihren Schal abgelegt hatte. Während sie das schwere Wolltuch um ihre Schultern warf, marschierte sie aus dem Schlafzimmer und ging direkt zur Haustür, ohne dem Hünen, der vor dem munteren Feuer in ihrem Kamin kauerte, auch nur einen Blick zu gönnen.
Die Vordertür ihres Häuschens war in der Hälfte unterteilt, sodass Emma den oberen Teil öffnen konnte, um im Frühling und Sommer die frische Brise vom Meer zu genießen, ohne zu riskieren, dass die Tiere, die sich in ihrem Garten herumtrieben, ins Haus kamen. Auch jetzt stieß sie die obere Hälfte auf und spähte durch den Regen zu dem schwarzen Gefährt und dem einsamen Lenker auf dem Kutschbock, dem die Nässe nichts auszumachen schien.
Emma holte tief Luft und schrie durch das unablässige Prasseln des Regens: »Samuel Murphy! Was haben Sie da zu suchen? Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund dafür, mein Gemüsebeet mit Räderfurchen zu durchziehen!«
Sie hörte, wie sich Cletus MacEwan hinter ihrem Rücken bewegte.
»Murphy?«, rief er ungläubig. »Was will der denn hier?« Obwohl er die Frage nicht gehört haben konnte, tippte Mr. Murphy, der auf dem Kutschbock des Wagens saß, höflich an die Krempe seines durchnässten Hutes und rief zurück: »Ich hab hier Besuch für Sie, Mrs. Chesterton!«
Erst jetzt fiel Emma auf, dass jemand im Wagen saß. Da in Faires niemand mit diesem traurigen Vehikel fahren würde, wenn er nicht gerade der Länge nach in einer Kiste aus Fichtenholz lag und in der Angelegenheit nichts mehr zu sagen hatte, war es verständlich, dass Emma diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hatte. Aber bei einem wahren Wolkenbruch wie dem, den sie gerade erlebten, würde jemand, der nicht bis auf die Haut nass werden wollte, auf das einzige geschlossene Fahrzeug in dieser Gegend zurückgreifen müssen.
Und dieses Fahrzeug war natürlich Samuel Murphys Leichenwagen.
»Es ist MacCreigh.« Cletus richtete sich auf. Er musste den Kopf einziehen, um nicht an die Dachbalken zu stoßen. Emma, die Angst um ihre Porzellanteller hatte, die auf den oberen Regalen der Anrichte in der Ecke standen und dazu neigten, bedrohlich zu klappern, wenn Cletus MacEwan über den Boden stapfte, streckte beide Arme nach ihm aus.
»Bitte, Mr. MacEwan«, sagte sie begütigend. »Setzen Sie sich doch. Es gibt keinen Grund zu der Annahme …«
Angesichts seines verstörten Gesichtes und der Tatsache, was er von Lord MacCreigh hielt, der sie ein-, zweimal in ihrem Cottage besucht hatte – wenn auch nicht so früh am Morgen – , überraschte es Emma nicht sonderlich, als er ihr ins Wort fiel.
»Es ist MacCreigh, sage ich Ihnen!«, beharrte Cletus, gehorchte jedoch, indem er blieb, wo er war. »So sicher, wie ich hier stehe. Zu verweichlicht, dieser Dandy, um wie normale Menschen im Regen auf seinem Pferd zu reiten, und deshalb musste er Murphys Leichenwagen mieten!«
Emma stellte fest, dass sie unverzüglich handeln musste, um ihr Porzellan zu retten. Bei einer Pechsträhne wie der ihren durfte sie kein Risiko eingehen. Daher wandte sie ihr Gesicht wieder dem Regen zu und rief dem Passagier in der Kutsche zu: »Also wirklich, Lord MacCreigh, ich bin sehr erstaunt. Ich dachte, ich hätte unmissverständlich klar gemacht, dass meine Antwort …«
Noch während sie sprach, schwang der Wagenschlag langsam auf und gab den Blick auf das Innere der Kutsche und einen großen Mann in einem schweren, pelzbesetzten Mantel frei. Er stieg etwas steifbeinig aus, was nicht weiter verwunderlich war, da das Innere von Murphys Wagen nicht dem Komfort der Lebenden, sondern dem der Toten diente.
Emma stellte fest, dass ihr Besucher keineswegs Lord MacCreigh war.
Abgesehen von der Tatsache, dass Lord MacCreigh entgegen Cletus’ Behauptung durchaus nicht so verweichlicht war, um wegen eines kleinen Schauers, Murphys Kutsche zu mieten – er war ein passionierter Reiter, dem schlechtes Wetter nichts auszumachen schien – , sah dieser Mann ganz anders aus als ihr unerbittlichster Verehrer. Der Mann hier war, im Gegensatz zu Geoffrey Bain, Baron von MacCreigh, der rote Haare hatte und einen Schnurrbart trug, dunkelhaarig und glattrasiert, und unter seinem Mantel trug der Mann beige Hosen und eine grüne Satinweste; Geoffrey Bain hingegen kleidete sich, seit er im Vorjahr von seiner jungen Verlobten verlassen worden war, stets in Schwarz. Obwohl das Alter – dreißig – und die Größe – ein wenig über eins achtzig – ungefähr hinkamen, waren die beiden Männer in jeder anderen Hinsicht absolut gegensätzlich.
Dieser Mann war Emma fremd. Und das an sich war schon seltsam, da nie Fremde nach Faires kamen.
Und schon gar nicht, um sie zu besuchen.
Hier musste ein Irrtum vorliegen. Ja, natürlich, das musste es sein. Denn falls sich die Neuigkeit ihrer Erbschaft nicht auf dem Festland verbreitet hatte, und Emma betete inständig, dass es so wäre, gab es keinen, nicht den geringsten Grund, warum ein Fremder sie aufsuchen sollte.
Der Mann ging auf das Cottage zu, und Emma, die zum ersten Mal sein Gesicht sehen konnte, stellte mit sinkendem Mut fest, dass dieser Tag einer der schlechtesten zu werden versprach.
Der Mann war kein Fremder, ganz und gar nicht.