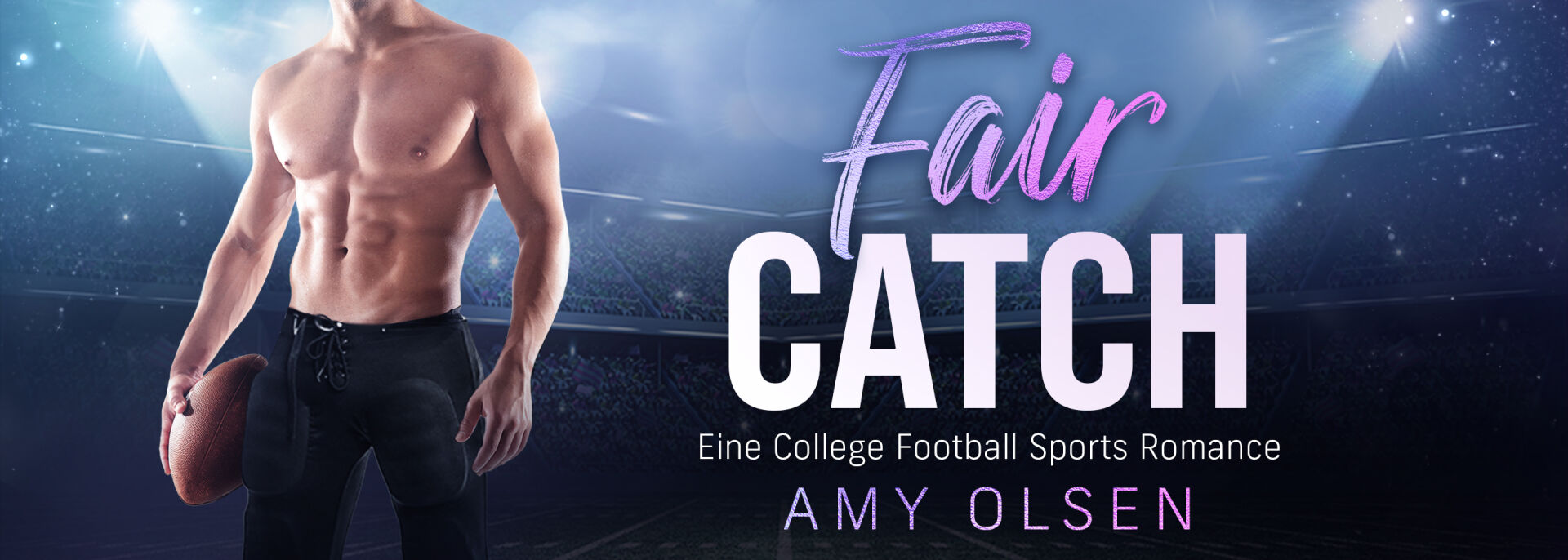1
Abigail
»Willkommen im Coffee&Dreams«, höre ich Dominic sagen und werfe einen schnellen Blick über die Schulter. Der Laden brummt wie an jedem Nachmittag, wenn nicht gerade ein Spiel der Ravens stattfindet. Ich hantiere hektisch mit den Siebträgern. »Einen Caffè Latte«, ruft er mir zu und sucht meinen Blick. Ich nicke abgelenkt, denn das Zischen der Maschine macht mich gleichzeitig darauf aufmerksam, dass ich die Dampf-Lanze nicht tief genug in der Milch stecken habe. Ein dummer Fehler, der mir eigentlich nicht mehr unterläuft, der aber an Tagen wie diesem, wenn es hektisch ist, schon mal passieren kann.
Ich konzentriere mich hastig wieder auf die vollendete Zubereitung des Cappuccinos mit doppeltem Espresso und schäume die Milch so weit auf, dass sie als Topping den nötigen Halt hat, um mein eigentliches Steckenpferd tragen zu können: die Latte Art.
»Und einen Soja-Latte«, ruft Dominic. »Kommst du hinterher?«
»Eins nach dem anderen«, murmele ich, schließlich ist dies nur eine rhetorische Frage. Mein Chef verlässt sich darauf, dass ich meinen Job schnell und effizient erledige. Mit der Milch zufrieden hebe ich die Tasse an, um meinen Zauber zu versprühen. Das Klingeln meines Telefons reißt mich aus der Konzentration, und ich verschütte einige Tropfen der heißen Milch. Schnell stelle ich das Kännchen ab und ziehe mein Telefon aus der Hosentasche, um abzunehmen. »Ja?« Damit ich trotz meines Privatgesprächs weiterarbeiten kann, stecke ich mir das Handy zwischen Ohr und Schulter und greife wieder nach dem Kännchen.
Mich grüßt ein bellendes Husten. Abgelenkt gieße ich die Milch zu schnell in den Espresso.
»Abby?«, krächzt Claire.
»Wer sonst?« Ich verdrehe die Augen und konzentriere mich wieder auf das komplizierte Raben-Emblem, das wir vor jedem Spiel unserer Football-Mannschaft, der UCS Ravens, in unsere Schaumkronen zeichnen.
»Du musst mich retten«, haucht meine große Schwester ins Telefon. »Ich habe einen Auftrag, aber …« Sie unterbricht sich mit einem schaurigen Hustenorkan.
»Das klingt nicht gut.« Und das ist eine Untertreibung. »Ich bin im Coffee&Dreams. Meine Schicht dauert noch mindestens drei Stunden, und wenn das hier so weitergeht, vermutlich länger. Ich kann dir also nicht helfen.« Das weckt zwar mein schlechtes Gewissen, schließlich unterstütze ich meine Schwester gern und arbeite auch für sie in ihrer Party-Agentur, aber ich sehe keinen Weg, wie ich nun beides unter einen Hut bekomme. Dominic zählt genauso auf mich wie Claire.
»Ich weiß«, sagt sie mit stark belegter Stimme. »Der Auftrag ist morgen.«
»Morgen?« Ich bin erleichtert. »Super, da habe ich frei.« Mein einziger freier Tag in dieser Woche, aber das stört mich nicht. Da ich das Stipendium der UCS, der University of California in Sacramento, nicht bekommen habe, brauche ich dringend Geld, damit ich zumindest bald mein Studium aufnehmen kann. Extraschichten kommen mir da gelegen, und Claire zahlt in der Regel gut. »Was brauchst du denn?« Ich hoffe auf ein möglichst ausgefallenes Kunstwerk, denn neben der Latte Art liebe ich jede Kunst, die mit Farbe und Gestaltung zu tun hat.
Ich stelle den Cappuccino auf den Tresen, wo die Kundschaft auf ihre kunstvoll verzierten Kaffeespezialitäten wartet. »Bitte schön.«
Ich drehe mich gleich wieder um, schließlich ist die Liste an Bestellungen heute endlos. Ich leere den Siebträger und lausche dabei, wie sich meine Schwester die Lunge aus dem Leib hustet. »Hey, soll ich später vorbeikommen? Du klingst wirklich furchtbar.«
»Danke, Abby, aber es ist besser, wenn du wegbleibst. Wenn du auch ausfällst, geht der Auftrag baden.« Sie räuspert sich und bricht gleich wieder in wildes Gebell aus. »Aber der ist wirklich wichtig.«
»Ich helfe dir«, verspreche ich und wechsle die Schulter, da das einseitige Hochziehen schmerzhaft wird. »Was brauchst du denn?«, frage ich erneut. »Und bis wann?« Ich sehe mich bereits die Nacht durcharbeiten, damit der Auftrag auch fristgerecht fertig wird. »Moment«, flüstere ich, da mir der Fehler auffällt. Claire ist künstlerisch nicht begabt, dafür beschäftigt sie schließlich mich. Meine Schwester kümmert sich um die Planung und Ausführung aller Tätigkeiten rund um ein Event. Also um Dinge, die mir schwerfallen. Sie spricht mit Kunden, überbringt Grußbotschaften und singt auch schon mal vor großem Publikum. All das liegt mir so gar nicht, weshalb ich nun nervös werde. Was erwartet mich wohl?
»Äh«, brummt Claire und seufzt dann. »Du musst für mich ein Geburtstagsständchen überbringen.«
Ich verschütte die Milch und wische sie hastig weg. »Nein«, sage ich dabei mit bebender Stimme. »Du weißt doch, dass ich das nicht kann.« Schon der Gedanke bringt meine Hände dazu, unkontrolliert zu zittern. »Das schaffe ich nicht.«
Claire hustet und ich habe so die Ahnung, dass mir nichts anderes übrig bleiben wird, als über meinen Schatten zu springen. Der Hals zieht sich mir zu. Die Wasserdampfdüse zischt und schäumt die Milch auf. Ich drehe das Kännchen langsam und nutze die Zeit, um meine Gedanken zu sammeln. Ich kann einfach nicht vor Menschen sprechen. Singen scheidet da völlig aus. Das endet nur in einer Katastrophe, wenn ich es versuche.
»Es ist wirklich schrecklich wichtig.« Claire räuspert sich. Mit ihrer belegten Stimme klingt sie so gar nicht wie sie selbst. »Ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht so wichtig wäre!«
»Claire, erinnerst du dich an die Aufführung, als ich fünf war?« Mein einziges bisheriges Bühnenerlebnis – ein durchaus denkwürdiges.
»Als du ohnmächtig wurdest, weil du Piep sagen solltest?«
»Ja.« Ich schnaube leise und dekoriere auch diese Schaumkrone mit dem Raben-Emblem.
»Zwei Latte mit Karamell und einen Espresso Grande«, ruft Dominic mir zu.
»Kommt!«
»Du wurdest ohnmächtig, hast dabei die Hauptdarstellerin umgerissen, ihr seid beide von der Bühne gefallen und habt euch die Köpfe angeschlagen.« Claire seufzt gedehnt. »Aber du bist keine fünf mehr, Abby, und irgendwann musst du deine Ängste überwinden. Es ist auch nur ein Geburtstagsgruß. Nichts Schwieriges. Das bekommst du hin. Du siehst einfach auf die Wand, singst und verschwindest wieder.«
Ich reinige schnell die Dampf-Lanze und fülle erneut Kaffee in die beiden Siebträger. »So einfach ist das nicht«, murre ich. Ich weiß, dass sich Ängste lindern lassen und dass man unangenehmen Situationen nicht aus dem Weg gehen kann, aber ich halte es auch für falsch, sich denen absichtlich auszusetzen. »Was ist gewonnen, wenn ich wieder ohnmächtig werde?« Auf die Erfahrung kann ich gut verzichten, da ich damals eine Gehirnerschütterung davongetragen hatte.
»Wirst du nicht«, verspricht Claire. »Cooper ist da und unterstützt dich.«
Ich verdrehe die Augen und widme mich wieder meinem Kunstwerk. So aufwendig es ist, einen Raben in den Schaum auf einem Caffè Latte zu malen und dabei lediglich das Kännchen als Stift zu verwenden, erscheint mir dies doch wesentlich einfacher, als vor Claires bestem Freund ein Geburtstagslied zu trällern.
»Du kannst ihn ansehen und so tun, als wärt ihr allein.«
Ich schnaube. »Ja, ich singe besonders gern, wenn Cooper da ist. Muss ich dich daran erinnern, dass er meine Kunst als albernen Kinderkram abtut?«
Claire seufzt. »Mit Latte Art kannst du ihn nicht beeindrucken«, gibt sie zu. »Aber er sagt, dass ihm deine Stimme eine Gänsehaut bereitet.«
Dies ist nicht als Kompliment zu verstehen, denn Cooper hat mir bereits ins Gesicht gesagt, dass er mich für eine Krähe hält, und jeder weiß doch, wie Krähen klingen. »Ja, das hilft.« Ich stelle die beiden Kaffeespezialitäten auf den Tresen.
»Du hast eine wundervolle Singstimme«, behauptet Claire.
»Spar dir deine Schmeicheleien«, murre ich. »Verdammt! Du weißt, dass ich das nicht kann.«
»Du kannst«, versichert Claire voller Inbrunst. »Du musst dich nur trauen. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann.« Sie hustet. »Es sind keine fünf Minuten. Du singst vor Coopers Freund ein sexy Geburtstagsständchen und bist raus.«
Ich stelle das Kännchen ab. »Vor Coopers Freund?« Ich betone das letzte Wort absichtlich. Cooper ist homosexuell, und bei der Formulierung nehme ich nun an, dass Claires bester Freund seit der Junior High endlich den Mann fürs Leben gefunden hat.
»Ja.« Sie zieht das A etwas.
Ich wische mir die feuchte Hand ab und nehme das Kännchen wieder auf, um frische Milch aufzuschäumen. Es ist sicher immer noch peinlich, vor Fremden zu singen – das mag ich nicht einmal vor Claire oder meinen Eltern –, aber vielleicht ist es etwas anderes vor Coopers Freund? Ich fühle mich gleich schuldig, weil ich ihn anders betrachte als andere Männer. Kann ich mich eher vor einer homosexuellen Person zum Narren machen als bei einer heterosexuellen? Ganz sicher nicht! Schließlich sollte es kein Unterschied sein, ob ich vor einem weiblichen, männlichen oder diversen Publikum stehe.
»Er ist ein ganz Lieber«, versichert Claire. »Cooper ist sich sicher, dass du seinen Freund nicht verschrecken kannst.« Sie kichert und bellt im Anschluss. »O Mann, glaub mir, Abby, ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht wirklich wichtig wäre.«
»Okay«, murmele ich. Obwohl mein Herz flattert und mir bereits der Angstschweiß auf der Stirn steht, kann ich meine Schwester nicht im Stich lassen. Sie hört sich tatsächlich krank an und kennt mich gut genug, um sich denken zu können, welchen Dienst sie da erbittet. »Ich mache es, aber ich kann nicht versprechen, dass ich auch nur ein Wort hervorbekomme!«
Claire stößt den Atem aus. »Danke, du bist ein Schatz. Du musst morgen um halb vier am Stadion sein. Jermaine wird dich in Empfang nehmen und dich in die Torte stecken.«
»Bitte was?« Ich lasse beinahe das Kännchen fallen. »Du hast Singen gesagt.« Einen Auftritt, wie Claire ihn regelmäßig hinlegt, habe ich noch nie absolviert, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mich das völlig überfordert.
»Keine Sorge«, säuselt meine Schwester. »Das ist viel nervenschonender, als auf eine Bühne treten zu müssen, wo bereits alle Augen von Beginn an auf dich gerichtet sind. Du springst raus, singst, und Jermaine holt dich im Anschluss direkt wieder ab.«
Das klingt vielleicht einfach, aber ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass es wirklich einfach ist!
»Du bist die Beste.« Claire keucht mitleiderregend. »Wenn du noch Fragen hast, wende dich einfach an Jermaine. Ich gehe ins Bett und stehe erst wieder auf, wenn ich gesund bin.« Sie kichert und beginnt erneut zu husten.
»Gute Besserung«, sage ich tonlos. Ich weiß genau, was ich mir da aufbürde, und fürchte mich vor meiner eigenen Courage.
»Abs!«, sagt Dominic und tippt mich an. »Du kommst ja gar nicht nach.«
»Entschuldige«, murmele ich und zwinge ein Grinsen auf meine Lippen. »Eine Hiobsbotschaft von meiner Schwester. Mein freier Tag morgen ist gestrichen und …« Ich breche ab, schließlich schnürt sich mir bei dem Gedanken an die Tortur, die mir bevorsteht, der Hals zu.
»Okay.« Er tätschelt meine Schulter. »Mach eine Pause, ich übernehme hier.«
Ich schüttele den Kopf und schiebe mir mein Telefon in die Hosentasche. »Nein, besser ich denke gar nicht weiter darüber nach, sondern stürze mich in die Arbeit. Wenn du mir hier kurz hilfst, muss niemand lange auf seinen Kaffee warten.«
»Mach ich.« Dominic greift nach dem Siebträger und leert ihn mit geübten Handgriffen. »Wie schlimm ist es?«
»Ich muss ins Stadion.« Ich verdrehe über meine Befürchtungen belustigt die Augen und spüre seinen Blick auf mir.
»Lass uns tauschen«, schlägt er vor. »Ich habe nichts dagegen, ins Stadion zu fahren.«
»Und ein Geburtstagsständchen zu trällern, nachdem du peinlicherweise aus einer Papptorte gesprungen bist?«
Sein Blick ist unbezahlbar. »Du hast recht«, brummt er. »Das hat Fremdschampotenzial.«
»Hey!« Ich schlage sanft nach seinem Arm. »Mach es mir nicht noch schwerer!«
»Wird das heute noch was mit meinem Latte?«, fragt eine honigsüße Stimme in meinem Rücken, die mir gleich einen Schauer über den Körper rollen lässt. Ich drehe mich halb zu der Frau um, der sie gehört. Lindsey Severin lehnt am Tresen und mustert mich aus ihren stechenden blauen Augen. Meine Nemesis ist Stammgast im Coffee&Dreams und nie zufrieden. Ich arbeite ihr stets zu langsam – der Hinweis heute fällt vergleichsweise nett aus.
»Dein Latte ist bereits unterwegs«, erwidere ich betont freundlich, auch wenn mich ihre Spitzen verletzen. Mit bebenden Fingern kreiere ich das Raben-Emblem und stelle das Glas vor ihr ab. »Bitte schön.«
Lindseys Blick wandert belustigt an mir hinab. »Du siehst schlimm aus. Arbeiten muss anstrengend sein.« Sie feixt. »Zum Glück kann ich mir das sparen und mich völlig auf mein Studium konzentrieren.«
Ich atme tief ein. »Genieß deinen Latte, Lindsey.«
2
Ethan
»Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Wer so was isst, der frisst auch kleine Kinder!« Cooper schlägt mir so hart auf den Rücken, dass sich ein Schwall Essig über meine Fritten ergießt.
Die anderen Jungs lachen schallend, ich stelle die Plastikflasche ab und sehe unseren Quarterback mit hochgezogener Augenbraue an.
»Oh. Sorry, Mann.« Cooper sieht zerknirscht aus. »Ich wollte dein … Essen nicht ruinieren.«
»Das schafft er schon allein«, ruft Will und lacht noch lauter. »Essig, pfui Teufel!«
Ich bleibe noch eine halbe Sekunde ernst, dann grinse ich Cooper an. »Kein Problem. Je mehr, desto besser.« Ich schiebe mir zwei der dicken, essigtriefenden Fritten in den Mund und kaue genüsslich. Ah, fast wie zu Hause.
Ein kurzer, scharfer Stich des Heimwehs fährt mir in die Brust, und ich verdränge schnell das Gefühl.
Angeekelte Laute erklingen rund um den großen Tisch im Hinterzimmer des Burger Haven, des Stamm-Restaurants der Ravens. Hier essen wir immer vor Spieltagen, um uns einzustimmen und letzte taktische Details zu besprechen.
»Ihr wisst ja nicht, was gut ist«, sage ich und zwinge mich, nicht an früher zu denken. An die feuchtfröhlichen Abende mit meiner Rugbymannschaft. Meine Kehle wird eng, und das altbekannte Schuldgefühl erfasst mich.
»Wer kennt sie nicht, die hohe Qualität der britischen Küche?« Petes Stimme klingt eine Spur zu höhnisch, um als neckend durchzugehen. Er ist keiner meiner Lieblingskollegen. Na ja, man kann nicht alle mögen, immerhin bestehen die Ravens aus mehr als fünfzig Spielern. Cooper allerdings kriegt Herzchenaugen, wenn er Pete ansieht. Es ist beinahe süß.
»Warst du je in England?«, frage ich Pete herausfordernd. »Oder woher kennst du unser Essen so genau?«
Pete grunzt und fährt sich durch den blonden Schopf.
»Außerdem ist deine geliebte Mac-and-Cheese-Pizza auch kein kulinarisches Highlight«, setze ich hinzu. »Ein gut gemachter Cottage Pie dagegen …«
»Wenn du so gern in England wärst, warum bist du dann überhaupt hier?«, fragt Cooper. In seiner Stimme schwingt keine Bosheit mit, nur ehrliches Interesse. Verdammt. Darauf kann ich nicht mit einer scharfen Retourkutsche antworten.
Ehrlich kann ich aber auch nicht sein.
»Weißt du doch«, entgegne ich lahm. »Ich sehe mich nicht mehr im Rugby. American Football liegt mir mehr.«
»American Football«, höhnt Pete. »Im Unterschied zu was? Eurem Soccer? Es genügt, wenn du Football sagst. Als ob es irgendeinen anderen Fußball gäbe, der von Bedeutung wäre.«
Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht die Three Lions und meine Lieblingsfußballmannschaft, Manchester United, glühend zu verteidigen. Auch so eine Sache, die ich nie verstehen werde – warum man in diesem Teil der Welt so wenig Interesse an Fußball hat. Aber ich habe mir nun mal ausgesucht, hier zu leben. Und es ist toll! Hier an der Westküste der USA, in Kalifornien, dem Sonnenstaat. Die Leute entspannt, das Wetter herrlich, selbst jetzt im Herbst noch. Wann habe ich zu Hause zuletzt so viele sonnige Tage am Stück erlebt? Vermutlich nie. Seit ich vor drei Monaten hier angekommen bin, fällt es mir leichter, zu atmen. Das hier ist meine Gegenwart und meine Zukunft. Alles andere ist nicht mehr von Bedeutung.
»Na, Jungs, nun lasst den Mann mal in Frieden«, brummt Headcoach Gerber. »Wir können froh sein, dass er sich für das Studium an der UCS entschieden hat. Ein erstklassiger Rugbyspieler ist ein Gewinn für jede Mannschaft.« Er tippt auf den dicken Ordner vor sich, sein Playbook, in dem alle Taktiken, die er spielen lässt, verzeichnet und skizziert sind. »Er ist auf so gut wie jeder Position einzusetzen. Was nicht heißt, dass ich nicht jeden Einzelnen von euch schätze.« Er schaut lächelnd in die Runde. »Wir sind ein Team. Und was werden wir morgen?«
»Ein Jahr älter!«, ruft Cooper, bevor irgendwer anders reagieren kann, und deutet lachend auf Pete, der unwillig das Gesicht verzieht.
»Das meinte ich zwar nicht«, sagt Headcoach Gerber, »aber gut, dann stelle ich meine Frage anders: Was werden wir morgen tun, um unserem Tailback einen würdigen Geburtstag zu bereiten?«
»Gewinnen!«, rufen einige meiner Kameraden im Chor.
»Was werden wir?«, fragt Offense-Coach Simmons, der neben Gerber sitzt, lauter und breitet die Arme aus.
»Gewinnen!«, erklingt es ebenfalls kräftiger.
Beim dritten Mal stimme ich ein, dann essen wir auf, und danach erklärt der Headcoach noch einige Details über unsere Gegner von der UCLA. Morgen ist Heimspiel-Tag und mein erster Einsatz in dieser Saison. Aufregung und Vorfreude erfassen mich. Ich bin wieder Teil eines Teams. Im Training schon ein paar Wochen, doch nun darf ich endlich auch auf den Platz!
»Aber mal ehrlich«, sagt Will später zu mir, als wir das Restaurant verlassen und zusammen die Straße runter zum Wohnheim gehen. »Warum bist du hierhergekommen? Vermisst du deine Familie nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, so weit von meinen Eltern entfernt zu leben.«
Ich sehe die enttäuschten Gesichter meiner Eltern und Joeys traurige Miene vor mir. Mein kleiner Bruder, der immer zu mir aufgeblickt hat, konnte mir nicht einmal mehr in die Augen sehen, nachdem alles herausgekommen war. »Klar vermisse ich sie«, presse ich heraus. Ich bekomme die Worte kaum über die Lippen.
»Warum bist du dann gegangen?«, fragt Emilio.
»Und du?«, gebe ich zurück, denn der Mannschaftskamerad ist ebenfalls nicht in den USA geboren.
»Weil ich hier bessere Chancen habe.« Emilio hebt die Schultern.
»So geht es mir auch«, behaupte ich und verschweige, dass meine Chancen nicht nur besser sind, sondern dass diese Stadt, dieses Team meine einzige Chance ist, doch noch im Profisport Fuß zu fassen. Weil hier niemand weiß, was ich getan habe.
Und es darf auch nie jemand erfahren. Ich muss aufhören zurückzuschauen und mir bessere Antworten überlegen, wenn ich gefragt werde, warum ich England verlassen habe.
Schweigend gehen wir weiter. Die Sonne steht schon tief und taucht den Himmel in ein zartrosa Licht. Der Sacramento River liegt ruhig da, und ich atme tief die noch warme Abendluft ein. Mir wird ein wenig leichter zumute. Schön ist es hier. Ich mag das milde Wetter und habe über den Sommer sogar schon etwas Farbe bekommen, sehe jetzt beinahe wie ein kalifornischer Junge aus. Ich mag diese unaufgeregte kleine Großstadt und den übersichtlichen Campus der UCS, mein winziges Einzelzimmer im Wohnheim, unseren Aufenthaltsraum und die Gemeinschaftsküche, die ich fast immer für mich habe. Es gibt zwar einen Speisesaal, in dem wir verköstigt werden, aber ich finde es schön, auch mal außerhalb des festgelegten Essensplans etwas zubereiten zu können.
»Pete ist ganz schön sauer, dass Headcoach Gerber dich auch als Quarterback trainieren lässt«, reißt mich Leroy aus den Gedanken. Er bemüht sich nicht einmal, leise zu sprechen. Pete ist nicht bei uns, er wohnt nicht auf dem Campus, ebenso wie Cooper und drei oder vier andere von den Jungs.
Die anderen brummeln zustimmend, aber ich hebe abwehrend die Hände. »Ach was. Dazu hat er keinen Grund. Sicher will der Coach mich nur alle Positionen einmal ausprobieren lassen, um zu entscheiden, wo er mich am besten gebrauchen kann.«
In meinem alten Team war ich Fullback, der Schlussmann, die letzte Verteidigung bei gegnerischen Angriffen und derjenige, der den Gegenangriff einleiten kann. Auch im Football gibt es Fullbacks, aber deren Aufgaben sind nicht dieselben. Im Rugby ist es eine vielseitige Position, vielleicht die vielseitigste im ganzen Team, die gute Schussqualitäten ebenso erfordert wie den Mut, sich dem angreifenden Gegner in den Weg zu stellen.
Ich klinge wie ein Rugby-Lehrbuch. Aber ich habe den Sport geliebt und gelebt. Ich liebe ihn noch immer. Nur leben kann ich ihn nicht mehr. Mein Leben ist jetzt der American Football. Nein, der Football. Schlicht und einfach. Kein Blick zurück.
Wir erreichen das Wohnheim, und ich bleibe vor der Tür stehen und richte den Blick noch einmal in den Himmel. Ich mag nicht hineingehen. Wenn ich allein bin, kommen zu viele Gefühle hoch, die ich in Gesellschaft besser beiseiteschieben kann.
Leroy bemerkt mein Zögern. »Na, noch nicht müde?« Er deutet auf den Basketball-Korb. »Werfen wir noch ein paar Bälle?«
Ich lache auf. »Damit du mich wieder abziehen kannst? Lass uns lieber ein bisschen kicken. Ich hol meinen Fußball.«
»Da bin ich dabei.« Emilio fängt an, auf der Stelle zu laufen, wie um sich aufzuwärmen.
»Dann los.« Leroy scheucht mich mit einer Handbewegung ins Haus, und ich renne die drei Treppen hinauf in mein Zimmer.
Ich hole den schwarz-weißen Ball aus der Rollbox unter meinem Bett. Es hängen so viele Erinnerungen daran. Er ist alt, abgenutzt. Wie oft ist er zu den Smiths oder den Carters hinübergeflogen, je nachdem, ob wir in Brandons oder in meinem Garten gespielt haben … Damals, bevor wir beide ins Rugby-Team aufgenommen wurden. Danach habe ich hauptsächlich mit meinem kleinen Bruder gekickt. Ihm wollte ich den Fußball am Tag meiner Abreise schenken, aber Joey hat nur den Kopf geschüttelt. Warum ich den Ball dann mitgenommen habe, weiß ich selbst nicht.
Ich reiße mich aus meiner Starre, jogge die Treppe wieder hinunter und gehe raus zu den fünf Jungs, die mit mir kicken wollen. Dieses Spiel ist Spaß, morgen wird es ernst. Meine erste echte Bewährungsprobe an dieser Uni, in dieser Mannschaft, in dieser Sportart. Werde ich mich beweisen können?
Und wird es mir helfen, endlich ganz in den USA anzukommen?