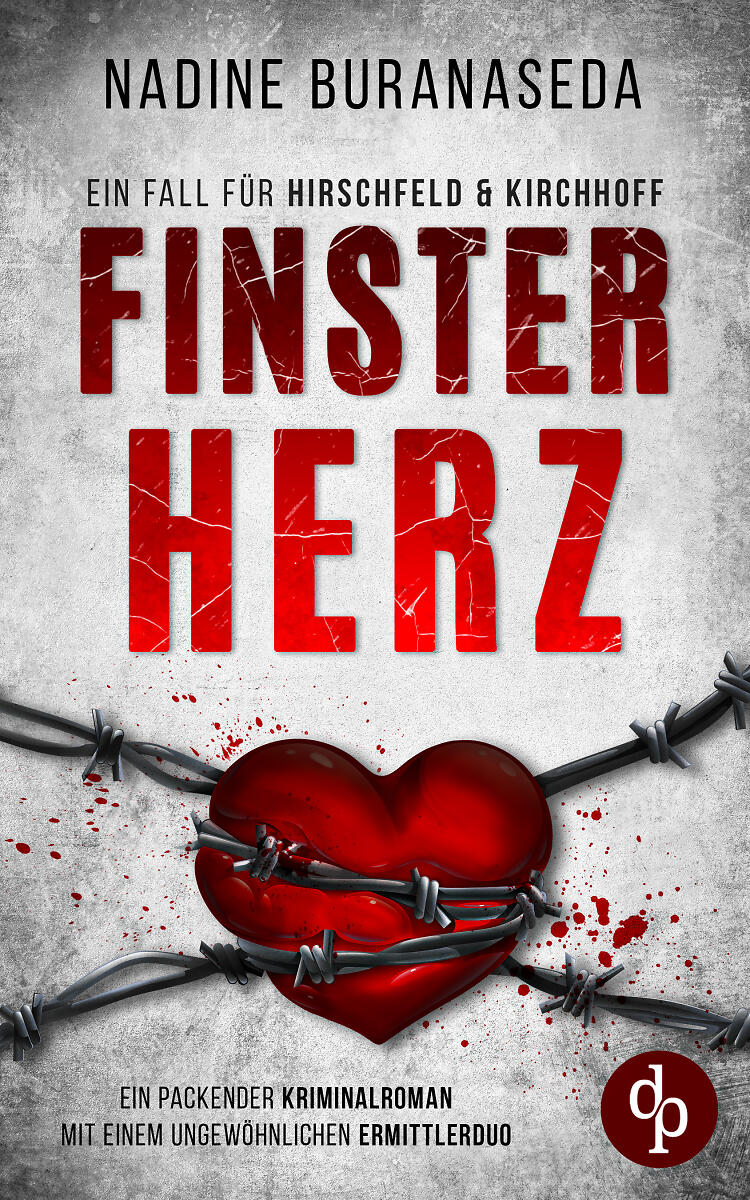Prolog
Kann nicht atmen … atmen … atmen! Gleich bin ich weg. EINS. ZWEI. DREI. Nicht mehr da. Dann ist es vorbei. VIER. FÜNF. SECHS. NICHTS. Mein Herz schlägt nicht mehr. Jetzt, jetzt ist es so weit!
Wo bin ich? Ist da draußen jemand? Hilfe! Hilfe! Ich bin hier! Warum hört mich niemand? Ganz allein hier unten. Es ist so dunkel. Bin mir nicht sicher, ob meine Augen auf sind oder zu. Kneife sie so fest zusammen, dass sich mein Gesicht zusammenzieht. Jetzt ist es einfacher. Oder denk ich das nur?
Mein Hals kratzt, und Rotz läuft mir aus der Nase. Wie lang weine ich schon? Eine Stunde? Einen Tag? Ich will raus hier!
Kann mein linkes Bein nicht mehr bewegen. Den Arm darunter auch nicht. Eben hat es noch wehgetan. Jetzt spüre ich nichts mehr. Nur meine angewinkelten Knie. Drehe den Kopf und stoße wieder an die Innenwand. Versuche, einen Buckel zu machen. Jetzt ist es noch schlimmer. Als würde ich zerquetscht. Drücke stattdessen mit der anderen Hand gegen den Deckel. Oder ist das unten? Versuche es immer wieder, aber es hilft nichts.
Meine Fingernägel sind eingerissen vom Kratzen. Das Leder stinkt. Mir wird schlecht davon. Darf mich nicht übergeben. Sonst …
Was war das für ein Geräusch? Wenn die Ratten kommen, sterbe ich vor Angst. Sie haben rote Augen und lange, spitze Zähne. Damit nagen sie mir das Fleisch von den Knochen, bis nichts mehr davon übrig ist. Das ist auch den anderen passiert.
Da! Ein Scharren. Viele Pfoten und nackte Rattenschwänze, die auf den Boden schlagen. Sie kommen immer näher und näher. Ich will schreien, doch meine Stimme ist weg.
Vielleicht bin ich schon tot. Ist das die Hölle?
1
Der Schnee schien immer dichter zu fallen, als Lutz Hirschfeld auf der anderen Straßenseite gegenüber der Rheinischen Landesklinik wartete und seine zweite Zigarette rauchte. Er hatte den Kragen seines schwarzen Ulster-Mantels hochgeschlagen und beobachtete den Eingang zur Bonner Psychiatrie. Der schwere, innen mit Baumwollflanell gefütterte Tweedstoff schützte ihn vor dem eisigen Wind, der über den Kaiser-Karl-Ring pfiff. Seine schwarzen Converse-Stoffturnschuhe, die durch den Schneematsch bereits nach wenigen Schritten klamm gewesen waren, untergruben allerdings Hirschfelds Plan, den Besuch bei seinem Vater durch eine weitere Zigarette hinauszuzögern. Er nahm einen letzten Zug, schnippte die Kippe weg, die leise zischend in einer Schneewehe versank, und setzte sich in Bewegung.
Als Hirschfeld den Ring überquerte, hielt in einiger Entfernung eine Straßenbahn und entließ eine Gruppe Frauen mittleren Alters in schwarz-gelb geringelten Bienenkostümen, unter denen sich ihre dicken Winterjacken deutlich abzeichneten. Sie hakten sich fröhlich unter und liefen schwankend auf ihn zu. Aus ihren gelben Lockenperücken ragten Fühler, die bei jeder Bewegung hin und her tanzten. Ihrem Gang und den rot glühenden Wangen nach zu urteilen, hatten die Frauen an diesem Morgen bereits ein paar Schnäpse intus. Als die Bienen ein Lied anstimmten und ihm zuwinkten, beschleunigte Lutz Hirschfeld seine Schritte. Textfetzen, etwas über kölsche Mädchen und etwas Unaussprechliches, das wie „Spetzebötzjer“ klang, spitzenbesetzte Unterwäsche oder so etwas in der Art, wehten zu ihm herüber, als er das Gelände der Rheinischen Landesklinik betrat.
Er widerstand dem Impuls, sich noch einmal umzusehen, und folgte dem gepflasterten breiten Einfahrtsweg, den mehrere Gebäude säumten. Zu seiner Linken führte ein spiralförmiger Anbau aus Beton zu einem Parkdeck. Rechter Hand erstreckte sich nach wenigen Metern ein lang gezogenes rotes Backsteinhaus älteren Baujahrs. Aus der schneebedeckten Grünfläche davor ragte ein Dutzend hochgewachsener Bäume, deren kahle Äste sich im Wind wiegten.
Plötzlich flatterte irgendwo ein Vogel auf. Reflexartig wandte Lutz Hirschfeld den Kopf und entdeckte zu seiner Überraschung einen grünen Papagei, der sich gerade wieder auf einem anderen Zweig niederließ. Hirschfeld ließ den Blick schweifen und bemerkte weitere grüne Tupfer in den Ästen.
Noch mehr Tiere, dachte er und musste unweigerlich lächeln. Wie viele Patienten oder Besucher hatten sich auf dem Weg in die Klinik schon gefragt, ob die Papageien nicht ihrer Fantasie entsprangen? Zugegeben, der Anblick irritierte ihn. Aber Hirschfeld vertraute seinen Sinnen und zweifelte keine Sekunde daran, dass die Vögel real waren. Mit diesem Gedanken steuerte er auf den Haupteingang der Klinik zu, der von mehreren verwaisten Blumenkübeln flankiert war. Die automatischen Glastüren glitten zur Seite und gaben den Weg ins Foyer frei.
„Kann ich Ihnen helfen?“, empfing ihn eine rundliche blonde Frau im Glaskasten gegenüber dem Eingang.
Sie saß vor einem Computer mit einem Flachbildschirm. Daneben stand ein Kofferradio, aus dem ein Karnevalsschlager plärrte.
„Ja, ich möchte meinen Vater Heinrich Hirschfeld besuchen.“
„Einen Augenblick.“ Die Frau ließ ihre grün lackierten Fingernägel über die Tastatur gleiten. „Sie müssen zur Station Süd eins A, Zimmer fünf. Gehen Sie einfach geradeaus. Dann nehmen Sie das Treppenhaus in den ersten Stock. Dort halten Sie sich links und folgen der Beschilderung. Wenn Sie den Verbindungsgang zum Südflügel passiert haben, können Sie die Station nicht mehr verfehlen.“
„Danke.“ Hirschfeld verabschiedete sich.
Auf dem Weg in die Geschlossene versuchte er, nicht darüber nachzudenken, welcher Umstand ihn hergeführt hatte. Er war hier, und das musste fürs Erste genügen, bevor er es sich anders überlegte.
Wenig später stand er vor der Akutstation. Hirschfeld drückte auf die Klingel und wartete. Er war gerade im Begriff, erneut zu klingeln, als er hörte, wie jemand von der anderen Seite einen Schlüssel ins Schloss steckte. Im Rahmen der schweren Holztür tauchte Sekunden später ein blasses Gesicht auf, das einem schmalen jungen Mann gehörte. Er trug keinen Kasack, nur der Schlüsselbund in seiner Hand identifizierte ihn als Pfleger.
„Guten Morgen“, sagte er in einem Tonfall, der weder gelangweilt klang noch von großem Interesse zeugte, „zu wem möchten Sie bitte?“
Hirschfeld wiederholte sein Anliegen.
Der Pfleger nickte und deutete den Gang entlang. „Die letzte Tür auf der rechten Seite.“
Damit verschwand er im Personalraum.
Als Hirschfeld das Zimmer fast erreicht hatte, bog ein älterer Herr in weißem Kittel um die Ecke. Sein graues Haar stand leicht zerzaust von seinem runden Schädel ab. Er trug eine Brille mit Goldrand, die nicht die richtige Stärke zu haben schien, denn er kniff unentwegt die Augen zusammen.
„Professor Konrad?“ Hirschfeld war dankbar für den Aufschub, den eine kurze Unterredung mit dem behandelnden Arzt bedeuten würde. „Mein Name ist Hirschfeld. Hatten wir wegen meines Vaters miteinander telefoniert?“
Der Mann runzelte die Stirn, dann erhellte sich sein Gesicht. „Ja natürlich.“ Er lächelte ihn freundlich über den Brillenrand hinweg an.
„Meine Wohnungsauflösung in Berlin hat leider länger gedauert als ursprünglich geplant. Ich bin daher erst gestern Abend in Bonn angekommen.“
„Schön, dass Sie bereits heute Morgen den Weg zu uns gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Umso mehr freue ich mich, Sie zu sehen.“
„Danke.“ Hirschfeld löste sich aus dem langen Händedruck, den der Professor ihm aufgenötigt hatte.
„Darf ich Ihnen vielleicht unsere Station zeigen, bevor Sie zu Ihrem Vater gehen? Während des Rundgangs hätten wir Gelegenheit, noch ein wenig über ihn zu sprechen.“
„Geht es ihm besser?“ Hirschfeld folgte Professor Konrad weiter in das Innere der Station.
Die meisten Türen, die sie passierten, waren geschlossen.
„Lassen Sie mich eines vorweg sagen: Ihr Vater ist bei uns in den besten Händen. Fortschritte zeichnen sich jedoch in den meisten Fällen erst nach geraumer Zeit ab. Nach einer Woche Klinikaufenthalt dürfen Sie nicht allzu viel erwarten, Herr Hirschfeld.“
„Verstehe.“
„Seien Sie ein wenig nachsichtiger mit Ihrem Vater und sich selbst. Für die meisten Angehörigen ist es ein Schock, wenn sie erfahren, dass mit ihnen nahe stehenden Personen etwas passiert ist, das nicht in die eigene Erfahrungswelt passt.“
Das ist milde ausgedrückt, dachte Hirschfeld und blickte sich um. Sie hatten das Ende des Gangs erreicht, der in einen Tagesraum mit mehreren Tischen mündete. Von dort gingen drei weitere Flure ab. Als sie weiterliefen, registrierte Hirschfeld, dass der rheinische Karneval auch nicht vor der Geschlossenen Halt gemacht hatte. Von den Neonlampen unter der Decke hingen bunte Luftschlangen. Auf Luftballons hatte man dagegen verzichtet.
„Das ist unser Stützpunkt, das Herzstück unserer Station“, unterbrach der Professor seinen Vortrag und deutete auf einen großen Glaskasten zu ihrer Linken. „In diesem Büro laufen im Prinzip alle Fäden zusammen. Hier findet die Medikamentenausgabe statt, werden der Therapiekalender geführt und die Dienstpläne gemacht.“
„Wie viele Patienten versorgen Sie zurzeit auf Ihrer Station?“
„Alle Zimmer sind belegt, das heißt, wir haben momentan zwanzig Patienten.“
Irgendwo schlug eine Tür. Dann hörten sie eine Frauenstimme, die aus einem der Patientenzimmer kam.
„Hunderteinundzwanzig, hundertzweiundzwanzig, hundertdreiundzwanzig, hundertvierundzwanzig …“
„Daran dürfen Sie keinen Anstoß nehmen“, sagte der Professor schulterzuckend und nickte in die Richtung, aus der die Stimme drang. „Kommen Sie, ich zeige Ihnen noch den Fernsehraum, der sich, wie Sie sich vielleicht denken können, bei allen Patienten größter Beliebtheit erfreut. Und sollten Sie das Bedürfnis nach einer Zigarette haben, tun Sie sich keinen Zwang an. Dort drüben haben wir unsere Raucherecke.“
„… hundertsechsundfünfzig, hundertsiebenundfünfzig, hundertachtundfünfzig. Hilfe!“
Hirschfeld winkte ab. „Danke, vielleicht nachher.“
Er hatte fürs Erste genug gehört und gesehen und folgte dem Professor nur aus reiner Höflichkeit in den angrenzenden Fernsehraum. Als sie das Zimmer betraten, hoben mehrere Patienten die Köpfe, um sich sofort wieder auf den Röhrenfernseher zu konzentrieren. Die meisten trugen Trainingsanzüge oder Morgenmäntel über ihren Schlafanzügen. Nur zwei von ihnen hatten an diesem Tag den Freizeitlook gegen normale Alltagskleidung getauscht. Über den Bildschirm an der Kopfseite des Raums flimmerte die Liveübertragung einer Karnevalsveranstaltung.
„In Berlin kennen Sie so etwas sicher nicht“, sagte der Professor nachsichtig. „Die Erstürmung des Beueler Rathauses ist jedes Jahr an Weiberfastnacht der Auftakt zu den jecken Tagen, wie man hier im Rheinland sagt. Nach Ihrem Besuch sollten Sie sich auch ins Getümmel stürzen, Herr Hirschfeld. Karneval ist in unserer Region wirklich ein einmaliges Erlebnis.“
„Das glaube ich Ihnen gerne.“ Hirschfeld beschloss in diesem Augenblick, sich nachher ein Taxi zu nehmen, um von weiteren Zeugnissen Rheinischen Frohsinns verschont zu bleiben.
„Na, Helmuth, mal wieder eine Besucherführung gemacht?“ Der Pfleger von vorhin tauchte unvermittelt hinter ihnen auf und klopfte Hirschfelds Begleiter auf die Schulter. „Wie hast du es diesmal geschafft, an den Kittel heranzukommen? Bei deiner letzten Therapiesitzung?“
Helmuth nickte schelmisch und fuhr sich durch die abstehenden Haare. „War ein Kinderspiel.“
„Gut, du hattest deinen Spaß, mein Lieber. Nun zieh den Kittel wieder aus und gesell dich zu den anderen. Wir sprechen später noch einmal darüber.“
„Zu Befehl.“ Der falsche Professor kicherte, tippte sich mit Zeige- und Mittelfinger an die Stirn und entledigte sich des Kittels. „Aber die Lesebrille darf ich behalten? Damit klappt es noch besser, habe ich festgestellt.“
„Treib es nicht zu bunt, mein Freund.“ Der Pfleger nahm dem Alten die Brille ab.
„War mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen“, verabschiedete sich Helmuth.
„Die Freude lag ganz auf meiner Seite.“ Hirschfeld hatte es plötzlich nicht mehr eilig, der Psychiatrie den Rücken zu kehren. Der Gedanke, dass sich sein Vater in Gesellschaft solcher Mitpatienten befand, beruhigte ihn irgendwie.
„Nehmen Sie ihm den Scherz nicht übel“, wandte sich der blasse Pfleger an Hirschfeld, nachdem sie Helmuth im Fernsehraum zurückgelassen hatten.
„Dazu besteht keine Veranlassung.“
„Schön, dass Sie das sagen. Wir hatten auch schon andere Reaktionen.“
„Das kann ich mir vorstellen.“
„Doch ich sage immer, Helmuth ist der lebende Beweis dafür, dass der Grat zwischen Normalität und Wahnsinn ein schmaler ist. Und ich kann Sie beruhigen, Sie sind nicht der erste und werden nicht der letzte Besucher sein, der auf seine kleine Einlage hereinfällt.“
„Ein gewisses schauspielerisches Talent kann man ihm in der Tat nicht absprechen.“
Sie waren inzwischen wieder an Zimmer 5 angelangt.
„Ich weiß nicht, was Helmuth über Ihren Vater erzählt hat, falls Sie über ihn gesprochen haben. Vielleicht so viel, er ist vor drei Tagen von der Nacht-und-Not auf unsere Station verlegt worden und hat sein Zimmer bisher nicht verlassen. Auf der Notstation mussten die Kollegen ihn nach dem Vorfall erst einmal ruhigstellen und fixieren. Wenn er wieder einen Schub bekommt, wird das sicherlich erneut erforderlich sein. Momentan ist das aber zum Glück nicht notwendig. Vielleicht können Sie Ihren Vater dazu bewegen, mit Ihnen eine Runde durch die Station zu gehen. Ich denke, das würde ihm ganz guttun.“
„In Ordnung, ich werde mein Bestes geben.“ Hirschfeld drückte die Türklinke hinunter.
2
Fahle Sonnenstrahlen sickerten durch einen Spalt zwischen den Holzbrettern. Mühsam öffnete sie die Augen und nahm undeutlich den Wechsel von Licht und Schatten wahr. Irgendwo in der Nähe musste sich ein Fenster befinden. Sie konzentrierte sich auf die Schemen, die wie lange knorrige Finger nach ihr griffen. Nach einer Weile erkannte sie, dass sich ein blattloser Ast draußen im Wind wiegte und das Schattenspiel verursachte.
An die vergangenen Stunden konnte sie sich nur vage erinnern. Das letzte Mal, als sie bei Bewusstsein gewesen war, hatte sie undurchdringliche Finsternis umgeben. Wieder fragte sie sich, wie lange sie schon hier war. Ein paar Stunden? Einen Tag? Oder länger? Ihrer trockenen Kehle nach zu urteilen, war mindestens eine Nacht vergangen.
Sie schloss die Augen und horchte in sich hinein. Unter ihrer Schädeldecke pochte ein brennender Schmerz. Als sie versuchte sich zu bewegen, rollte er wie eine Welle durch ihren gekrümmten Körper. Sie stöhnte auf und biss auf den Knebel, während ihre Hand- und Fußfesseln tiefer in ihre Gelenke schnitten. Tränen der Wut, in die sich kalte Panik mischte, schossen ihr in die Augen und perlten ihre Wangen hinab.
Verzweifelt sehnte sie sich in die Bewusstlosigkeit zurück. Nichts mehr hören. Nichts mehr sehen. Nichts mehr spüren. Sie war mutterseelenallein, und niemand würde ihr helfen. Wahrscheinlich vermisste sie nicht einmal jemand.
Nach einer Weile verebbte ihr Weinen in ein erschöpftes Schluchzen. Die Zweige vor dem Fenster bewegten sich jetzt ganz sachte. Noch lebte sie, auch wenn sie nicht wusste, was gerade mit ihr geschah. Während sich ihr Blick weiter an die tanzenden Schatten heftete, nahm ein Gedanke immer deutlichere Konturen an. Sie würde sich nicht ohne Gegenwehr in ihr Schicksal ergeben. Ihr Leben, so war es ihr noch vor Kurzem erschienen, hatte gerade erst begonnen. Wenn sie überleben wollte, musste sie sich so schnell wie möglich aus diesem Gefängnis befreien.
Obwohl ihre linke Körperhälfte taub war, versuchte sie, sich auf den Rücken zu drehen. Bereits nach wenigen Zentimetern stieß sie auf Widerstand. Die Kiste, in der sie gefangen war, konnte kaum größer sein als ein Schrankkoffer. Sie hielt inne, um noch einmal Atem zu holen. Dann spannte sie ihre Muskeln erneut an und drückte mit Knien und Fußsohlen gegen die massiven Seitenwände. Sofort schmerzten ihre Fingerknöchel, da sie mit dem vollen Gewicht ihres Rumpfes rücklings auf ihren Händen lag. Als sich nichts tat, nahm sie die Schultern dazu. Keuchend bäumte sie sich auf, bis sie die Kräfte verließen. Schwer fiel sie auf den Holzboden zurück und spürte deutlich, wie das Blut in ihren Ohren rauschte. Nur noch wenige Augenblicke und sie würde ohnmächtig werden. Bevor die Schwärze über ihr zusammenschlug, vernahm sie entfernt ein Geräusch. Verzweifelt kämpfte sie gegen die Bewusstlosigkeit an, doch es war bereits zu spät.
3
Lutz Hirschfeld konnte sich seit seiner Kindheit nicht entscheiden, ob er seinen Vater liebte oder hasste. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus beidem. Mit den Jahren überwog die Abneigung, die bis zum plötzlichen Tod seiner Mutter in Gleichgültigkeit umgeschlagen war. Seitdem hatte Heinrich Hirschfeld seinem Sohn allerdings keine Gelegenheit mehr gegeben, ihn zu ignorieren.
Seit Hirschfeld denken konnte, hatte er seinen Vater als einen cholerischen, rechthaberischen Mann erlebt, der seinen Gefühlen freien Lauf ließ und sich nur wenig für die Belange anderer interessierte. An erster Stelle stand für Heinrich stets die Arbeit, nicht die Familie. Als er vor dreizehn Jahren der Versetzung des Statistischen Bundesamts folgte, das ihn als angesehenen Mathematiker in die Bonner Dependance berufen hatte, weigerte sich Hirschfeld, damals noch Kriminalkommissaranwärter, sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege abzubrechen. Seine zehneinhalb Jahre jüngere Schwester Johanna hatte zu diesem Zeitpunkt dagegen keinerlei Mitspracherecht und fügte sich der Entscheidung ihres Vaters.
Am stärksten litt seine Mutter unter dem Umzug. Sie sehnte sich bis zuletzt in die alte Heimat zurück. Als Klavierlehrerin fiel es Luise Hirschfeld zwar nicht schwer, neue Schüler zu finden. Neben einer Halbtagsstelle in einer Musikschule konnte sie schnell ein paar Privatschüler dazugewinnen. Aber der große Familien- und Freundeskreis, den sie in Berlin zurücklassen musste, war durch nichts zu ersetzen. Daran änderte auch das große Haus nichts, das sie gegen die Altbauwohnung in Charlottenburg eingetauscht hatten.
Hin und wieder fragte sich Lutz Hirschfeld, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wäre nicht seine Mutter, sondern sein Vater einem Herzinfarkt erlegen. Es war müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Allerdings ertappte sich Hirschfeld hin und wieder bei diesem Gedanken und musste sich eingestehen, dass vieles anders verlaufen wäre, wenn es seinen Vater getroffen hätte.
Nach dem Tod seiner Mutter ließ sich sein Vater immer mehr gehen. Er fing an zu trinken, woraus er mit der Zeit keinen Hehl mehr machte. Ein knappes Jahr nach der Beerdigung seiner Frau brach er das erste Mal zusammen und wurde danach für mehrere Monate krankgeschrieben. Danach wechselten sich Wochen, in denen er sich wieder gefangen zu haben schien, mit Phasen der absoluten Selbstaufgabe ab. Es konnten Tage vergehen, bis Heinrich es von der Couch schaffte. Nur der Gang zur Toilette und zum Kühlschrank, um sich wieder mit neuem Alkohol einzudecken, bot eine klägliche Abwechslung von der Besinnungslosigkeit, die dazwischenlag.
Trotz der räumlichen und emotionalen Entfernung, die zwischen ihnen bestand, war Hirschfeld der Verfall seines Vaters nicht entgangen. Bei seinen Besuchen, zu denen er sich regelmäßig zwang, musste er mit ansehen, wie die Fassade eines Mannes zerbröckelte, der es Zeit seines Lebens gewohnt war, den Ton anzugeben. Dahinter kam ein Mensch zum Vorschein, der seit einem halben Jahr nicht einmal mehr in der Lage war, sich regelmäßig zu waschen.
An ihre letzte Begegnung konnte sich Hirschfeld nur allzu gut erinnern. Der Anlass ihres Streits war vergleichsweise nichtig gewesen, aber die Ohrfeige, zu der sich sein Vater hinreißen ließ, hatte er noch tagelang gespürt. Nach diesem Vorfall zog sich Hirschfeld eine Weile zurück. Erst Johannas Anruf an Heiligabend veranlasste ihn dazu, seine Gefühle zurückzustellen und um die Beschleunigung seiner Versetzung zu bitten, die er bereits vor zwei Jahren beantragt hatte.
Da hatte er noch nicht ahnen können, dass die Exzesse seines Vaters steigerungsfähig waren. Die Kopie des Polizeiberichts, der den bisherigen Tiefpunkt seines Vaters dokumentierte, lag noch immer ungelesen zwischen Wäschestapeln in Hirschfelds Koffer.
Als Hirschfeld das Krankenzimmer betrat, schoss ihm durch den Kopf, dass sein Vater, nüchtern betrachtet, letztlich seinen Willen bekommen hatte. Hirschfeld war ihm nach Bonn gefolgt. Wenn auch nicht ganz freiwillig.
„Vater?“ Hirschfeld schloss die Tür hinter sich. „Ich bin’s, Lutz“, fügte er hinzu, als die Antwort ausblieb.
Rechts vom Eingang führte eine Tür in ein abgetrenntes Badezimmer, an der Wand daneben war ein Waschbecken angebracht. Dahinter fungierte ein ausladender Wandschrank als Raumteiler, der über die Hälfte der Zimmerbreite einnahm. Vor dem Fenster geradeaus stand ein schlichter Schreibtisch mit einem Holzstuhl davor. Auf der Rückseite des Schranks befand sich das Bett, das dem Patienten durch seine Position eine gewisse Intimsphäre gewährte.
Heinrich Hirschfeld saß auf der Bettkante und starrte mit unbeweglicher Miene in das Schneegestöber, das die Welt draußen schemenhaft verzerrte. Er trug einen beige-braun karierten Schlafanzug. Seine nackten Füße steckten in grauen Filzpantoffeln.
„Vater?“, wiederholte Hirschfeld und zog sich den Schreibtischstuhl heran. Er warf seinen Mantel über die Lehne und setzte sich. „Wie geht es dir?“
Während Hirschfeld auf eine Reaktion wartete, studierte er das Profil seines Vaters, der ihn immer noch keines Blickes würdigte. Er entdeckte Ähnlichkeiten, die ihm bisher nie ins Auge gefallen waren: die gleiche kantige Stirn, die gleiche längliche Nase. Die hohen Wangenknochen und das spitze Kinn hatte er dagegen von seiner Mutter geerbt.
„Gut, wenn du nicht reden willst, schweigen wir eben. Hab nichts dagegen, Vater“, sagte Hirschfeld.
Er lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. Wenn er eines von seinem alten Herrn mit auf den Weg bekommen hatte, war es Dickköpfigkeit.
„Was willst du hier? Ich habe nicht darum gebeten, dass du herkommst.“ Heinrich wich nach wie vor seinem Blick aus.
„Ich freu mich auch, dich zu sehen.“ Hirschfeld schluckte den zweiten Teil des Satzes herunter.
Es hatte keinen Sinn, sich mit seinem Vater zu streiten. Nach dem Telefonat mit Professor Konrad war Hirschfeld darüber im Bilde, dass sein Vater einen schweren Schub hinter sich hatte, auf den eine Depression gefolgt war. Offensichtlich hatte ihn die immer noch fest im Griff. Und dagegen kam Hirschfeld nicht an.
„Ich soll dich von Jo grüßen“, wechselte er daher das Thema.
„Wo steckt deine Schwester diesmal?“
„In New York, das weißt du doch. Sie besucht einen Schauspielworkshop. Das nächste Semester fängt erst wieder im April an.“
„Jaja. Ist mir ganz recht, dass sie mich nicht so sieht.“
„Das kann ich nachvollziehen.“
Jo war mit ihren vierundzwanzig Jahren im Augenblick noch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie sich um ihren Vater kümmern könnte. Hirschfeld nahm ihr das nicht übel, denn an ihrer Stelle wäre es ihm wahrscheinlich nicht anders ergangen.
„Deine Mutter könnte sich hier allerdings mal blicken lassen.“
Lutz Hirschfeld schwieg betroffen. Er war nicht darauf vorbereitet gewesen, dass die Psychose seines Vaters derartige Gedächtnislücken einschloss. Bevor er darüber nicht mit Professor Konrad gesprochen hatte, würde er auf diesen Punkt nicht näher eingehen. Denn er wollte sich lieber nicht ausmalen, wie sein Vater reagierte, wenn er ihn erneut mit dem Tod seiner Frau konfrontierte.
„Aber wahrscheinlich ist sie mal wieder zu sehr mit ihren lieben kleinen Schülern beschäftigt. Das wäre ja nichts Neues.“
Obwohl seine Mutter tot war, traf ihn der Seitenhieb seines Vaters. Sie hatte sich nie beklagt, selbst dann nicht, als sie ihr altes Leben in Berlin hatte aufgeben müssen. Ihr Egoismus vorzuwerfen, glich einem Meineid.
„Mach dir keine Gedanken, ich werde mich die nächste Zeit um dich kümmern, Vater.“
„So?“ Heinrich drehte zum ersten Mal den Kopf und schaute ihn direkt an.
Hirschfeld bemerkte erst jetzt, dass die Augen seines Vaters tief in ihre Höhlen zurückgetreten waren. Sein Blick wanderte unstetig hin und her, bevor er sich abwandte und wieder aus dem Fenster sah.
Draußen hatte es aufgehört zu schneien. Hirschfeld fragte sich, wie lange der Schnee wohl liegen bleiben würde.
„Brauchst du irgendetwas?“
„Hm.“
„Du kannst es mir ruhig sagen.“
„Das Essen schmeckt abscheulich“, antwortete sein Vater. „Außerdem gibt es hier nichts Ordentliches zu trinken. Ich bekomme den ganzen Tag nur Tee, Tee und nochmals Tee. Bei dem Geld, das ich der Krankenkasse jeden Monat in den Rachen werfe, könnte ich wohl etwas Besseres erwarten, oder?“
Ganz der Alte, dachte Hirschfeld und war sich gleichzeitig bewusst, dass dieser Eindruck täuschte.
„Ich werde sehen, was ich in dieser Hinsicht für dich tun kann.“
„Gut, aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit.“
Hirschfeld nickte knapp.
„Was macht die Arbeit?“
„Ich habe gerade Urlaub.“ Er verschwieg, dass er seinen ersten Dienst in Bonn bereits am Montag antrat.
Hirschfeld wollte sich noch ein wenig Zeit lassen, bevor er seinen Vater von seinem Umzug in die ehemalige Bundeshauptstadt erzählte. In den letzten Tagen war er nicht dazu gekommen, sich darüber Gedanken zu machen, auf welche Art und Weise er es ihm mitteilen würde.
„Wie? Nicht auf Verbrecherjagd? So einen Luxus möchte ich auch mal haben.“
Die letzten Jahre straften die Worte seines Vaters Lügen. Doch Lutz Hirschfeld ersparte sich den Kommentar, denn der alte Herr würde in den nächsten Monaten noch genügend Gelegenheit haben, sich mit dieser Thematik eingehender zu beschäftigen.
„Wie ist es dir hier ergangen?“, erkundigte sich Hirschfeld daher.
„Worauf willst du hinaus, Junge?“
„Ich will auf gar nichts Bestimmtes hinaus“, sagte Hirschfeld geduldig. „Mich interessiert nur, wie du hier behandelt wirst.“
„Meinst du die Therapie, die man mir verordnet hat?“ Heinrich deutete bei dem Wort „Therapie“ mit den Fingern Anführungszeichen an.
„Zum Beispiel.“
„Dieser ganze Vergangenheitsbewältigungsmist ist schlicht und ergreifend Humbug, wenn du mich fragst. Ich hatte einen schlechten Tag. Das war alles. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich überhaupt nicht, was ich unter all den Verrückten zu suchen habe! Hast du vorhin zum Beispiel die Alte gehört, die den ganzen Tag irgendwelche schwachsinnigen Dinge zählt? Wenn du nicht verrückt bist, wirst du es spätestens nach drei Tagen in dieser Irrenanstalt sein. Darauf kannst du Gift nehmen!“
Lutz Hirschfeld erwiderte nichts und wartete darauf, dass sein Vater mit seiner Ansprache fortfuhr.
„Hast du gar nichts dazu zu sagen?“
„Ich höre dir einfach zu, das ist alles.“ Er fuhr sich mit der Hand über den Dreitagebart.
„Mein Sohn ist mal wieder um keine Ausrede verlegen.“
„Das ist deine Sicht der Dinge.“
„Ja, allerdings!“ Heinrich Hirschfeld wurde lauter und griff wütend nach seiner Brille, die er auf dem Nachttisch neben dem Bett abgelegt hatte. „Wahrscheinlich steckst du noch mit den Weißkitteln unter einer Decke! Würde ich dir ohne Weiteres zutrauen!“
Hirschfeld kannte das Spiel, das jetzt folgen würde. Regte sich sein Vater über irgendetwas auf, hatte er die Angewohnheit, seine Brille unentwegt auf- und abzusetzen.
„Beruhig dich bitte wieder. Wir wollen uns nicht streiten.“
„Was wir wollen, weiß ich nicht. Ich dagegen verlange ein wenig Respekt von meinem Sohn. Das ist wohl das Mindeste!“
„Natürlich.“
„Hör auf, mich so herablassend zu behandeln. Bild dir bloß nicht ein, ich hätte deine Masche nicht durchschaut.“
„Bitte, das bringt uns nicht weiter, Vater.“
„Papperlapapp! Du hast keine Ahnung, wie es hier drinnen zugeht. Alle drei Sekunden kommt jemand vorbei und glotzt dir auf die Finger. Ich kann nicht einmal in der Nase bohren, ohne dass es die da draußen mitkriegen.“
„Jetzt übertreibst du. Ich bin mir sicher, dass jeder nur dein Bestes will.“
„Mein Bestes“, äffte Heinrich ihn nach. „Du bist ja lustig!“
„Du machst gerade eine schwere Zeit durch“, versuchte Hirschfeld, seinen Vater zu besänftigen. „Und du hast recht, ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir geht. Ich bin jedoch hier, um dir da durchzuhelfen.“
„Wie gütig von dir, aber deine Almosen kannst du für dich behalten.“
„Ich glaube, wir sollten unsere Unterhaltung ein anderes Mal fortsetzen.“ Hirschfeld stand auf.
Obwohl ihm klar war, dass sein Vater die Hälfte der Zeit nicht wusste, was er da von sich gab, brauchte er frische Luft, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
„Jaja, geh nur! Das kannst du ja am besten“, rief sein Vater, nachdem Lutz den Stuhl zurück an seinen Platz gestellt und seinen Mantel angezogen hatte. „Ich komme auch ohne dich zurecht! Von mir aus brauchst du gar nicht mehr wiederzukommen. Ist wahrscheinlich besser für uns beide.“
„Ich besuche dich morgen wieder“, überging Hirschfeld seine Worte.
„Ach, mach doch, was du willst!“, brüllte Heinrich ihm hinterher.
Worauf du dich verlassen kannst, alter Mann, antwortete Hirschfeld in Gedanken und trat aus dem Krankenzimmer. Auch wenn er nicht wusste, was ihn in Bonn erwarten würde, stand nach seinem Besuch zumindest eines fest: Die nächste Zeit verhieß alles andere, als langweilig zu werden.
4
Eiskaltes Wasser riss sie aus der Bewusstlosigkeit. Für den Bruchteil einer Sekunde wusste sie nicht, wo sie sich befand. Ihre Fesseln erinnerten sie jedoch augenblicklich daran, dass sie nicht aus einem Albtraum aufgewacht war, sondern sich mitten darin befand.
Sie schnappte heftig nach Luft. Als sie versuchte, den Kopf zu drehen, registrierte sie, dass sich die Lichtverhältnisse radikal verändert hatten. Das Zwielicht war flackernder Neonbeleuchtung gewichen. Erst jetzt bemerkte sie, dass der Deckel von der Holzkiste entfernt worden war. Gerade als die Hoffnung in ihr aufstieg befreit zu werden, entdeckte sie eine Gestalt, die reglos über ihr stand und auf sie herab starrte. Das Gesicht war schneeweiß. Anstelle des Mundes befand sich eine schmale Öffnung. Die tief liegenden Augen, die sich hinter den Sehschlitzen der Maske verbargen, konnte sie nur erahnen.
Als sich eine behandschuhte Hand über den Rand der Kiste schob und nach ihrem nassen Haar griff, setzte ihr Herzschlag für einen Augenblick aus. Sie fühlte sich wie ein Stück Vieh, das zur Schlachtbank geführt wurde.
Und in diesem Moment wünschte sie sich, sie wäre bereits tot.
5
Der Reisewecker, den Lutz Hirschfeld am Köln-Bonner-Flughafen gekauft hatte, gab einen kläglichen Ton von sich. Im Halbschlaf tastete er Richtung Nachttisch und schlug auf das Plastikgehäuse. Schließlich gelang es ihm, den Wecker auszuschalten. In diesem Moment sprangen die Ziffern der Digitalanzeige auf 7:00 Uhr. Hirschfeld langte nach der Packung Zigaretten, die er vom Nachttisch hinuntergeworfen hatte. Mit der Zigarette im Mundwinkel suchte er nach seinem Zippo, das er auf dem hochflorigen Teppichboden neben seinen Chucks fand. Er ließ das Feuerzeug aufschnappen und fuhr mit dem Daumen über das Zündrad.
„War klar“, murmelte er. Kein Benzin mehr.
Hirschfeld warf das Feuerzeug auf die Bettdecke und riss die Nachttischschublade auf. Wenigstens hatte dieses Hotel für Streichhölzer gesorgt. Immerhin verfügt es überhaupt über ein Raucherzimmer, dachte er, als er das Zündholz aufflammen ließ und die Zigarette in die Flamme hielt. Dann blies er es aus und platzierte das abgebrannte Stück Holz auf dem Nachttisch, da er keine Lust hatte, aufzustehen und den Aschenbecher zu suchen. Hirschfeld drehte sich wieder auf den Rücken, legte einen Arm unter seinen Kopf und nahm ein paar Züge. Mit den Augen folgte er den dünnen Rauchsäulen, die zur Decke aufstiegen. Als die Glut abzufallen drohte, setzte er sich langsam auf. Er hielt die Linke schützend unter die Zigarette, verließ das Bett und schnippte die Asche in das schmale Waschbecken im angrenzenden Bad. Während sich der kleine, weiß gekachelte Raum mit Rauch füllte, betrachtete sich Hirschfeld im Spiegel. Er sah blass und müde aus, ein Anblick, der ihm in den letzten Monaten vertraut geworden war.
Diesen Umstand schrieb er weniger seinem beruflichen Neuanfang in Bonn zu als vielmehr der Tatsache, dass die Vergangenheit ihn Schritt für Schritt einzuholen drohte. Der Besuch bei seinem Vater hatte alte Wunden aufgerissen, musste sich Hirschfeld widerwillig eingestehen. Im Grunde war er es müde, sich in seiner Gegenwart wie ein ungezogener Schuljunge zu fühlen. Er war vierunddreißig Jahre alt und hatte das Gefühl, dass sie beide im Begriff waren, die Rollen zu tauschen. Das machte die Sache nicht einfacher.
Hirschfeld fuhr sich durch das ungekämmte Haar und fragte sich, warum er nicht länger geschlafen hatte. Andererseits wollte er seinen ersten Arbeitstag in Bonn ohne Hektik beginnen. Sein Dienst fing erst um elf Uhr an. Zeit genug also, noch eine Zigarette zu rauchen und danach eine heiße Dusche zu nehmen.
Eine Dreiviertelstunde später stand Hirschfeld vor seinem geöffneten Koffer, den er bei seiner Ankunft vor dem Wandschrank auf dem Boden abgestellt und noch nicht ausgepackt hatte. Wasser tropfte von seinen Haaren auf die Kleidungsstücke, als er sich daranmachte, seine Garderobe für den heutigen Tag auszuwählen. Er entschied sich für Bluejeans, ein weißes Hemd, einen grauen Pullunder und ein bügelfreies dunkelblaues Jackett.
Um halb zehn kehrte er in sein Zimmer zurück. Er hatte im Bistro drei Tassen Kaffee getrunken und Zeitung gelesen. Bei jedem Nachschenken hatte die Bedienung ihm das Frühstücksbüfett ans Herz gelegt, doch Hirschfeld hatte wie an den Tagen zuvor keinen Appetit verspürt.
Er trat ans Fenster und schaute hinunter in den Hof. Eine flache Treppe führte zu einer verwaisten Sonnenterrasse, die von kahlen Bäumen bewachsen war. Es hatte angefangen zu regnen. Der Schnee war bereits am Vortag geschmolzen. Innerhalb weniger Augenblicke verwandelte sich der Nieselregen in einen heftigen Schauer, der einen Wasserfilm über die Scheibe zog und die Welt dahinter zerfließen ließ.
Als sich Hirschfeld umwandte, fiel sein Blick auf den Beistelltisch neben dem moosgrünen Polstersessel. Darauf lag der Polizeibericht über seinen Vater. Immer noch ungelesen.
6
Da machst du Augen! Hab dich gefunden. Gefunden, gefunden, gefunden … Konntest dich nicht länger vor mir verstecken. Nach all den Jahren. Hab immer an dich gedacht. Jeden Tag. Und nichts vergessen. Erinnerst du dich?
Jetzt liegst du da und kannst dich nicht mehr rühren. Und wenn du schreist, wird dich niemand hören. Dafür habe ich gesorgt.
Deine Zeit ist gekommen. Es gibt kein Zurück. Habe lange auf diesen Moment gewartet. Mir jede Sekunde unseres Wiedersehens ausgemalt. Bis ins kleinste Detail. Aber erwarte kein Mitleid. Keine Gnade. Kein Zögern. Weiß genau, was ich tue.
Du zitterst ja. Und deine Augen sind weit aufgerissen. Warte nur, bis du deine Strafe bekommst. Dann wirst du dir wünschen, nie geboren zu sein.
Fürchtest du dich? Bereust du? Das wird dir nicht mehr helfen. Jetzt bin ich dran, jetzt wirst du büßen für das, was du mir angetan hast!
7
„Guten Morgen“, begrüßte einer der beiden Uniformierten hinter der Rezeption des Bonner Polizeipräsidiums Hirschfeld. Das blaue Hemd spannte über dem Bauch des Beamten. Er hatte ein joviales Lächeln aufgelegt und setzte gerade zu einer Frage an.
„Kriminalhauptkommissar Hirschfeld“, kam er ihm zuvor, „ich werde erwartet.“
Der Beamte klappte den Mund wieder zu. Endlich nickte er und griff zum Telefon.
Als er wieder auflegte, sagte er: „Einen Augenblick, Sie werden abgeholt.“
Der Uniformierte deutete auf ein paar Sitzgelegenheiten. Hirschfeld bedankte sich, stellte sich neben einen der mit blauem Stoff bezogenen Hocker und wartete.
„Lutz Hirschfeld?“, fragte eine raue Bassstimme hinter ihm.
Zweifellos bin ich nicht der einzige Raucher im Kommissariat, schoss es Hirschfeld durch den Kopf, als er sich umwandte. Vor ihm stand ein weißhaariger Mann in den Fünfzigern. Er hatte ungewöhnlich blaue Augen, die ihn hinter einer randlosen Brille aufmerksam musterten, und trug einen dunkelgrauen Anzug mit einem hellgrauen Hemd. Auf eine Krawatte hatte er verzichtet. In der rechten Hand hielt er einen Becher mit dampfendem schwarzem Kaffee.
„Achim Noack“, stellte er sich vor und streckte Hirschfeld umständlich seine Linke entgegen. „Willkommen in Bonn, Lutz.“
Hirschfeld drückte die dargebotene Hand zögerlich, um sich schnell wieder aus dem ungewohnten Griff zu lösen. Das erste Zusammentreffen mit seinem direkten Vorgesetzten hatte er sich anders vorgestellt. Der Leiter des Kriminalkommissariats 11 lächelte entschuldigend und bedeutete Hirschfeld, ihm zu folgen. Nachdem sie eine große Glastür erreicht hatten, fingerte Noack ein ausgebeultes Lederportemonnaie aus der Jacketttasche und hielt es mit dem transparenten Außenfach auf der Rückseite, in der eine weiße Zugangskarte steckte, vor ein Lesegerät. Als die LED-Lampe grün aufleuchtete, öffnete sich die Tür lautlos. Der Leiter des KK 11 führte Hirschfeld durch einen breiten Flur, der mit Stäbchenparkett ausgelegt war. Sie passierten einen Durchgang und ließen drei nebeneinanderliegende Personenaufzüge hinter sich.
„Wir müssen nur ein Stockwerk höher“, erklärte Noack und steuerte auf eine frei stehende Treppe zu. „Genieß die Aussicht.“
Sie befanden sich in einem gläsernen Flur des fünfgeschossigen Gebäudes aus Stahl und Beton. Als sie die Treppe hinaufstiegen, konnte Hirschfeld einen Blick in das Atrium werfen. Zu dieser Jahreszeit war der Innenhof nur spärlich bewachsen. Auf der ersten Ebene angekommen, erreichten sie nach ein paar Schritten einen lang gestreckten, weiß gestrichenen Flur, der den gläsernen Hauptgang kreuzte.
„Ich bitte um Nachsicht, dass ich mich nicht mit Förmlichkeiten aufhalte, aber die Zeit drängt ein wenig“, fuhr Noack im Gehen fort. Bei jedem Wort tanzte sein grauer Schnauzbart auf und ab. „Die Kriminaldirektorin hat in zwanzig Minuten kurzfristig eine Unterredung mit dem Polizeipräsidenten und ist danach bei einem Auswärtstermin. Doch sie hat darauf bestanden, dich vorher noch persönlich zu begrüßen.“
Hirschfeld versuchte, das Tempo zu halten, und wunderte sich, dass der Kaffee in Noacks Becher noch nicht übergeschwappt war.
Der Leiter des KK 11 öffnete eine der Verbindungstüren erneut mit seiner Chipkarte. Vom Flur gingen mehrere Räume ab. Ein gemusterter beigefarbener Teppichboden schluckte ihre Schritte. Irgendwo in der Nähe waren gedämpfte Stimmen zu hören.
„Ich bin nicht beleidigt, wenn Frau Richter heute keine Zeit für mich hat“, sagte Hirschfeld.
„Keine falsche Bescheidenheit, die Zeit muss sein. Die Kriminaldirektorin hat sich im Vorfeld sehr intensiv mit deinem Werdegang in Berlin beschäftigt. Deine Karriere ist beispiellos. Wir setzen große Erwartungen in dich und deine Arbeit.“
„Danke, jetzt fühle ich mich schon viel wohler in meiner Haut.“
„Sicher“, erwiderte Noack abwesend, öffnete mit der Schulter eine Zwischentür, die ohne elektronisches Zugangssystem auskam, und ließ ihm den Vortritt.
Hirschfeld war sich nicht sicher, ob der Erste Kriminalhauptkommissar die Ironie verstanden hatte.
Nach ein paar Metern blieb Noack vor einer Tür stehen und klopfte an.
„Treten Sie ein!“, drang eine Stimme aus dem Inneren des Büros.
Noack kam der Aufforderung nach, Hirschfeld folgte ihm und schloss die Tür hinter sich.
„Die Kriminaldirektorin erwartet Sie bereits“, nahm Edith Richters Sekretärin sie in Empfang und wies mit der Hand auf eine weitere Tür. „Sie können gleich durchgehen.“
„Ich freue mich, dass Sie zu uns nach Bonn gefunden haben, Herr Hirschfeld.“ Die Kriminaldirektorin kam ihnen mit ausgestreckter Hand entgegen.
Sie war hinter ihrem ausladenden Schreibtisch aufgestanden und gab erst Hirschfeld und dann Noack die Hand, der sich immer noch an seinem Kaffeebecher festhielt.
Die Leiterin der Direktion Kriminalität war zierlich und reichte Hirschfeld gerade einmal bis zur Brust. Trotzdem strahlte sie eine natürliche Autorität aus. Sie hatte dunkelbraunes, kinnlanges Haar, das von feinen grauen Strähnen durchzogen war. An diesem Tag hatte sie sich für ein schlichtes graues Kostüm mit schwarzen Pumps entschieden und war dezent geschminkt. Bis auf einen Ehering trug sie keinen Schmuck. Hirschfeld schätzte Edith Richter auf Mitte fünfzig, auch wenn sie deutlich jünger aussah.
„Vielen Dank.“ Hirschfeld erwiderte das warme Lächeln, das die Kriminaldirektorin ihm geschenkt hatte.
„Darf ich vorstellen? Das ist Kriminaldirektor Ernst Friedrich Schumacher, Leiter der Kriminalinspektion eins.“
Hirschfeld hatte den schlanken Mann Ende fünfzig im dunkelblauen Maßanzug bereits beim Eintreten bemerkt. Er saß mit übergeschlagenen Beinen auf der Kante von Edith Richters Schreibtisch und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Schumacher trug sein grau meliertes Haar kurz und mit einem strengen Seitenscheitel. Schumachers Gesicht hatte eine künstliche Bräune. Sein Rasierwasser war aufdringlich und hing wie eine schwere Wolke über dem Büro.
„Grüß dich, Ernst Friedrich“, sagte Achim Noack.
Schumacher nickte dem Leiter des KK 11 zu. Es war nicht zu übersehen, dass es ihm missfiel, von einem Untergebenen geduzt zu werden. Hirschfeld vermutete, dass sich die beiden von der Ausbildung her kannten. Denn auf Sympathie beruhte diese vertraute Anrede sicher nicht.
„Sehr erfreut“, log Hirschfeld, trat zum Leiter der Kriminalinspektion 1 und schüttelte ihm die Hand. Von der ersten Sekunde an wusste er, dass er mit Schumacher nicht warm werden würde.
Wie Hirschfeld erwartet hatte, hielt der Kriminaldirektor es nicht für notwendig, sich von seinem Platz zu erheben. Stattdessen taxierte er ihn ungeniert. Als Schumacher die Hand wieder sinken ließ, kreuzte er wieder die Arme vor der Brust. Dabei entblößte sein Jackettärmel eine teure Golduhr.
„Eine Rolex Daytona. Gelbgold. Achtzehn Karat“, kommentierte er, als er Hirschfelds Blick bemerkte. „Da müssen Sie sich noch ein paar Jahre anstrengen, bis Sie sich auch so ein Prachtstück leisten können.“
„Ich unterbreche Ihre Unterhaltung nur ungern, meine Herren“, schaltete sich Edith Richter ein, „aber ich möchte mich gerne noch kurz unter vier Augen mit Kriminalhauptkommissar Hirschfeld unterhalten.“
Noack und Schumacher folgten der Aufforderung der Kriminaldirektorin und verließen das Büro, während Edith Richter wieder zu ihrem Stuhl zurückkehrte.
„Bitte nehmen Sie für einen Moment Platz. Wollen Sie nicht Ihren Mantel ablegen?“
„Danke.“ Hirschfeld setzte sich auf einen der Besucherstühle vor ihrem Schreibtisch, nachdem er sich seines Ulsters entledigt hatte.
„Ich würde Ihnen gerne einen Kaffee anbieten, doch ich fürchte, dazu bleibt uns leider keine Zeit mehr.“
„Kein Problem.“
„Wie geht es Ihrem Vater?“, kam Edith Richter direkt zum Punkt.
Hirschfeld hätte mit jeder Frage gerechnet, mit Ausnahme von dieser.
Er musste sich für einen Augenblick sammeln, dann sagte er vage: „Den Umständen entsprechend.“
„Verstehe.“ Die Kriminaldirektorin stützte die Ellenbogen auf den Tisch und legte die Fingerspitzen aneinander. „Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Hirschfeld, aber ich bin über die Gründe Ihres Wechsels nach Bonn informiert. Ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht einfach ist. Immerhin haben Sie in Berlin hervorragende Arbeit geleistet und sich den Respekt Ihrer Vorgesetzten und Kollegen erarbeitet. Bei uns werden Sie wieder bei null anfangen. Das ist Ihnen sicher bewusst.“
„Ich habe nichts anderes erwartet.“
„Trotzdem möchte ich Ihnen sagen, dass ich für Sie immer ein offenes Ohr haben werde.“
„Das ist sehr freundlich von Ihnen.“
„Ich sage das nicht nur, ich meine es auch so. Wenn Sie also Schwierigkeiten haben sollten, sich hier einzugewöhnen …“ Die Kriminaldirektorin legte eine Pause ein.
Lutz Hirschfeld wusste, auf wen sie anspielte.
„… behalten Sie es bitte nicht für sich“, vollendete sie den Satz.
8
Weiß nicht, was ich falsch gemacht hab. Warum werd ich wieder bestraft? War doch ganz brav. Hab’s zumindest versucht. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Nichts gemerkt. Vielleicht bin ich noch zu klein. Die anderen nennen mich immer Baby. Oder Heulsuse. Dabei bin ich schon groß. Als ich aufgewacht bin, wusste ich’s sofort. Musste gar kein Licht anmachen. Alles war nass. Erst war es warm, dann wurde es kalt unter mir. Bin still liegen geblieben. Ganz lang, bis es nicht mehr ging. Und jetzt weiß es der ganze Schlafsaal. Kriege Angst von dem Geschrei und halte mir die Ohren zu. So fest ich kann. Duck mich und mach mich ganz klein. Aber es hilft nichts. Meine Wangen brennen. Die paar Backpfeifen schaden nicht, sagen sie. Das kann schon sein. Was weiß ich schon? Hab Glück, dass ich überhaupt hier sein darf.
Mein Laken muss ich auswaschen, die halbe Nacht. Meine Finger werden schon ganz runzlig vom kalten Wasser. Wär möglich, dass ich Schwimmhäute bekomme. Wie ein Frosch. So grün und glitschig. Dann hüpf ich einfach weg. Hüpf, hüpf, hüpf. Weit fort. Wo mich niemand findet.
9
„Du musst der Neue sein.“ Ein blondhaariger Typ mit Brille steckte den Kopf zu Hirschfelds Büro herein.
Hirschfeld hatte nach dem Gespräch mit Edith Richter einige Formalitäten erledigt. Er hatte bei den Kollegen des KK 15 vorbeigeschaut und in der Lichtbildstelle Aufnahmen für seinen neuen Dienstausweis machen lassen. Mittags hatte er der Cafeteria im Erdgeschoss, die an den Wänden mit bunten Clownsgesichtern aus Plastik geschmückt war, einen Besuch abgestattet und einen Salat gegessen. Danach hatte er sein Büro ausfindig gemacht, das er sich mit einem Kollegen teilte.
„Ich bin Kriminalkommissar Christian Hellmann“, fuhr der Blonde fort.
Er hatte eine hohe Stirn, blaue Augen und auffällig schmale Lippen. Seine Brille hatte eine dezente Silberfassung am oberen Rand. Er trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Trotz seines jungen Alters hatte sich Hellmann ein reichlich konservatives Äußeres zugelegt. In der Schule, war sich Hirschfeld sicher, hatte der kleine Christian es schwer gehabt.
„Kriminalhauptkommissar Lutz Hirschfeld.“
„Ich weiß, ich habe schon viel von dir gehört.“
Warum muss das jeder erwähnen, der mir heute begegnet?, dachte Hirschfeld und bat Hellmann einzutreten.
„Um es gleich vorwegzunehmen, Lutz“, Hellmann senkte die Stimme im Näherkommen, „ich beneide dich wirklich nicht, dass du Kirchhoff als Partner abbekommen hast.“
Was für ein netter Empfang.
„Ich hatte noch nicht das Vergnügen.“ Hirschfeld lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Hellmann ging ihm bereits jetzt auf die Nerven.
„Ja richtig. Unser Umstandskommisssar hat heute Urlaub.“
„Karnevalist?“, mutmaßte Hirschfeld aus reiner Höflichkeit und hoffte inständig, dass Hellmann ihn nicht in ein längeres Gespräch verwickelte.
„Du meinst, weil heute Rosenmontag ist?“
Als der Wechsel nach Bonn feststand, hatte Hirschfeld es für einen Wink des Schicksals gehalten, dass der Fünfzehnte des Monats ausgerechnet auf diesen Tag fiel.
„Wenn ich ehrlich bin“, fuhr Hellmann fort, „weiß ich nicht, was Peter in seiner Freizeit treibt.“
„Ach so.“ Hirschfeld schaute beiläufig auf seine Armbanduhr.
„Seinem Gemütszustand nach zu urteilen, gehört er nicht zu der ausgelassenen Sorte Mensch. Er redet nicht viel, aber das wirst du noch schnell genug herausfinden.“
Weniger Gerede würde dir auch ganz guttun. Hirschfeld hatte etwas gegen Verbrüderungen und gab nichts auf die Meinung anderer, bevor er sich nicht selbst ein Bild gemacht hatte.
„Und? Bist du heute schon dem General begegnet?“ Hellmann lächelte und entblößte dabei eine Reihe makelloser Zähne. „Ich nehme an, dass du die Führungsebene bereits kennengelernt hast.“
„Welchem General?“
„Na, Schumacher.“
„Du meinst den Leiter der Kriminalinspektion?“
„Genau.“
„Ihr nennt ihn General?“
„Ja, irgendwie hat er einen militärischen Habitus, findest du nicht?“, erwiderte Hellmann in fast schwärmerischem Ton und stützte sich mit beiden Händen auf Hirschfelds Schreibtisch ab.
Wenn du Schumacher etwas abgewinnen kannst, haben wir schon mal nicht dieselbe Wellenlänge, dachte Hirschfeld und blickte jetzt demonstrativ auf seine Uhr. Seine Zeit war zu kostbar, um sie mit dem Austausch von Belanglosigkeiten zu vergeuden.
„Doch er ist die Karriereleiter ziemlich schnell hinaufgeklettert“, redete Hellmann unbeirrt weiter und richtete sich wieder auf. „Das muss man ihm lassen.“
„Ich möchte nicht unhöflich sein“, unterbrach er Hellmann und deutete auf mehrere Akten, die vor ihm auf dem Tisch lagen, „aber ich muss mich noch in ein paar Fälle einlesen.“
„Natürlich, kein Problem. Wir haben ab jetzt ja öfter Gelegenheit für ein Gespräch unter vier Augen.“ Hellmann wandte sich zum Gehen.
Lutz Hirschfeld tat so, als vertiefte er sich wieder in eine der Akten. Als die Tür zufiel, schloss Hirschfeld die Augen und hoffte, dass Hellmann seine Drohung nicht so schnell in die Tat umsetzen würde.
10
Wach auf! Du bist ein ungezogenes Mädchen. Ich bin noch nicht fertig mit dir, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich habe dir noch nicht erlaubt zu gehen. Mach die Augen auf!
So schnell stirbt kein Mensch. Aber du bewegst dich nicht mehr. Auch nicht, wenn ich dich anstoße. Dein Körper ist ganz verdreht. Das kann ja nicht gut gehen. Außerdem bist du kalt wie Eis. Und deine Haut ist wie aus Wachs.
Jetzt suche ich nach deinem Puls. Nichts. Ich schlage dir ins Gesicht. Doch du rührst dich immer noch nicht. Wenn ich deine Lider hebe, starren mich glasige Augen an. Wie konnte das passieren? Armes kleines Mädchen, armes kleines Mädchen. Was mach ich nun mit dir?