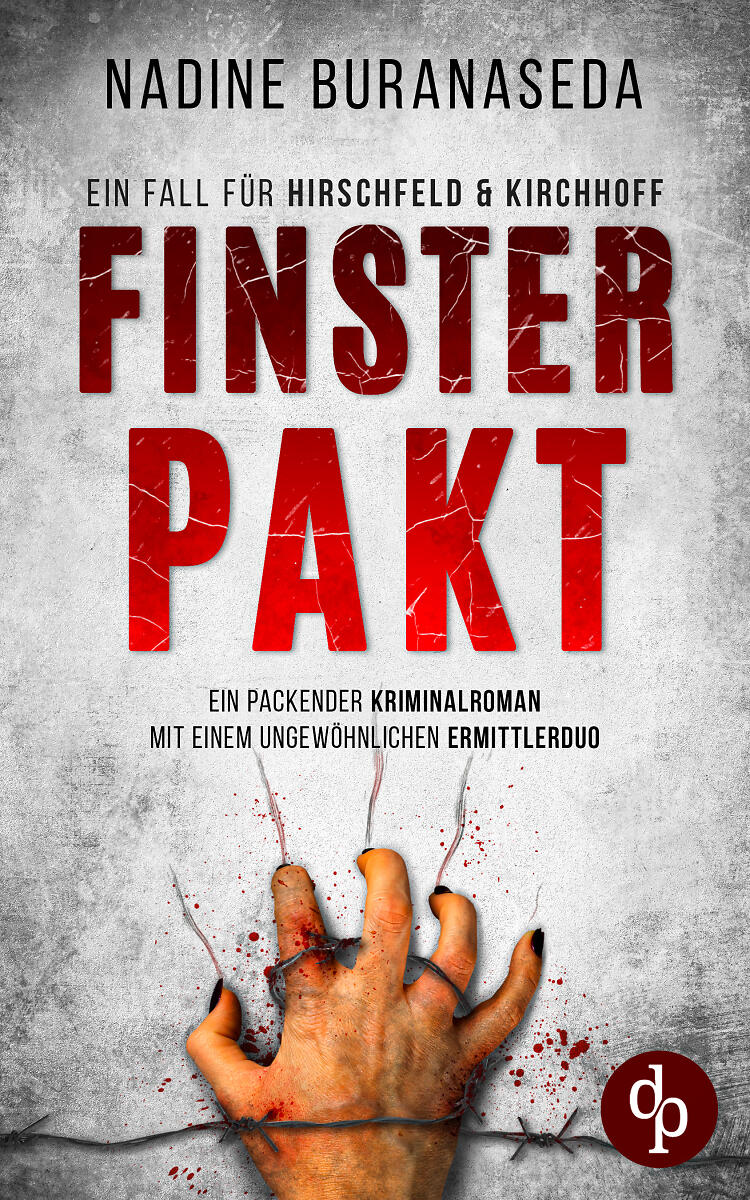Prolog
Karge Felder zogen sich wie ein großer Flickenteppich in braunen und gelben Ockertönen über die Ebene. Dichter Nebel war in der Nacht aufgestiegen und verlieh den umgepflügten Erdschollen und Äckern weiche Konturen. Am Wegesrand standen vertrocknete Grasbüschel, die sich in einer sanften Brise wiegten. Die Bauern hatten die Ernte längst eingefahren und warteten auf den Frühling, um neue Saat auszusäen. Irgendwo flog ein Schwarm schwarzer Vögel auf und schoss pfeilschnell in den wolkenlosen Herbsthimmel. In immer neuen Formationen schraubten sich die gefiederten Körper in die Höhe, um im nächsten Moment jäh die Richtung zu wechseln.
Er beobachtete den Vogelschwarm eine Zeit lang, während er dem Lauf der Landstraße in gemäßigtem Tempo folgte. Er fragte sich, was es bedeutete, ein Teil dieses Verbands zu sein, der nach eigenen Gesetzmäßigkeiten funktionierte. Dann dachte er an die Menschen in seiner Stadt, die sich längst mit der Eintönigkeit ihres Lebens abgefunden hatten und diese Freiheit niemals erleben würden. Nachdem er die letzten Häuser am Stadtrand hinter sich gelassen hatte, war er keiner Menschenseele mehr begegnet. Seit er denken konnte, schätzte er die Einsamkeit dieser frühen Morgenstunden, in denen die Welt allein ihm gehörte. Er mochte die Vorstellung, der letzte Mensch auf Erden zu sein.
Nach einer Weile stieg die Straße an. Er sah auf die Uhr in der Mittelkonsole und ließ das Seitenfenster ein Stück hinab. Kühle Luft, die den nahenden Frost erahnen ließ, schlug ihm entgegen und raubte ihm für einen Moment den Atem. In wenigen Augenblicken würde die Sonne aufgehen. Als er den Blick wieder auf die Fahrbahn richtete, erstarrte er. Gerade noch rechtzeitig trat er aufs Bremspedal und brachte den Wagen mit einem heftigen Ruck zum Stehen.
Unverwandt starrte er auf den Autoreifen, der mitten auf der Fahrbahn lag. Das Dröhnen des Motors, das das Kreischen der Bremsen verschluckt hatte, erschien ihm unerträglich laut. Er zwang sich zur Ruhe, seine Hände lösten sich nur langsam vom Lenkrad. Nervös schaltete er das Warnblinklicht ein und drehte den Zündschlüssel um. Er öffnete den Sicherheitsgurt und stieg aus. Die Tür ließ er offen. Seine Schritte knirschten auf dem Asphalt. Auf Höhe des Reifens, dessen Felge sich stark verzogen hatte, blieb er stehen. Aus dem Rad ragte ein Teil der Achse, um die sich zwei abgerissene Bremsschläuche gewickelt hatten. Für den Bruchteil einer Sekunde war er versucht umzukehren, doch irgendetwas hielt ihn davon ab. Als er schließlich den Kamm der Anhöhe erreicht hatte, erblickte er in einiger Entfernung eine hochgewachsene Linde, die ihre kahlen Äste einsam in die Höhe reckte. Der Baum war alt und hatte sich mit den Jahren dem Wind gebeugt, der über die Felder fegte. Der gekrümmte Stamm maß mindestens eine Armspanne. Dahinter türmte sich ein dunkelrotes Stück Blech auf, das er für die Kühlerhaube des Wagens hielt. Rechts und links davon spreizten sich die vorderen Autotüren ab, die aus der Verankerung gerissen waren und wie die gebrochenen Flügel eines riesigen Metallvogels aussahen.
Er beschleunigte seine Schritte und näherte sich atemlos dem Wrack, das mit der Fahrerseite in einen Graben abgesackt war. Mit jedem Meter verstärkte sich der Geruch von Benzin und verbranntem Gummi. Den Fahrzeugtyp konnte er nicht mehr bestimmen und nicht einmal sagen, ob es sich um einen Kleinwagen oder eine Limousine handelte. Dort, wo der Wagen gegen den Baum geprallt war, hatte sich Rinde über dem Wurzelwerk abgelöst und eine Fläche hellen Holzes freigelegt. Weitere Details des Zusammenstoßes drängten sich in sein Blickfeld. Die komplette Wagenfront hatte sich auf einen halben Meter zusammengestaucht. Die Windschutzscheibe war eingedrückt. An den Stellen, an denen das Glas nicht auf den Boden gesplittert war, zog sich ein Netz an Rissen darüber. Zwischen verbogenen Karosserieteilen und der kastenförmigen Autobatterie lag ein einzelner weißer Turnschuh. Etwas weiter entfernt konnte er den Kühlergrill ausmachen.
Das Fahrzeug muss aus der entgegengesetzten Richtung gekommen sein, dachte er und berührte vorsichtig die Beifahrertür. Bereits im Näherkommen hatte er festgestellt, dass sich auf der Fahrbahn keine Bremsspuren befanden. Aus irgendeinem Grund musste der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Als er in das Innere des Fahrzeugs blickte, schlug ihm das Herz bis zum Hals. Zwischen den Vordersitzen und dem Armaturenbrett war keine Handbreit Platz. Der Körper der Frau war eingekeilt und hing verdreht im Gurt. Ihr rechtes Bein klemmte zwischen dem Autositz und einer lindgrünen Kühlbox mit einem weißen Tragegriff. Er schätzte die Beifahrerin auf Ende vierzig. Sie war korpulent und trug einen weißen Synthetikpullover. Ihre dünne hellblaue Stoffhose war an den Oberschenkeln zerrissen. Sie hatte kurzes hellblondes Haar, das sich in ihrem Nacken kräuselte. Der Kopf war auf die Brust gefallen und nach links gekippt. Das Gesicht war geschwollen, die Augen halb geöffnet. Blut war aus ihrem Mund gesickert und hatte kirschrote Flecke auf dem Pullover hinterlassen. Es kostete ihn Überwindung, den leblosen Körper zu berühren. Schließlich tastete er mit Zeige- und Mittelfinger seiner Rechten nach der Halsschlagader. Die Haut war kalt und weich und ließ ihn erschaudern. Nach einem kurzen Augenblick zog er die Hand wieder zurück. Die Frau war tot.
Ein Blick in den hinteren Teil des Fahrzeugs überzeugte ihn, dass niemand auf dem Rücksitz gesessen hatte. Obwohl sich der Airbag, der jetzt schlaff vom Lenkrad hinabhing, auf der Fahrerseite geöffnet hatte, zweifelte er daran, dass es Überlebende gab.
Er zog den Kopf zurück und umrundete den Wagen. Im Gegensatz zur Frontscheibe war die Heckscheibe vollständig aus dem Rahmen gesplittert. Bereits von Weitem entdeckte er den zweiten Körper. Er lag auf dem Acker, in Rückenlage. Die Füße zeigten zu ihm. Wahrscheinlich war der Fahrer nicht angeschnallt gewesen, als sich der Unfall ereignet hatte.
Er drehte sich zur Seite und setzte behutsam Fuß neben Fuß, um die Böschung hinunterzusteigen. Einzelne Steine und Erdbrocken lösten sich und sprangen den Abhang hinab. Bevor er auf das Feld trat, passierte er den Motorblock, der aus dem Wagen katapultiert worden war und sich tief in das Erdreich eingegraben hatte. Daneben lag ein Schraubenzieher, der aus einem Werkzeugkoffer stammen musste.
Bevor er zu dem zweiten Unfallopfer aufgeschlossen hatte, hörte er plötzlich ein dumpfes Röcheln. Er rannte los, dass ihm nach wenigen Metern die Lunge schmerzte. Der unebene Boden unter ihm beschwerte seine Schritte wie Blei. Nach Sekunden, die sich zu Stunden dehnten, kniete er sich keuchend neben den leblosen Körper. Die Frau war deutlich jünger als die tote Beifahrerin. Sie war von mittlerer Statur und zierlich. Unter ihrer grauen Sweatshirtjacke, in der jetzt nur noch ein Arm steckte, trug sie ein enges grünes T-Shirt. Durch einen Riss in ihrer Jeans ragte aus ihrem linken Bein ein blutiger Knochen. Am Fuß steckte der zweite weiße Turnschuh. Der linke Arm war gebrochen und unnatürlich verdreht. In ihren langen blonden Haaren hatten sich kleine Zweige und ein paar Laubblätter verfangen. Auf ihrer rechten Gesichtshälfte klaffte eine blutige Fleischwunde. Die andere Seite war mit dunklen Hämatomen übersät.
Reflexartig griff er nach ihrer Hand und beobachtete, wie sie unter größter Anstrengung versuchte, die Augen zu öffnen. Da das Blut auf ihrem Gesicht klebte, gelang es ihr nur, ein Auge aufzuschlagen. Unendlich langsam drehte sie den Kopf. Ihre Lippen formten sich zu einem Wort, aber er konnte sie nicht verstehen. Ohne ihre Hand loszulassen, beugte er sich dicht über sie.
„Mama?“, flüsterte sie kaum hörbar.
Er richtete sich wieder auf und schüttelte unmerklich den Kopf. Als sich eine Träne löste und ihre Wange hinablief, schwieg er immer noch. Dann ging er erneut in die Knie und betrachtete sie aufmerksam. Ihre Brustwarzen zeichneten sich deutlich unter dem T-Shirt ab. Sie wollte noch etwas sagen, als sich ihr Busen noch einmal heftig hob. Dann erstarrte ihr Blick.
Im selben Moment schob sich die Sonne wie ein gleißender Feuerball über den Horizont. Er ließ ihre Hand los und beschattete seine Augen mit der Linken. Die Sonnenstrahlen tauchten den Acker in goldenes Licht. Er atmete auf und sog den Duft der feuchten Erde ein.
Eine Viertelstunde später wandte er sich ab und ging langsam zurück zu seinem Wagen.
Er lächelte.
Noch nie in seinem Leben hatte er sich so leicht gefühlt.
1
Stress
I. Alarm
Fight or flight. Kampf oder Flucht.
Seit sie das weitläufige Grundstück betreten hatten, war alles zu einfach gewesen: kein Zaun, den sie hatten überwinden müssen, kein Wachhund, der ihnen bellend und zähnefletschend entgegengelaufen war. Nicht einmal die Haustür war verschlossen.
Jedes einzelne Detail für sich betrachtet stellte für Hirschfeld keine Bedrohung dar. Doch die wochenlangen Ermittlungen, die ihn und Kirchhoff schließlich in dieser kalten Oktobernacht hierhergeführt hatten, und die unerwartete Leichtigkeit, mit der sie ihrem Ziel jetzt näher zu kommen schienen, signalisierten ihm nur eines: Gefahr!
Hirschfeld, die Hand am Knauf, stieß die nur angelehnte Tür aus gebürstetem Edelstahl auf. Als er den Fuß in das hell erleuchtete Haus aus Beton und Glas setzte, feuerte sein Hypothalamus bereits gewitterartig Nervenimpulse ab. In Sekundenbruchteilen rasten elektrische Signale seine Wirbelsäule hinab und erreichten die Nebenniere, die Adrenalin in seine Blutbahn pumpte. Sofort schlug Hirschfelds Herz schneller. Während sich seine Atemfrequenz steigerte, tastete sein Blick systematisch den Eingangsbereich des Hauses ab.
Gegenüber der Haustür stand ein hochglänzendes weißes Sideboard. Auf dem Fußboden aus hellgrauem Kunstharz lag ein Schlüsselbund. Als Hirschfeld den Kopf nach rechts wandte, rückte auf Augenhöhe ein rechteckiger flacher Kasten in sein Blickfeld.
„Die Alarmanlage“, sagte er leise über die Schulter und erntete ein stummes Nicken von Kirchhoff, der dicht hinter ihm geblieben war.
Die silberfarbene Klappe, die das Bedienfeld schützte, stand offen. Die Tasten strahlten durch eine Hintergrundbeleuchtung warmes Licht ab. Über der Tastatur befand sich ein mehrzeiliges Display. Hirschfeld kniff die Augen zusammen. Obwohl sie aus der Dunkelheit ins Helle getreten waren, hatten sich seine Pupillen erweitert, sodass die Lettern in der Mitte der Anzeige für einen Moment vor seinen Augen verschwammen: UVM 01 SUP Fehler, entzifferte er.
Hirschfelds Puls galoppierte und versorgte sein Gehirn mit größeren Mengen Sauerstoff. Ein Gedanke jagte den nächsten. Wer hatte sich an der Alarmanlage zu schaffen gemacht? War noch jemand im Haus, mit dem sie nicht gerechnet hatten? Und viel entscheidender: Kamen sie bereits zu spät?
Sicher war nur, dass der Alarm ausgeschaltet war.
Fight or flight.
Sein Körper war jetzt bis in die Haarspitzen bereit anzugreifen oder zu flüchten. Doch Hirschfeld hatte keine Wahl. Er wechselte die MagLite in die Linke. Dann löste er in einer einzigen Bewegung die beiden Sicherungen des Holsters und zog seine Walther P99. Die Waffe war geladen und sofort schussbereit. Kirchhoff folgte seinem Beispiel.
Mit Pistole und Taschenlampe im Anschlag durchquerten sie den Vorraum, bis sie in einen Gang gelangten, der ins Innere des Hauses führte und so schmal war, dass Kirchhoff Hirschfeld den Vortritt lassen musste. In die Decke waren mehrere Halogenspots eingebaut. Ein dreitüriger Schiebetürenschrank aus Ahorn nahm die gesamte rechte Seite ein. Die linke Wand war dagegen vollständig verspiegelt und ließ den Flur optisch größer wirken.
Während sie lautlos einen Schritt vor den anderen setzten, registrierte Hirschfeld aus dem Augenwinkel ihre Bewegungen im Spiegel. Obwohl er wusste, dass Kirchhoff seine Dienstwaffe nicht auf ihn richtete, verstärkte sich das Gefühl, geradewegs in eine Falle zu laufen.
„Stopp!“, zischte Hirschfeld.
Er war neben einer Tür stehen geblieben, die in die Spiegelwand eingelassen war. Hirschfeld löste seine Linke mit der MagLite von den Fingerknöcheln der rechten Hand, mit der er die P99 hielt, und drückte vorsichtig die Klinke hinunter. Der Raum dahinter lag im Dunkeln. Hirschfeld leuchtete kurz hinein. Der Strahl der Taschenlampe streifte ein Waschbecken und eine Toilette. Das Gäste-WC.
Verlassen.
Hirschfeld ließ die Tür offen stehen und setzte seinen Weg fort. Nachdem sie den großzügig geschnittenen Wohnraum erreicht hatten, sahen sie, dass linker Hand eine Treppe aus Edelstahl und Glas ins Ober- und Untergeschoss führte. Kirchhoff gab ihm ein Zeichen und nahm die Treppe nach oben.
Hirschfeld durchmaß den spärlich möblierten Raum, der eine Esstischgruppe und im hinteren Teil eine Küchenzeile mit Tresen beherbergte.
Immer noch keine Menschenseele.
Hirschfeld trat an die breite Fensterfront, warf einen Blick nach unten und stellte fest, dass das Haus an einen Hang gebaut war. Der Garten wurde von einem in den Boden versenkten Pool dominiert, der mindestens zehn mal fünfzehn Meter maß. Das bläulich schimmernde Wasser, das von mehreren Lichtstrahlen durchschnitten wurde, war spiegelglatt.
Hirschfeld wandte sich ab und ging zurück zur Treppe. Die Stille, die über dem Haus lag, war fast greifbar. Mit jeder Stufe, die er in das Untergeschoss hinabstieg, erhöhte sich sein Pulsschlag. Als er die Treppe verließ und hinter dem Wandvorsprung hervortrat, verharrte er. Auf den Anblick, der sich ihm bot, war er nicht vorbereitet gewesen.
„Polizei!“, sagte er so ruhig wie möglich, steckte die MagLite zurück in die Jacketttasche und hob beschwichtigend die Linke, ohne den Lauf seiner Waffe zu senken.
„Sie … Sie hätten längst hier sein können“, erwiderte der Mann gepresst.
Er saß vor einer roten Ledercouch auf dem Boden. Neben ihm stand eine fast leere Wodkaflasche. Hirschfeld schätzte ihn auf Anfang vierzig. Das Haar klebte ihm nass am Kopf. Er musste vor nicht allzu langer Zeit den Swimmingpool benutzt haben. Er trug einen karierten Morgenmantel. Der Gürtel hatte sich gelöst und gab den Blick frei auf einen leicht gebräunten, durchtrainierten Körper. Sein rechtes Bein war ausgestreckt, das linke eigentümlich angewinkelt. Dazwischen breitete sich eine Blutlache auf dem hellen Boden aus.
Hirschfeld spürte, wie sein Mund trocken wurde. „Weg mit dem Messer!“
Der Mann verzog schmerzverzerrt das Gesicht und umklammerte den blutverschmierten Griff noch fester.
„Hören Sie, Sie brauchen dringend einen Arzt!“, fuhr Hirschfeld fort.
„Nein … verdammt, lassen Sie mich einfach sterben!“
In diesem Moment waren Schritte aus dem oberen Stockwerk zu hören.
„Sie sind nicht allein“, brachte der Mann mühsam hervor. „Immerhin …“
Hirschfeld konnte nur hoffen, dass Kirchhoff sie gehört und die Verstärkung informiert hatte, die bereits auf dem Weg war. Denn er wusste nicht, wie lange er die Situation noch unter Kontrolle haben würde.
Hirschfeld ignorierte den Kommentar und ließ den Mann keine Sekunde aus den Augen. „Lassen Sie das Messer fallen – sofort!“
„Es gibt kein Zurück.“ Der Mann lachte kehlig. „Verschwinden Sie!“
„Wo ist Rebecca?“ Hirschfeld ging langsam auf ihn zu. „Sie können noch das Richtige tun!“
„Noch einen Schritt“, der Mann griff mit der freien Hand unvermittelt neben sich, „und ich drück ab!“
Der Lauf eines Revolvers war direkt auf Hirschfeld gerichtet.
In dieser Sekunde tauchte Kirchhoff draußen auf der Terrasse auf. Offenbar gab es noch einen anderen Zugang zum Garten. Als Kirchhoff den Mann am Boden erblickte, verlor sein Gesicht jegliche Farbe. Hirschfeld schüttelte kaum merklich den Kopf.
Seit sie das Haus betreten hatten, erhielt Hirschfelds Hypothalamus Signale aus dem Angstzentrum. Sein Körper veränderte jede seiner siebzig Billionen Zellen und machte ihn für die absolute Notsituation bereit, in der er sich jetzt befand. Doch in seinem Hirn hämmerten nur die Worte: Du musst ihn aufhalten!
II. Widerstand
Hirschfeld brach der Schweiß aus. Der Mann ist zu allem entschlossen, schoss es ihm durch den Kopf. Allerdings war nicht klar, ob er nur sich selbst richten oder noch jemanden mit in den Tod reißen wollte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er Kirchhoff vor dem Fenster bemerken würde.
„Wollen Sie wirklich, dass Ihr Leben so endet?“ Hirschfeld musste den Mann am Reden halten.
Solange er mit ihm sprach, würde er nicht auf ihn schießen.
Darauf hoffte Hirschfeld zumindest.
„Das spielt jetzt keine Rolle mehr“, gab der Mann kaum hörbar zurück.
„Für Sie vielleicht“, entgegnete Hirschfeld. Er durfte ihn nicht sterben lassen. Nur er wusste, wo das Mädchen war. „Aber denken Sie an die junge Frau, Sie dürfen sie nicht im Stich lassen!“
Das Gesicht des Mannes nahm einen seltsamen Ausdruck an. Er legte den Kopf schräg und lächelte. „Sie hätten mich aufhalten können. Wollen Sie mir jetzt Vorwürfe machen?“
Die Worte trafen Hirschfeld mit der Wucht eines Faustschlags. Er spürte, wie sein Oberkörper zu beben begann. Er atmete tief ein, damit das Zittern nicht den Zeigefinger am Abzug seiner Dienstwaffe erreichte.
„Ich weiß, dass Sie es nicht so weit kommen lassen wollten.“ Hirschfeld verlagerte das Gewicht auf das andere Bein.
Die Zeit lief ihm davon. Rebecca konnte in dieser Sekunde sterben. Sie mussten die junge Frau unter allen Umständen retten, jetzt wo sie fast am Ziel waren.
„Sie haben nichts verstanden!“, brach es aus dem Mann hervor.
Seine Augen glänzten fiebrig. Nicht mehr lange und er würde durch den Blutverlust das Bewusstsein verlieren. Oder verbluten.
„Sie haben nicht mehr viel Zeit. Hören Sie, ich rufe …“
„Denken Sie nicht mal dran!“
Hirschfeld rang nach Luft. Seine Knie waren weich, doch er musste sich zusammenreißen. Zu viel stand auf dem Spiel.
„Noch ist es nicht zu spät!“, ließ er nicht locker und registrierte gleichzeitig, dass Kirchhoffs kantiges Gesicht vor dem Fenster verschwunden war.
Der Mann richtete den Blick für einen Moment ins Leere und sah aus, als hätte er Raum und Zeit vergessen. Welten trennten sie. Hirschfeld wusste, dass er ihn auf ihre Seite ziehen musste.
III. Erschöpfung
Er konnte dieses Schwein auch verrecken lassen! Hirschfeld erfasste plötzlich eine Welle der Wut. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, wozu der Mann in der Lage war. Noch immer graute ihm bei dem Gedanken an die unbeschreiblichen Qualen, die der Kerl Svetlana zugefügt hatte. Ein solches Maß an Mitleidlosigkeit und Gewalt war Hirschfeld nie zuvor begegnet. Der Mann empfand regelrechte Lust an seiner Grausamkeit. Wie musste es erst Rebecca ergangen sein?
Nach allem, was Kirchhoff und er erlebt hatten, verspürte Hirschfeld kein Mitleid mehr mit diesem pathologischen Narzissten. Die ganze Zeit über hatte er nur mit ihnen gespielt. Selbst jetzt, da ihn nur wenige Atemzüge vom Tod trennten, inszenierte er sein Ende und versuchte, bis zuletzt die Fäden in der Hand zu behalten.
Niemand würde den Ablauf der Ereignisse infrage stellen, wenn Hirschfeld ihn mit einem gezielten Schuss zwischen die Augen hinrichtete.
Nicht einmal Kirchhoff.
Hirschfeld nahm eine Bewegung vor der roten Ledercouch wahr. Der Mann hatte den Revolver blitzschnell neben sich gelegt. Das blutige Messer in beiden Händen war er im Begriff, es sich in die Brust zu stoßen. Hirschfeld drückte den Finger am Abzug durch.
„Was ist passiert?“, schrie Kirchhoff, der plötzlich im Zimmer stand.
Hirschfeld blickte ihn an, als sähe er einen Geist. Er ließ die Waffe sinken und stürzte zu dem Mann, der auf dem Boden zusammengesackt war und leise stöhnte.
„Wir brauchen sofort einen Krankenwagen!“, brüllte Hirschfeld.
Er kniete bereits über dem Mann und presste beide Hände auf dessen Brustkorb, der sich kaum noch hob und senkte. Warmes Blut quoll zwischen Hirschfelds Fingern hervor. Mit jeder Sekunde wich das Leben aus dem Körper dieses Mistkerls.
Wo ist Rebecca?, dröhnte es in Hirschfelds Kopf.
Die Augen des Mannes flatterten.
Dann brach sein Organismus endgültig zusammen.
2
Einen Monat zuvor
Hirschfeld saß barfuß vor dem geöffneten zweiflügeligen Bogenfenster in seiner neuen Wohnung. Er hatte die ausgestreckten Beine übereinandergeschlagen und rauchte, den Rücken an die weiß verputzte Wand gelehnt. Der Erker war so breit und tief gebaut, dass Hirschfeld einen dünnen japanischen Futon auf den Vorsprung gelegt hatte. Fast jeden Abend zog er sich dorthin zurück und hörte den Tauben zu, die über ihm auf dem Dach gurrten. Als er sich die zweite Zigarette anzündete, verschwanden die letzten Sonnenstrahlen und verwandelten das scharf umrissene Lichtdreieck auf seinen Füßen in eine weiche Fläche, die nach und nach verblasste. Hirschfeld ließ die Augen über die verwinkelten Hinterhöfe schweifen. Wie so oft blieb sein Blick auf der verwaisten Dachterrasse schräg gegenüber hängen, die wie der Bug eines antiken Kriegsschiffs über das Häusermeer hinausragte. Eine Marmorstatue reckte als Galionsfigur die steinerne Hand in den rötlichen Abendhimmel und wies den Kurs.
Es würde nicht mehr lange dauern, bis sich die ersten Nachtschwärmer bemerkbar machten, die nicht nur am Wochenende die Innenstadt bevölkerten. Hirschfelds Apartment befand sich in einem vierstöckigen Haus auf der Sternstraße mitten in der Bonner Fußgängerzone. Anfänglich hatte ihn die Beschaulichkeit der Gassen befremdet, in denen sich nüchterne Nachkriegsbauten neben opulent ornamentierte Jugendstilhäuser drängten, doch mit der Zeit hatte er sich an den Rhythmus der Stadt gewöhnt. Im Erdgeschoss war die Filiale einer Modekette untergebracht, die in zweifelhafter Anlehnung an die Neunzigerjahre in ihrem Schaufenster mit neonbunter Kleidung warb. Das Stockwerk darüber bewohnte eine WG mit vier Studentinnen, die ihm jedes Mal vielsagende Blicke zuwarfen, wenn er ihnen im Treppenhaus begegnete. Im zweiten Stock lebte ein pensionierter Studienrat, der die meiste Zeit im Jahr auf Reisen war. Hirschfeld hatte seit seinem Einzug vor ein paar Monaten höchstens zwei, drei Worte mit ihm gewechselt, bevor der ergraute Herr zu seiner nächsten Exkursion aufgebrochen war.
Hirschfeld hatte die Wohnung im dritten Stock angemietet, zu der ein Zimmer unterm Dach gehörte. Dieser Raum war nicht über das Apartment, sondern über eine knarzende Holzstiege zu erreichen. Außerdem gab es eine separate Dachterrasse, die auch von den anderen Hausbewohnern genutzt wurde. Hirschfeld zog jedoch den kleinen Balkon auf der Nordseite vor, auf dem er mit Kirchhoff bereits einige Sommerabende verbracht und schweigend ein paar Feierabendbiere getrunken hatte.
Hirschfeld dachte an seinen Vater, der ihn vor ein paar Wochen zum ersten Mal in seiner neuen Wohnung besucht hatte. Heinrich Hirschfeld hatte sich keine Mühe gegeben, seinen Unmut darüber zu verhehlen, dass sich sein Sohn eine eigene Bleibe gesucht hatte, statt in das elterliche Haus in Lengsdorf zu ziehen. Obwohl der frei stehende Bungalow einigen Komfort bot, wie sechs großzügig geschnittene Zimmer und ein Schwimmbad im Hanggeschoss, hatte Hirschfeld es seit seiner Ankunft in Bonn nie in Erwägung gezogen, dort zu wohnen. Zu viele schmerzhafte Erinnerungen hingen daran. Das Haus war für die dreiköpfige Familie, die vor dreizehn Jahren ohne den ältesten Sohn von Berlin nach Bonn umgesiedelt war, von Anfang an zu groß gewesen. Seit seine Mutter Luise gestorben und seine jüngere Schwester Johanna ausgezogen war, war die Leere, die das Haus ausstrahlte, noch spürbarer geworden. Hinzu kam, dass sich Hirschfeld beim besten Willen nicht vorstellen konnte, zukünftig wieder mit seinem Vater unter einem Dach zu leben. Er wusste, dass sie beide ihre Freiräume brauchten. Ein gemeinsames Haus würde ihr zwiespältiges Verhältnis nur noch mehr verkomplizieren.
3
Im Rückspiegel überprüfte er den Sitz seiner Krawatte. Für sein Alter hatte er sich gut gehalten. Er war braun gebrannt, durchtrainiert und hatte ein umwerfendes Lächeln. Das Rasierwasser, das er aufgelegt hatte, war teuer und verriet seinen ausgesuchten Geschmack. Die meisten Menschen in seiner Umgebung hielten ihn für gebildet und distinguiert, für den netten Nachbarn von nebenan, der es weit gebracht hatte. Niemand kannte sein anderes Ich.
In den letzten Wochen war er fast jede Nacht durch die Straßen der Stadt gefahren. Rastlos, ruhelos. Immer wieder kehrte er vollkommen ausgebrannt nach Hause zurück. Er stellte sich unter die Dusche und wusch sich den Ekel ab. Die hinablaufenden Wassertropfen zeichneten sein verzerrtes Spiegelbild auf die gläserne Duschwand. Die Welt war schlecht. Das war ein Naturgesetz. Es war an der Zeit, auszubrechen und alles hinter sich zu lassen – die Scham und die Schuldgefühle.
Er kam sich vor wie ein Drogenabhängiger, der auf seinen nächsten Schuss wartete. Am Anfang durchstreifte er nur die nächtlichen Straßen. Ohne Plan. Ohne Ziel. Und mit einem Mal war alles ganz einfach. Er erinnerte sich noch genau an das Gefühl, als er sich der verbotenen Meile näherte. Je weiter er in den Rotlichtbezirk vordrang, desto stärker pulsierte das Blut durch seine Adern und verursachte ein wellenartiges Rauschen in seinen Ohren.
Irgendwann wird alles vorbei sein, redete er sich ein. Wieder und wieder. Aber das war eine Illusion. Es würde niemals vorbei sein. Nicht, solange er es nicht getan hatte.
Und vor zwei Nächten war es passiert. Er hatte sie gesehen und wusste sofort, dass seine Suche ein Ende hatte.
Vorerst.
In dieser Nacht hatte er nur ein Ziel, er musste sie um jeden Preis wiederfinden. Sie war wie geschaffen für die Aufgabe, die er für sie vorgesehen hatte – sich seinem Willen vollkommen zu unterwerfen. Sie hatte es nicht anders verdient.
Ihrem Äußeren nach zu urteilen, war sie noch nicht lange im Geschäft. Sie war jung, verdammt jung, und sicher von zu Hause ausgerissen. Ein abenteuerlustiges Mädchen, das vom großen Geld träumte. Sie sah unverbraucht aus. Das Leben auf der Straße hatte noch nicht die Oberhand gewonnen. Sie würde nicht Nein sagen, wenn er sie in seiner Mercedes S-Klasse mitnahm. Sie würde sich geschmeichelt fühlen. Wie so viele Frauen vor ihr.
Er setzte den Blinker und bog in die Kantstraße ein. Sofort drängten sich die rot erleuchteten Fenster des Eros Center in sein Blickfeld und ließen die schwarzen Schornsteine der Müllverbrennungsanlage am dunklen Horizont verblassen. Die Laternen und die kitschige Neonreklame in Herzform ließen keinen Zweifel aufkommen, welchem Gewerbe in diesem Haus nachgegangen wurde.
Er fühlte sich wie Jack the Ripper zu seinen besten Zeiten.
Es war ein Spiel, dessen Regeln er bestimmte. Er bezahlte nicht für Sex, das hatte er nicht nötig. Er bezahlte für die Erniedrigung. Bisher hatte er die Grenze nicht überschritten, doch es war an der Zeit.
Er verlangsamte das Tempo, um auf die Immenburgstraße zu wechseln. Mit Schrittgeschwindigkeit fuhr er den Straßenstrich entlang und ließ dabei den Bürgersteig nicht aus den Augen. Die Frauen in ihren Miniröcken und Strapsen, die sich nach vorne beugten, um ihn zum Anhalten zu bewegen, interessierten ihn nicht. Nach vierhundert Metern erreichte er das Ende des Strichs.
Keine Spur von ihr.
Er wendete enttäuscht und fuhr dieselbe Strecke zurück. Fast wollte er sein Vorhaben aufgeben, als er sie plötzlich sah. Sie winkte dem Wagen ihres letzten Freiers hinterher, mit dem sie in einer der Verrichtungsboxen verschwunden war, die die Stadt für die Huren aufgestellt hatte. Dann zog sie ihren Rock zurecht und stöckelte zurück zu ihrem Stammplatz.
Man hätte sie für ein Mädchen halten können, das sich nachts in diese üble Gegend verirrt hatte. Einzig der grelle Lippenstift verriet sie.
Er trat auf die Bremse und ließ das Seitenfenster hinunter.
„Wie wär’s mit uns beiden, Süßer?“, hauchte sie und warf ihm eine Kusshand zu.
Mit einem Kopfnicken bedeutete er ihr einzusteigen. Lachend zog sie die Beifahrertür auf und setzte sich. Ihr schlanker Körper schmiegte sich in den Ledersitz. Sie trug ein champagnerfarbenes Kleid, darunter schwarze Nylonstrümpfe. Ihr seidig glänzendes dunkelblondes Haar war schulterlang und fiel in leichten Wellen auf die Bolerojacke aus Pelz.
„Wie kann ich dich glücklich machen?“
Ihr Augenaufschlag war atemberaubend. Sie wusste genau, welche Wirkung sie auf Männer hatte.
„Du redest nicht gerne“, stellte sie fest.
Er schwieg und trat aufs Gaspedal.
Sie fuhr mit der Hand über seinen Oberschenkel und verharrte kurz vor seinem Schritt. Sie hatte schnell gelernt, das Geschäftliche ganz beiläufig abzuwickeln.
„Ein paar Meter weiter können wir es uns gemütlich machen. Ich kann es kaum erwarten.“
„Das ist nicht mein Stil.“
Sie mit nach Hause zu nehmen, war zu riskant. Er konnte weder neugierige Nachbarn noch ein Mädchen gebrauchen, das sich später genau an ihn oder sein Haus erinnerte.
„Wie wär’s mit einer kleinen Spazierfahrt?“, fragte er und setzte den Blinker.
„Ich nehme zweihundert Euro die Stunde, alles andere extra.“ Sie schenkte ihm ein zuckersüßes Lächeln.
Sie pokerte hoch, dafür dass sie ihre Liebesdienste auf der Straße anbot. Anfängerfehler, dachte er. Aber er würde ihr eine Lektion erteilen, die sie nicht so schnell vergessen würde.
„Geld ist kein Problem. Ich leg dir die Welt zu Füßen, mein Engel.“
Sie zog überrascht die Brauen hoch und lachte erneut. „So wie in Pretty Woman?“
„Ja, genau so. Wir könnten nach Paris fahren und wären morgen Abend wieder zurück.“
„Du nimmst mich auf den Arm!“ Sie klappte ihre goldene Handtasche auf und zog eine Packung Zigaretten heraus. „Darf ich?“
Er nickte.
Mit ihren manikürten Fingern holte sie eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie zwischen die Lippen und ließ sich Feuer geben.
„Okay, wie sehen deine Pläne wirklich aus?“ Sie inhalierte den Rauch.
Ganz so naiv ist sie offenbar nicht, dachte er. Umso größer war die Herausforderung, sie zu dem zu bringen, was sie nicht tun wollte. Für kein Geld der Welt.
„Wir steigen in irgendeinem Hotel ab. Und dann sehen wir weiter“, entschied er.
„Wie du meinst.“ Sie stieß den Rauch wieder aus und schnippte die Zigarettenglut in den Aschenbecher. „Aber das wird nicht billig.“
Er griff in sein Jackett, zog vier Hunderter aus der Geldklammer und lächelte wie ein Hai.
5
Er hatte sie nach ihrem Namen gefragt.
„Candy“, hatte sie geantwortet und war im Bad verschwunden.
Warum sollte sie ihm ihren richtigen Namen nennen? Sie verkaufte einen Traum, nichts weiter. Mit der Zeit hatte sie ihr altes Leben vergessen. Die guten und die schlechten Erinnerungen hatte sie in eine Kiste gepackt und den Deckel fest verschlossen. Sie würde sie nicht mehr öffnen. Jetzt hatte ein neues Leben angefangen. Und Namen hatten keinerlei Bedeutung. Sie selbst wusste nicht einmal mehr, wer sie war, was zählte da schon ein Name?
Jetzt stand sie vor dem riesigen Spiegel und betrachtete ihr hübsches Gesicht. Sie war zufrieden mit dem, was sie sah. Eines Tages würde sie das alles hinter sich lassen. Und nie wieder die Beine für Geld breit machen.
Er sieht gar nicht so schlecht aus, dachte sie, während sie das Kleid von den Schultern gleiten ließ. Vielleicht etwas zu alt für sie. Aber das spielte keine Rolle, solange er zahlte. Immerhin waren sie in einem luxuriösen Fünfsternehotel abgestiegen.
Wahrscheinlich war er im richtigen Leben ein braver Familienvater, der von seiner Frau nicht das bekam, was er brauchte: ein Mädchen ohne Tabus.
Es klopfte an der Tür.
„Warte noch einen Augenblick, Darling. Ich bin sofort bei dir.“
Es schadete nicht, wenn sie ihn noch ein wenig zappeln ließ. Sie drehte das Wasser auf und gab die ganze Flasche Badezusatz in die Whirlwanne. Zehn Minuten später versank sie in einem duftenden Schaumbad. Sie schloss die Augen, tauchte tiefer ins Wasser ein und dachte mit einem wohligen Seufzer darüber nach, dass sie in dieser Nacht einen dicken Fisch an der Angel hatte.