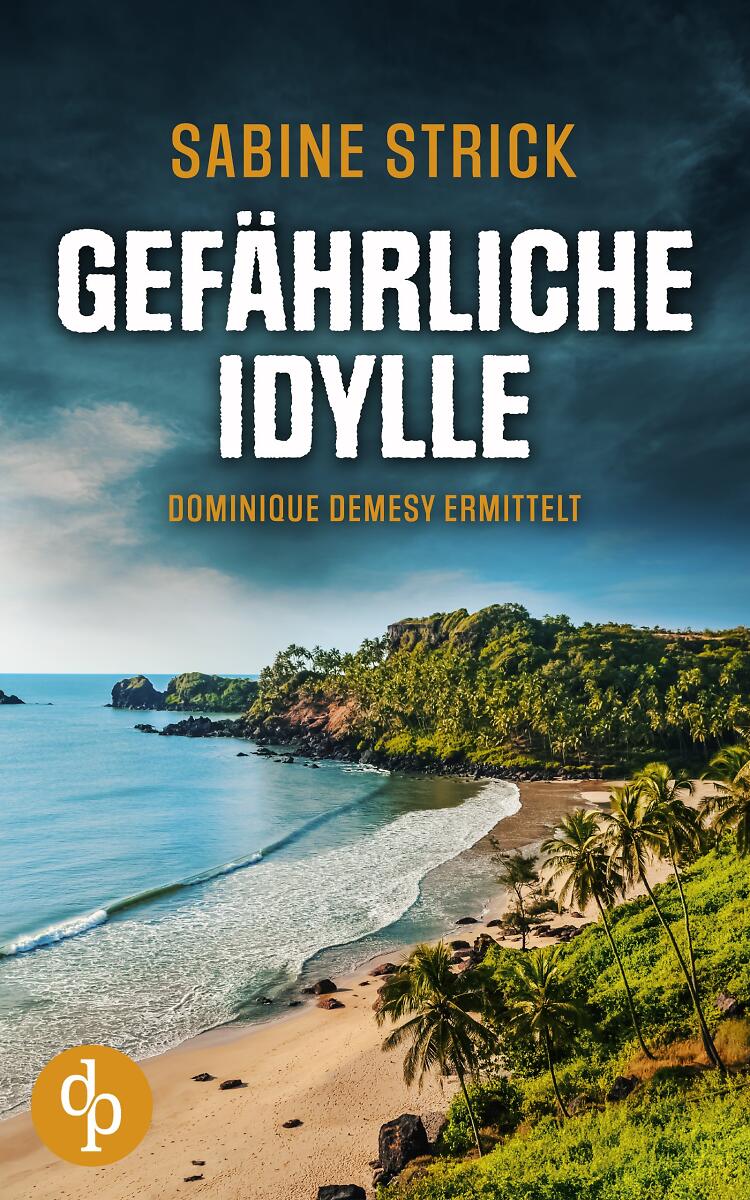PROLOG
Istanbul 1993
Auf der Intensivstation des Internationalen Krankenhauses in Istanbul herrschte geschäftiges Treiben. Pflegepersonal eilte hin und her, Ärzte überwachten unaufhörlich den Zustand der Schwerkranken, die an hektisch piependen Maschinen angeschlossen waren.
Die Lider des Mannes, der in einem der Betten lag, flatterten. Unruhig warf er den Kopf hin und her. Er nahm undeutlich eine blonde Frau in einem blassblauen Kittel wahr, die sich ihm näherte.
„Guten Morgen, Mr Demesy“, begrüßte sie ihn in akzentfreiem Englisch. „Na, sind wir wieder wach? Wie fühlen Sie sich denn heute?“
Dominique Demesy stöhnte. Bei jedem Atemzug schienen Tausende von Nadeln in seine Brust zu stechen. Auch sein Hals und seine Nase schmerzten, und in seinem Kopf dröhnte es, als ob ein Hammer auf einen Amboss schlüge. Er wollte es der Ärztin sagen, doch er brachte kein Wort hervor. Matt sank sein Kopf zur Seite, und er fiel wieder in den Dämmerschlaf, in dem er die letzten Tage dank ruhigstellender Medikamente verbracht hatte.
Dr. Laura Sayoglu blickte nachdenklich auf ihren Patienten, der vor drei Tagen mit einer gefährlichen Schussverletzung im Lungenbereich und einer schweren Gehirnerschütterung eingeliefert worden war und dessen Leben noch am seidenen Faden hing. Er ist ein attraktiver Mann, dachte die englische Ärztin. Der gebräunte Körper, der jetzt so apathisch und an unzählige Schläuche angeschlossen auf dem weißen Bett ruhte, war gut gebaut und sportgestählt. Das Gesicht, wenn auch vom Kampf mit dem Tod gezeichnet, besaß eine reizvolle Mischung aus Schönheit und Härte. Das volle dunkelbraune Haar begann an den Schläfen leicht zu ergrauen.
Dr. Sayoglu seufzte. Würde ihr Patient durchkommen? Es schien, als stünde damit der Ruf des Krankenhauses auf dem Spiel, denn die Affäre hatte Schlagzeilen in der türkischen Tagespresse gemacht. Ein französischer Privatdetektiv, der in Indien lebte, und eine von Interpol gesuchte italienische Meisterdiebin, die behauptete, ihre Ur-Großmutter sei eine Favoritin des letzten Sultans gewesen ...
Das brachte einen Hauch von Abenteuer in den Krankenhausgeruch aus Desinfektionsmittel und Äther. Die Chancen standen fifty-fifty, dass ihr Patient überleben würde. Es hatte ihn schwer erwischt, doch der Franzose schien eine gute Konstitution zu haben. Allerdings würde er kaum seine einstige Form wiedererlangen.
Kopfschüttelnd studierte die Ärztin die Werte auf dem Monitor am Kopfende des Bettes und winkte eine Krankenschwester heran. „Wir müssen ihn wieder an die Atemmaschine anschließen, er schafft es noch nicht allein. Und verabreichen Sie die übliche Dosis Morphium, er wird zu unruhig.“
***
Wieder wurde Dominique Demesy aus den Tiefen seines künstlichen Schlafs an die Oberfläche gespült und erlangte das Bewusstsein, was sich durch ein zentnerschweres Gewicht auf dem Brustkorb und bohrende Schmerzen ankündigte. Mühsam rang er nach Luft. Es kam ihm so vor, als hätte er nicht länger als eine Viertelstunde seit dem letzten Erwachen gedöst, doch tatsächlich waren zwei Tage vergangen. Nun merkte er auch, was ihn geweckt hatte: eine Frau saß an seinem Bett, streichelte seinen Arm und redete leise auf ihn ein. Sie hatte eine junge Stimme, die ihm vertraut war.
„So ist es richtig, Miss“, lobte die Stimme der Ärztin aus einer Ecke des Raumes. „Sprechen Sie so viel wie möglich mit ihm, auch wenn es scheint, als höre er es nicht. Im Unterbewusstsein bekommt er es doch mit, vor allem, wenn Sie in seiner Muttersprache mit ihm reden.“
Dominique nahm alle Kraft zusammen, um die Augen zu öffnen, aber seine bleischweren Lider wollten ihm nicht gehorchen. Er hatte Angst, dass die Frau verschwunden wäre, bevor er es schaffte, sie richtig anzusehen. Vielleicht könnte sie ihm sagen, was geschehen war, warum er mit diesen irrsinnigen Schmerzen in diesem Bett lag, mit unbekannten blau gekleideten Gestalten um ihn herum. Er konnte sich an nichts erinnern.
Beim vierten Versuch blieben seine Augen endlich offen. Mit noch mehr Anstrengung gelang es ihm, sie auf die junge Frau zu richten. Auf den ersten Blick war er enttäuscht: Auch sie trug einen verwaschenen blassblauen Baumwollkittel und hatte das Haar unter eine dünne blaue Haube geschoben. War es doch nur irgendeine Krankenschwester? Aber ihr Gesicht erinnerte ihn an jemanden und er wusste, dass sie in sein Leben gehörte. Ein Name kam ihm ins Gedächtnis.
„Jaclyn“, brachte er kaum hörbar hervor.
Auf dem hübschen, jungen Gesicht, das erfreut gelächelt hatte, als er die Augen geöffnet hatte, zeigte sich sekundenlang Enttäuschung. Dann schob sich ein sanftes, beruhigendes Lächeln davor. „Ich bin Jennifer. Erkennst du mich?“
Es gelang ihm, ein Nicken anzudeuten. Jennifer. Natürlich.
„Jaclyn“, murmelte er noch einmal, und es klang flehend.
„Sie ist nicht hier, Dominique“, erwiderte die junge Frau unsicher.
Was sollte das heißen, nicht hier? Er war sterbenskrank und die Frau, die sein Leben teilte, war nicht an seiner Seite? Wo war sie? Doch diese Frage zu stellen, war entschieden zu anstrengend. Bei jedem Wort durchfuhr ihn ein schneidender Schmerz von der Kehle bis zum Brustbein. Ein anderer Name fiel ihm ein.
„Sonja ...“
„Ich habe die Großeltern angerufen, sie werden es ihr sagen – wenn sie nicht gerade in Mariinsk ist.“
Dominique gab seinen schweren Lidern nach und ließ sie zufallen. Mariinsk ... etwas sagte ihm, dass er dort gewesen war, und dass sich etwas Schreckliches an diesem Ort abgespielt hatte, aber jetzt wusste er nicht einmal, wo er lag. Und Sonja? Wer war sie, warum rief ihr Name eine vage, unbestimmte Sehnsucht in ihm wach?
Aus dem Dunkel der Amnesie löste sich eine Flut langer, goldblonder Haare, ein schönes, kühles Gesicht mit großen braunen Augen. Doch der dazugehörige Name fiel ihm nicht ein. Sonja war es jedenfalls nicht, und auch nicht Jaclyn. Stattdessen drängte sich mit unangenehmer Deutlichkeit ein anderer Name in sein Gedächtnis: Brian O’Reely. Etwas Quälendes verband sich mit diesem Namen und wollte ihn nicht mehr loslassen.
„Ich habe Mutter angerufen“, erzählte die leise Stimme der jungen Frau weiter. „Sie ist sehr bestürzt, aber sie kann leider nicht herkommen, jedenfalls nicht sofort. Sie kann nicht aus dem Geschäft weg.“
Mit dieser Information konnte er überhaupt nichts anfangen. Er würde später darüber nachdenken. „Wer ist Brian O’Reely?“, flüsterte er mühsam blinzelnd.
„Denk jetzt nicht daran“, sagte Jennifer hastig.
„Es ist wichtig ...“, bekam er noch heraus, dann versagte seine Stimme.
„Er ist ein Freund“, meinte sie zögernd. „Aber das ist im Moment wirklich nicht von Bedeutung, glaub mir.“
Dominique schloss die Augen wieder und sah die Wolkenkratzer einer Großstadt vor sich, sah sonnenüberflutete Reisfelder, Wälder und schneebedeckte Berge. Alles wirbelte wie bei einem Kaleidoskop durcheinander. Ihm wurde schwindlig davon. Dann kam der Alptraum seiner Kindheit wieder. Er hörte schmerzvolle gepeinigte Frauenschreie, sah Blut auf einem schmutzigweißen Tischtuch und auf nackten Frauenbeinen, spürte peitschenden Regen auf seiner Haut, kalte Dunkelheit, heulenden Sturm. Er rannte um sein Leben, um Blut und Unwetter zu entkommen, bis seine Brust vor Anstrengung schmerzte.
Plötzlich wurde alles hell und ruhig, und er hatte das gleiche Bild vor Augen wie schon mehrmals in den letzten Tagen: blumengeschmückte Gräber auf einem Friedhof. Die Stille wurde nur von dem hässlichen Krächzen großer Krähen unterbrochen. Und die Schmerzen in der Brust waren auf einmal weg, er fühlte sich leicht und unbeschwert.
Entsetzt zwang er sich, in die Wirklichkeit zurückzukehren und hieß die wiederkehrenden Qualen fast erleichtert willkommen, denn sie zeugten vom Leben.
„Muss ich sterben?“, flüsterte er.
Jennifer schüttelte den Kopf und setzte ein zuversichtliches Lächeln auf. „Nein, du schaffst es. Du bist ein Kämpfer, Dominique, du wirst leben.“ Aber aus ihren großen grünbraunen Augen liefen ihr Tränen über die sanft gerundeten Wangen. Sie schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte. „Verzeih mir. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Doch, ich wollte es. Du hast mir so wehgetan, mein Leben lang.“
Dominique versuchte, die Hand nach ihr auszustrecken, um sie zu trösten, aber zwei Schläuche, an denen er festhing, hinderten ihn daran. Wütend wollte er mit der anderen Hand danach greifen, um sie abzureißen. Auf dem Weg dahin verhedderte er sich in den Kabeln, die durch Saugknöpfe seine Brust mit den elektronischen Apparaten verbanden. Unruhig zappelte er hin und her.
Laura Sayoglu und ein Krankenpfleger eilten herbei. Die Ärztin legte die Hände auf Jennifers zuckende Schultern. „Sie dürfen ihn nicht aufregen, Miss“, tadelte sie sanft. „Und sich selbst auch nicht. Bitte gehen Sie jetzt. Wollen Sie etwas zur Beruhigung nehmen?“
„Schlaftabletten“, schluchzte Jennifer nach kurzem Überlegen. „Ich möchte vergessen ... endlich wieder eine Nacht durchschlafen ...“
„Ich werde Ihnen etwas bringen lassen. Bitte warten Sie vor der Tür.“
Und während Jennifer den Raum verließ und sich noch einmal mit tränenüberströmtem Gesicht umdrehte, wand sich Dominique röchelnd auf seinem Bett, kämpfte mit dem Krankenpfleger, der ihn festhielt, und hustete Blut.
„Da haben wir die Bescherung“, murmelte Dr. Sayoglu.
Während ihm ein schneidender Schmerz die Brust zerriss und ihm ein zweiter in den Kopf fuhr, hörte Dominique einen Schuss krachen und höhnisches Frauengelächter, das die fremdsprachigen Anweisungen übertönte, die die Ärztin dem Krankenpfleger gab.
Dann versank wieder alles um ihn herum in barmherzige Bewusstlosigkeit. Aber die mosaikartigen Bilder aus seiner Vergangenheit wirbelten weiter in einem Höllentempo an ihm vorbei. Vergeblich bemühte er sich, sie festzuhalten, um sie wie ein Puzzle zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Er spürte die Hitze eines tropischen Ortes, eine glühende, sengende Sonne. Armselige Häuser unter Palmen. Die Namen Neukaledonien und Französisch-Guyana kamen ihm in den Sinn. Aufgebrachte dunkelhäutige Menschen standen Gendarmen in blauen Uniformen gegenüber. Er war einer von ihnen. Messer blitzten, Schüsse krachten. War das des Rätsels Lösung? War er bei einer Revolte verletzt worden? Er erinnerte sich, dass er damals noch recht jung gewesen war. Seine Gendarmen-Uniform hatte er vor vielen Jahren an den Nagel gehängt. Es hatte noch keine Jaclyn in seinem Leben gegeben. Auch keine Sonja. Genau genommen noch nicht einmal Jennifer. Nur die namenlose goldhaarige Schöne. Und diesen verflixten Brian O’Reely. Das war es also nicht.
‚Es ist Mitternacht’, hörte er eine Stimme. ‚Ich kann nie um diese Zeit einschlafen. Da plagen mich meine Mitternachtsdämonen.’ Hatte er selbst das gesagt? Waren die Dämonen, gegen die er gekämpft hatte, nun gekommen, um ihn endgültig zu holen? Wie sahen sie aus? Waren es schattenhafte Gestalten in langen, dunklen Gewändern mit blassen Gesichtern? Oder buntangemalte Fratzen wie auf den Holzmasken, die er schon so oft betrachtet hatte? Wo war das gewesen?
Er sah sattgrüne Reisterrassen vor sich, hohe Palmen und hohe Berge, Tempel und Moscheen, ein Wirrwarr von Menschen mit hell- bis dunkelbrauner Haut. Und immer wieder tauchte ein Name auf: Indien.
Ja, Indien. Das war es. In Indien hatte alles angefangen …
EPISODE 1: DIE TOCHTER AUS PARIS
1
Delhi 1991
Die Abenddämmerung senkte sich über die indische Stadt Delhi.
Die halbverfallenen Gebäude der Altstadt wirkten im Zwielicht geheimnisvoll und leicht bedrohlich. In dicken Mauerresten zertrümmerter Festungen wucherte das Unkraut, in kahlen Hallen gewaltiger Grabmäler verklang das Geräusch der Schritte. In den Gewölben von Jagdpavillons nisteten Hornissen. Putz bröckelte von den schwarz gewordenen, pilzdurchsetzten Mauern. Krähen krächzten. Hoch am Himmel kreisten Aasgeier und erinnerten an Tod und Verfall.
Im scharfen Kontrast dazu standen die Straßen der Altstadt, in denen buntes Treiben herrschte. Menschenmassen fluteten vorüber wie ein nicht abreißender Strom. Dazwischen versuchten sich Droschken, Rikschas und Autos einen Weg zu bahnen. Hin und wieder lagen Kühe auf Fahrbahn und Bürgersteigen und verursachten Staus.
Der französische Detektiv Dominique Demesy und sein amerikanischer Kollege Peter Hestersant schlichen im Schatten der baufälligen Häuser voran. Sie verfolgten einen jungen Inder, der sich mit raschen Schritten einen Weg durch die Menge der Leute bahnte, die zu Fuß, auf Eseln und Fahrrädern die schmale Gasse bevölkerten. Plötzlich blieb er stehen und blickte sich suchend um. Die beiden Detektive gingen hastig hinter dem Tresen einer Garküche in Deckung. Von dort aus spähten sie durch die Girlanden aus aufgefädelten Knoblauchzehen. Der Inder verschwand in einem Hauseingang.
Dominique machte Anstalten, ihm zu folgen. Peter hielt ihn zurück. „Das riecht nach einer Falle, Nick“, warnte er.
„Darauf müssen wir es ankommen lassen“, erwiderte Dominique in seinem melodiösen Englisch, dem ein leichter französischer Akzent anhaftete. Englische Muttersprachler, die ein Ohr dafür hatten, konnten auch einen winzigen irischen Dialekt heraushören. „Der französische Botschafter ist schließlich der Auftraggeber.“
„Ich würde meine Haut nicht mal für den amerikanischen riskieren“, brummte Peter.
„Dann hättest du eben Pilot bleiben sollen“, entgegnete Dominique kurz und trat wieder auf die Straße. Peter musste ihm wohl oder übel folgen.
Sie pirschten sich an den Eingang des Hauses heran und sahen sich noch einmal nach allen Seiten um. Es gab keine Anzeichen dafür, dass sie jemand beobachtete. Lautlos stiegen sie eine ausgetretene Steintreppe hinauf.
Vor der Tür, hinter der leise Stimmen erklangen, blieben sie stehen. Sie waren sicher, dass der Mann, den sie seit Tagen beobachtet und nun durch die halbe Stadt verfolgt hatten, sie zum gewünschten Ziel führte.
Dominique trat die Tür mit einem gewaltigen Tritt ein und stürmte gefolgt von Peter in das bescheidene Zimmer, in dem zwei Inderinnen auf dem Boden hockten und in einem großen Topf rührten. Erschrocken starrten sie die Eindringlinge an. Ohne sie weiter zu beachten, stürzten die Detektive auf eine halb offene Tür zu, die in ein winziges Hinterzimmer führte. Die drei Männer, die sich dort aufgehalten hatten, waren offenbar durch den Lärm gewarnt worden. Zwei von ihnen erwarteten sie mit gezückten Messern, während der dritte versuchte, die auf dem Boden ausgebreiteten Schmuckstücke einzusammeln und verschwinden zu lassen.
Die beiden Detektive zogen ihre Pistolen und hatten damit die besseren Karten. Sie fesselten die Ganoven und legten zufrieden die Juwelen der französischen Botschaftergattin in die Schatulle zurück.
In Europa hätten sie jetzt die Polizei gerufen, um die überführten Diebe festnehmen zu lassen. Doch in Indien wandte sich kaum jemand freiwillig an die Polizei, die Unschuldige brutalisierte und erpresste, während sie gleichzeitig Kriminelle gegen Bestechungsgelder verschonte. Korrupte Polizisten forderten Geld, um eine Anzeige aufzunehmen und taten dann alles, damit sich die Sache im Sande verlief.
Die Abneigung der Bevölkerung gegen die indische Polizei erklärte den Erfolg der Detektivagentur Stacy & Langmaster, für die Dominique und Peter arbeiteten. Gerade die in Indien lebenden Ausländer wandten sich lieber an die als seriös und effizient geltende Filiale eines großen Londoner Ermittlungsbüros, als das Risiko einzugehen, sich mit der Polizei einzulassen, deren Gräueltaten die Tageszeitungen füllten. Prügel, Folter und Vergewaltigung schienen an der Tagesordnung zu sein.
So begnügten sich Dominique und Peter damit, die Gangster gefesselt in ihrem Zimmer sitzen zu lassen. Bis ihnen die beiden Frauen die Fesseln abgenommen hatten, würden die Ermittler genug Vorsprung haben, das Haus zu verlassen und im Gewimmel der Straßen unterzutauchen.
Sie kehrten zum Auto zurück und fuhren nach New Delhi, zur Villa des französischen Botschafters, wo sie seiner erleichterten Gattin den Schmuck aushändigten.
„Wenn ich mir vorstelle, dass von diesem Schmuck ein ganzes Dorf in Indien jahrelang leben könnte ...“, sagte Peter nachdenklich, als sie die luxuriöse Villa verließen. „Genauer gesagt überleben ...“
„Ich weiß. Wie oft hätte ich die Diebesbeute lieber den armen verhungerten Gaunern gelassen statt sie den verfetteten reichen Auftraggebern zurückzubringen. Aber ist Kriminalität etwa die Lösung? Außerdem steht der Ruf der Agentur auf dem Spiel – und damit auch unser täglich Brot.“
„Trotzdem – manchmal frage ich mich, ob wir unser Geld in solchen Fällen nicht ein bisschen auf Kosten der Armen verdienen.“
„Ach, Unsinn. Schließlich beziehen wir unser Gehalt nicht von den Steuern der indischen Bevölkerung, sondern genau von den Reichen, die du anscheinend schröpfen möchtest, um das Weltkapital ein bisschen umzuverteilen.“ Dominique lachte und klopfte Peter auf die Schulter.
„Du hast recht“, gab dieser zu. „Ich weiß auch nicht, woher mir diese Ideen plötzlich kommen. Ich glaube, ich habe einen Moralischen, weil mein Sohn heute Geburtstag hat und ich ihn schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe.“
Sie stiegen in Peters Wagen.
„Ich habe meine Tochter schon seit sechs Jahren nicht mehr gesehen“, murmelte Dominique. „Nehmen wir noch einen Drink bei mir?“
Peter nickte.
Dominiques Wohnung lag in einem Häuserblock nicht weit entfernt vom Botschafterviertel. Nach dem Gewühl der Altstadt wirkten die breiten Alleen von New Delhi wie leer gefegt, obwohl auch hier rege Betriebsamkeit herrschte. Hinter gepflegten Rasenflächen und üppigen Hecken lagen elegante Villen, durch hohe schmiedeeiserne Zäune abgeschirmt von der bettelnden und handelnden Bevölkerung.
Hier lebten die reiche Oberschicht Indiens und wohlhabende Ausländer. Nach indischen Maßstäben gehörten Dominique und Peter dazu, obwohl ihre Gehälter eher bescheiden waren. Dominique hätte als Detektiv in Frankreich wesentlich mehr verdienen können, und Peter hatte als Pilot der PAN AM ein vielfaches Einkommen bezogen. Aber Geld hatte für diese beiden idealistischen Abenteurer nur einen geringen Stellenwert.
Dominiques geräumige Zweizimmerwohnung war schlicht, aber behaglich eingerichtet und geschmackvoll dekoriert. Die weiß getünchten Wände wurden von einem orientalischen Wandteppich und zwei Landschaftsgemälden mit indischen Motiven geziert. In einer einfachen Schrankwand standen ein Fernseher, eine kleine Stereoanlage und ein paar Bücher. Keine Fotos, nur einige dekorative Souvenirs aus Afrika und der Südsee.
Peter ließ sich auf der Couch nieder und streckte seufzend die Beine von sich. „Oh Mann, war das ein Tag.“
Dominique ging in die Küche und kam mit zwei Bierbüchsen wieder. Die Männer zündeten sich Zigaretten an und tranken durstig einige Schlucke Bier.
Dominiques Telefon klingelte.
„Bonjour, hier ist Cathérine“, sagte eine Stimme von weit her.
Vor Überraschung fiel Dominique fast die Zigarette aus dem Mundwinkel.
„Hallo, wie geht’s? Was ist los?“, fragte er alarmiert.
Cathérine war Dominiques Ex-Frau. Er war seit fünfzehn Jahren von ihr geschieden, und da sie in Paris lebte, hatten sie so gut wie keinen Kontakt mehr. Die einzige Verbindung stellten die monatlichen Schecks dar, die Dominique ihr für Jennifers Unterhalt schickte.
Peter trank in genießerischen kleinen Zügen sein Bier und beobachtete dabei seinen Kollegen und Freund.
Dominique war ein äußerst attraktiver Mann, groß, schlank und durchtrainiert. Die ersten Fältchen verhärteten seine klaren ebenmäßigen Gesichtszüge. Seine Augen waren von einem tiefen Blaugrün, das sich gegen seine gebräunte Haut abhob. Die ernste, entschlossene Miene, die er oft aufsetzte, erhöhte seine mysteriöse Ausstrahlung, die auf die meisten Frauen unwiderstehlich wirkte. Genau wie sein verschmitztes Lächeln, bei dem sich lange Grübchen in seinen Wangen bildeten.
Seine Stimme war dunkel und rauchig. Peter verstand kaum ein Wort Französisch; dennoch lauschte er fasziniert. Dominique sprach ein gutes, aber eher langsames, wohlüberlegtes Englisch, in seiner Muttersprache jedoch wirkte er wesentlich lebhafter und spontaner. Seine Mimik schwankte zwischen Betroffenheit, Ablehnung und Interesse. Er fuhr sich nervös mit den schlanken Fingern durch das dichte, dunkelbraune Haar.
„Das kommt nicht in Frage!“, lehnte er gerade heftig ab.
„Dominique, du musst mir helfen!“, insistierte die Frauenstimme am anderen Ende, Tausende von Kilometern entfernt. „Jennifer ist schließlich auch deine Tochter. Du hast dich nie um sie gekümmert und ich habe es bisher nie von dir verlangt. Aber jetzt bitte ich dich zum ersten Mal darum!“
„Jetzt, wo sie fast erwachsen ist! Hör zu, Cathérine, hältst du es wirklich für eine gute Idee, dass ich sie zu mir nehme? Abgesehen davon, dass Indien bestimmt nicht das richtige Land ist, um einem verbummelten, jungen Mädchen einen guten Start ins Berufsleben zu bieten. Ich weiß auch nicht, ob ich die richtige Person bin, um sie zu ‚disziplinieren‘, wie du es so schön nennst. Sie kennt mich ja kaum.“
„Aber genug, um sich ein Idealbild von ihrem ewig abwesenden Vater gemacht zu haben. Im Vergleich dazu schneiden Jacques und ich natürlich sehr schlecht ab. Wenn ihr jemand Disziplin beibringen kann, dann du – du verstehst es, dir Respekt zu verschaffen, und du erreichst immer, was du willst. Du kannst einem jungen, desorientierten Menschen ein Vorbild sein!“
„Ich wusste gar nicht, dass du eine so hohe Meinung von mir hast“, spottete er. „Warum kann dein Mann ihr nicht dieses Vorbild sein?“
Trotz des Rauschens und Knisterns in der Leitung hörte er ihr Seufzen. „Das ist ein Problem. Die beiden können sich nicht leiden. Jacques scheint sie geradezu aus dem Haus zu treiben – natürlich, ohne es zu wollen. Sie meidet ihn und tut nie, was er sagt.“
„Mit neunzehn hat sie ein Recht auf Unabhängigkeit. Vielleicht engt ihr sie zu sehr ein?“
„Das können wir gar nicht, sie ist ja kaum noch zu Hause! Sie entgleitet uns immer mehr. Jacques und ich arbeiten viel, wir können sie nicht beaufsichtigen. Dominique, ich habe Angst um sie! Bei dieser Herumtreiberei kann sie auf die schiefe Bahn geraten. Sie muss aus diesem Milieu heraus und deshalb halte ich einen Tapetenwechsel für ideal.“
„Schlechte Gesellschaft gibt es hier auch. Und ich kann sie auch nicht ständig beaufsichtigen – ich arbeite oft spätabends und bin häufig auf Reisen.“
„Ich bin sicher, du hättest einen guten Einfluss auf sie“, beharrte Cathérine.
„Spricht sie überhaupt Englisch?“
„Ja. Es war das einzige Fach, in dem sie beim Abitur eine gute Note hatte.“
„Kann sie kochen?“
„Weiß nicht. Sie zeigt keinerlei hausfrauliche Ambitionen.“
„Das werde ich ihr als Erstes beibringen“, knurrte er.
„Soll das heißen, du bist einverstanden?“, fragte Cathérine hoffnungsvoll.
„Meinetwegen lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Besorg ihr ein Touristenvisum, ich kümmere mich vor Ort um alle Formalitäten. Lass sie gegen Tetanus und Hepatitis B impfen, und sie muss Typhus- und Malariaprophylaxe nehmen. Und sie soll ihr Abiturzeugnis mitbringen. Ich werde versuchen, ihr hier einen Job zu besorgen.“
„Du bist ein Schatz, Dominique.“
„Aber wenn sie mir zu sehr auf den Wecker fällt, schicke ich sie zu dir zurück!“
„Du wirst dich in ihren Charme verlieben und sie nie wieder hergeben wollen“, versicherte Cathérine.
Dominique rief sich die bildschöne junge Blondine in Erinnerung, die er vor knapp 20 Jahren geheiratet hatte. „Sieht sie dir jetzt eigentlich ähnlich?“
„Nein, nicht besonders. Sie kommt mehr nach dir, finde ich.“
„Das freut mich.“
„Ich muss jetzt Schluss machen. Ich rufe dich noch mal an, wenn ich weiß, wann sie ankommt. Bis dann, Dominique.“
„Halt!“, rief er. „Was hält überhaupt Jennifer davon, dass …“
Doch Cathérine hatte bereits aufgelegt.
Dominique warf den Hörer auf die Gabel und holte eine Flasche und ein Glas aus einem Schrank. „Auf den Schreck brauche ich einen Whisky.“
„Was ist los?“, erkundigte sich Peter.
„Ich kriege Logierbesuch. Meine Tochter.“
„Das ist doch prima. Macht sie hier Urlaub?“
„Nein. Meine Ex-Frau wird mit ihr nicht mehr fertig und findet, dass es nun an mir ist, endlich väterliche Autorität auszuüben. Cathérine sagt, dass Jennifer seit dem Abitur überhaupt nichts mehr tut, nur noch in den Tag hineinbummelt und sich die Nächte um die Ohren schlägt. Sie treibt sich herum, macht keine Anstalten, sich um einen Job oder ein Studium zu kümmern, hat nach Cathérines Geschmack zu viele Männerbekanntschaften …“
„Abitur hast du gesagt?“, unterbrach Peter verblüfft. „Wie alt ist deine Tochter nochmal?“
„Sie ist im Januar neunzehn geworden.“
„Da hast du aber früh angefangen.“
„Ja, ich war einundzwanzig, als sie geboren wurde. Ein Unfall natürlich, der mich dazu zwang, dieses verwöhnte launische Luder Cathérine zu heiraten ...“ Er ließ seine Augen durch den Raum schweifen. „Wo soll ich sie überhaupt unterbringen? Was für eine idiotische Idee! Na ja, sie kann auf der Klappcouch schlafen, die ist recht bequem ...“
„Neunzehn ...“ Peter ließ das Wort genießerisch auf der Zunge zergehen. „Ich nehme sie gerne bei mir auf, wenn du nicht weißt, wohin mit ihr“, bot er großzügig und mit verschmitztem Zwinkern seiner graublauen Augen an.
„Ferkel“, brummte Dominique. „Übrigens glaube ich nicht, dass sie dein Typ ist.“
„Hast du ein Foto?“
Dominique holte einen Pappkarton mit Fotos aus dem Schrank. Er wühlte ein wenig darin herum und fischte ein Foto heraus, das er Peter hinhielt. Dieser musterte entzückt die kühle Schönheit mit den schulterlangen goldblonden Haaren und den großen braunen Augen.
„Was für ein bildhübsches Weib! Sieht aber älter aus als neunzehn.“
„Blödmann, das ist meine Ex-Frau. Jennifer ist die Kleine daneben.“
Peter betrachtete den etwas pummligen, linkisch wirkenden Teenager mit dem fahlen Teint und den brav zurückgekämmten hellbraunen Haaren. Das verkrampfte Lächeln ließ eine Zahnspange erahnen. „Wie alt war sie da?“
„Das war vor sechs Jahren. Das Bild habe ich aufgenommen, als ich zum letzten Mal in Frankreich war. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.“
„Schämst du dich nicht?“ Peter dachte an seinen Sohn und seufzte.
„Paris und Delhi sind nicht gerade Nachbarstädte“, verteidigte sich Dominique. „Cathérine hat sich immer geweigert, mir Jenni in den Ferien zu schicken. Seit ich hier lebe, hatte ich nicht immer das nötige Kleingeld für Flüge nach Paris. Und ich will meinen Urlaub auch nicht ständig in Frankreich verbringen. So wie du deinen nicht in New York!“
„Ich hoffe, meine Ex schickt mir Patrick nächstes Jahr in den großen Ferien, dann zeige ich ihm Indien. Ich vermisse ihn natürlich schon. Auch wenn mir Urlaub mit einer hübschen Lady in Kerala oder auf den Malediven ehrlich gesagt mehr Spaß macht als mit quengelnden Kindern oder verbohrten, ewig schmollenden Teenagern.“
„Wem sagst du das. Ich konnte mit Kindern nie viel anfangen“, gestand Dominique. „Meine Tochter ist mir fast fremd. Sie war erst vier, als Cathérine und ich uns scheiden ließen. Du weißt ja, dass ich bei der mobilen Gendarmerie alle zwei Jahre versetzt wurde. In Französisch-Guyana, im Senegal und auf Neukaledonien waren Heimatbesuche auf einmal im Jahr reduziert – wenn überhaupt. Und seit ich die Armee verlassen habe und nach Indien gezogen bin, habe ich mit meinem alten Leben nahezu abgeschlossen. Dieses Land nimmt einem jedes Leben, das man zuvor geführt hat. Und der Job hält mich so in Atem, dass ich nicht mehr dazu komme, noch groß an die Vergangenheit zu denken. Klingt das nach blöden Ausflüchten?“
„Keine Ahnung, aber mir geht es genauso. Die letzten zwei Jahre sind wie im Flug vergangen. Indien hat mich umgekrempelt, aufgesaugt. Amerika, das ist so weit weg. Es ist, als ob Indien mich adoptiert hat. Nur mein Job als Pilot fehlt mir manchmal. Die Zwänge und Vorschriften der PAN AM allerdings nicht.“
„Stacy & Langmaster gibt dir ja oft genug Gelegenheit, deine Kollegen durch die Lande zu fliegen, damit du es nicht verlernst.“ Dominique runzelte die Stirn. „Peter, mir ist richtig mulmig bei dem Gedanken, dass ich da bald einem jungen Mädchen gegenüberstehen werde, das Papa zu mir sagen und Ansprüche an mich stellen wird. Es ist die dämlichste Idee, die Cathérine je gehabt hat.“
Peter schüttelte den Kopf. „Du hast in unzählige Pistolenmündungen geblickt, ohne mit der Wimper zu zucken, hast gegen Demonstranten, Schläger und Revolutionäre gekämpft, hast Schwerverbrechern das Handwerk gelegt … und hast jetzt Angst vor einem jungen Mädchen, das dein eigen Fleisch und Blut ist? Sei nicht albern!“
„Was wäre, wenn deine Ex-Frau dir plötzlich deinen Sohn andrehen wollen würde?“
„Ich würde mich freuen.“
„Dann wäre es aber aus mit deiner Freiheit“, gab Dominique zu bedenken. „Keine Mädchen mehr, die in deiner Wohnung ein- und ausgehen, keine Wochenendtouren mehr nach Kaschmir oder Pondicherry ...“
„Und warum nicht? Nick, ich glaube, du nimmst das ein bisschen zu ernst. Erstens ist deine Tochter fast erwachsen, sie braucht keinen Babysitter mehr. Wie du ja gehört hast, führt sie ein vergnüglicheres Leben als du. Zweitens ist es an ihr, sich an dein Leben anzupassen, und nicht umgekehrt. Und drittens wirst du sehen, dass Kinder durchaus eine Bereicherung sein können. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, als mit einem jungen Mädchen zusammenzuleben!“
Dominique kippte den Rest seines Whiskys hinunter und stellte das Glas mit einer entschlossenen Bewegung auf den Tisch zurück. „Du hast recht. Und wenn sie mir zu sehr auf die Nerven geht, nehme ich dein Angebot an und schicke sie zu dir!“
2
Vier Wochen später landete die Maschine der Air France, die Jennifer Demesy nach Delhi brachte, auf dem Indira Gandhi International Airport. Das junge Mädchen folgte den anderen Passagieren durch den langen, mit bunten Mosaiksteinen gekachelten Gang des Flughafens. Ein schwer definierbarer und fast ekelerregender Geruch hing in der Luft, wie eine Mischung aus Fäkalien und fremdartigen Gewürzen.
Jennifer hievte ihren großen Koffer und die prall gefüllte Reisetasche vom Transportband auf einen Gepäckwagen und reihte sich in die lange Schlange der Wartenden ein, die sich vor der Zoll- und Passkontrolle gebildet hatte. Während sie langsam aufrückte, stellte sie sich gelegentlich auf die Zehenspitzen und sah suchend geradeaus. Kurz bevor sie an der Reihe war, entdeckte sie ihren Vater in der gedrängten braunhäutigen Menschenmenge von Männern in pyjamaähnlichen Anzügen und Frauen in bunten Saris.
Als sie die Kontrolle passiert hatte, stürmte Jennifer auf ihn zu und warf ihm die Arme um den Hals. „Hi, Papa!“
Dominique, der seine Tochter nicht gleich erkannt hatte, schob sie verblüfft auf Armlänge von sich weg. Ein anerkennendes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, während er sie musterte. Schulterlange hellbraune Haare umrahmten stufig geschnitten ein Gesicht mit hohen Wangenknochen und frischem Teint, das seinem eigenen recht ähnlich war. Klare grünbraune Augen strahlten ihn an. Die gerade Nase war eine kleinere Ausgabe seiner eigenen. Eine schmale Oberlippe saß auf einer etwas volleren, sinnlichen Unterlippe, genau wie bei ihm. Die kleinen ebenmäßigen Zähne benötigten nun keine Zahnspange mehr und auch der Babyspeck war weg. Sie trug enge Jeans und einen dünnen Blouson über dem T-Shirt.
„Jenni, wie hübsch du geworden bist“, brachte Dominique endlich hervor.
„Danke, du hast dich auch ziemlich gut gehalten“, gab sie trocken zurück.
Ihre Stimme war angenehm und dunkel. Sie sprach in dem weichen, verwaschenen Tonfall der Pariser, im typischen Slang der Jugendlichen.
„Man tut, was man kann. Aber deine Veränderung ist wirklich gravierend.“
„Aus hässlichen Entlein werden eben manchmal stolze Schwäne.“
Dominique lachte und zog sie wieder an sich.
Dann sammelten sie Jennifers Gepäck ein und gingen zu Dominiques Wagen.
Kaum hatten sie das Flughafengebäude verlassen, als sich ihnen zahlreiche Hände entgegenstreckten. Dunkle zerlumpte Gestalten, die sich aus der Nacht herauslösten.
„Himmel, das ist ja schlimmer als in der Metro.“ Jennifer packte ihre Reisetasche unwillkürlich fester.
Dominique nahm sie am Arm. „Kümmere dich nicht darum. Das ist die erste Grundregel für Reisende in Indien: gib nie einem Bettler Geld – sonst kommen fünfzig andere und ziehen dich aus bis aufs Hemd.“
Aber die Bettler waren schwer zu ignorieren. Verhärmte Frauen und Männer, die wie Greise aussahen, aber kaum älter waren als dreißig; Kinder in zerrissener, dreckiger Kleidung, denen der Hunger in die ernsten Gesichter geschrieben stand. Sie stellten sich mit bittend aufgehaltenen Händen den ankommenden Reisenden in den Weg, zupften sie an den Ärmeln.
„Bâbu, Bâbu“, riefen und wimmerten sie ohne Unterlass.
„Bâbu ist eine indische Anrede und heißt ‚mein Herr‘“, reagierte Dominique auf Jennifers fragenden Blick.
Die war froh, als sie endlich Dominiques dunkelblauen Renault erreicht hatten.
„Ist das hier überall so?“, wollte sie etwas beklommen wissen, während Dominique den Wagen startete.
„So und noch schlimmer. In Delhi geht es noch, es ist eine relativ reiche Stadt ohne richtige Elendsviertel. Aber in Bombay, Kalkutta, Benares und vielen anderen Städten liegen die Verkrüppelten auf der Straße und Nicht-Einheimische werden von Bettlern eingekreist. Auf den Gehwegen schlafen unzählige Obdachlose und morgens werden die Toten eingesammelt und fortgeschafft. Das ganze Land ist ein jämmerliches Elend.“
„Was ist das für ein komischer Geruch hier?“
„Ausdünstungen einer indischen Großstadt. Urin, verwesende Blumen, faulendes Essen, verbrannte Kuhfladen.“
Sie starrte ihn entgeistert an.
„Da Holz sehr teuer ist, verwenden die Inder getrocknete, mit Stroh vermischte Kuhfladen als Brennmaterial“, erklärte er.
„Und wie heizt und kochst du bei dir zu Hause?“, fragte sie misstrauisch.
„Elektrisch.“
Jennifer atmete auf.
Sie fuhren durch gepflegte Villenviertel New Delhis. Die Dunkelheit wurde durch zahllose Straßenlampen erhellt. Jennifer musterte aufmerksam die sattgrünen Rasenflächen, die üppigen Blumenbeete, die sorgfältig gestutzten Bäume und Hecken und die eleganten Häuser.
„Schicke Gegend. Gibt es hier auch Nachtclubs?“
„Die Luxushotels haben welche. Aber da dürfen nur die Hotelgäste rein.“
„Na, da wird mir schon was einfallen“, murmelte sie.
Dominique runzelte die Stirn. „Das wird nicht nötig sein. Du wirst hier nicht in Nachtclubs oder sonst was gehen, liebe Tochter.“
Sie verzog das Gesicht. „Womit kann man sich denn hier abends die Zeit vertreiben?“
„Es gibt Kinos. Sehr instruktiv, wenn man die Sagen und die Geschichte Indiens kennenlernen will. Allerdings triefen die Filme vor Schmalz und Klischees.“
Jennifer rümpfte die Nase. „Und was ist mit schicken Restaurants?“
„In einem Land, wo drei Viertel der Bevölkerung Hunger leiden, gilt es als geschmacklos, üppig und teuer in der Öffentlichkeit zu essen. Die Restaurants sind diskret und bescheiden – oder gut versteckt in Hotels. Außerdem habe ich gehofft, du könntest kochen. Dann sparen wir das Geld für Restaurants.“
Zwischen Jennifers Augenbrauen bildeten sich zwei steile kleine Falten. „Mal angenommen, ich wäre bereit, für dich die Köchin zu spielen“, erwiderte sie hoheitsvoll. „Aber mit irgendwas muss ich mich doch beschäftigen, ich kann schließlich nicht den ganzen Tag nur kochen und ins Kino gehen!“
Dominique lachte auf. „Wenn du abends von der Arbeit kommst, wirst du so geschafft sein, dass dir gar nicht mehr nach Ausgehen sein wird.“
„Arbeit?“, wiederholte sie sehr akzentuiert, als spräche sie das Wort zum ersten Mal in ihrem Leben aus.
„Ja, Arbeit. Das ist diese Einrichtung, womit sich jeder erwachsene Mensch, der halbwegs auf Draht ist, seinen Lebensunterhalt verdient“, erklärte er leicht gereizt. „Oder hast du dir eingebildet, dass deine Mutter Tausende von Francs in ein Flugticket investiert, damit du bei mir herumbummeln und faulenzen kannst wie in Paris?“
„Schon gut“, knurrte Jennifer. „Was soll ich also tun? In den Hotels die Zimmer saubermachen oder in Krankenhäusern Böden schrubben?“
„Zum Beispiel. Dann würdest du mal kennenlernen, was Arbeit heißt. Aber damit würdest du kastenlosen Inderinnen den Arbeitsplatz wegnehmen. Deine Mutter sagte, du hättest auf dem Gymnasium Kurse in Schreibmaschine und Stenografie belegt, und dein Englisch sei auch recht gut. Also habe ich dir einen Job als Sekretärin besorgt. Du wirst allerdings umlernen müssen – die Schreibmaschinen haben hier eine andere Tastatur, und englische Stenografie ist natürlich anders als französische. Aber ich denke, du wirst das schon packen.“
„Was ist das für eine Firma?“, wollte Jennifer missmutig wissen.
„Du wirst bei Stacy & Langmaster mitarbeiten, der Detektivagentur, bei der ich beschäftigt bin. Die Sekretärin vom Chef ist schon lange überlastet, und meine Kollegen und ich müssen zu viel Papierkram und Bagatellrecherchen selbst erledigen, was uns die Zeit für wichtigere Nachforschungen nimmt. Ich habe Mr Stacy davon überzeugen können, dass wir eine Assistentin brauchen. Und dass es ideal wäre, diesen Platz mit meiner Tochter zu besetzen.“
Jennifers eben noch finsteres Gesicht verwandelte sich wieder in vergnügtes Strahlen.
„Ich soll bei dir in der Detektei mitarbeiten? Spitze, das klingt interessant!“, sagte sie begeistert. „Darf ich dich auch begleiten, wenn du einen deiner Fälle löst?“
„Vielleicht, wenn du eingearbeitet bist. Aber dazu musst du dir erst mal Mühe geben, die Büroarbeit in den Griff zu kriegen.“
Sie verzog erneut das Gesicht.
„Wir sind da.“ Dominique parkte den Wagen vor einem beigefarbenen dreistöckigen Gebäude.
Sie stiegen mit dem Gepäck in die zweite Etage. Jennifer sah sich interessiert in Dominiques Wohnung um. Er hatte in den letzten Tagen intensiv an einem neuen Auftrag gearbeitet und war nur zum Schlafen, Duschen und Umziehen nach Hause gekommen. Dementsprechend sah die Wohnung aus. In der kleinen Küche stapelte sich schmutziges Geschirr, im Wohnzimmer hingen achtlos hingeworfene Kleidungsstücke über Couch und Stühlen, auf dem Tisch türmten sich Papiere zwischen leeren Bierdosen und einem überquellenden Aschenbecher. Der schöne dunkle Perserteppich war schon lange mit keinem Staubsauger mehr in Berührung gekommen.
„Hier sieht es richtig schön schlampig aus“, stellte Jennifer amüsiert fest. „Und da wirft Maman mir immer vor, ich wäre unordentlich!“
Dominique warf ihr einen verärgerten Blick zu.
„Was für ein langer Flug, ich bin ganz geschafft.“ Jennifer fegte ein Hemd vom Sofa und ließ sich darauf nieder. Sie nahm sich eine Zigarette aus der auf dem Tisch liegenden Schachtel, schlüpfte aus den Pumps und legte die nackten Füße auf die Tischkante. Dann beugte sie sich vor, angelte nach einem Feuerzeug, zündete sich die Zigarette an und paffte genüsslich. Ihr Vater stand im Türrahmen und beobachtete sie mit gerunzelter Stirn.
„Kann ich ’nen Drink haben?“, fragte sie mit kokettem Augenaufschlag.
„Runter mit den Füßen!“, befahl Dominique barsch. „Und das nächste Mal fragst du, bevor du dich an meinen Zigaretten bedienst! Und Alkohol gibt's hier erst für Leute ab einundzwanzig.“
„Reg dich ab, Väterchen. Ich habe ja nur Durst auf was Erfrischendes.“
„Nicht in diesem Ton, Mademoiselle. Wenn du was trinken willst, dann geh in die Küche. Im Kühlschrank ist Wasser und Orangensaft. Gläser stehen im Schrank.“
„Mach dir keine Umstände, ich finde mich schon zurecht“, erwiderte Jennifer kühl und ging barfuß in die Küche.
Dominique seufzte. Er hatte Cathérine als eine energische und recht autoritäre Person in Erinnerung. Wenn sie nicht mit Jennifer zurechtkam, war es mit Strenge allein nicht getan. Wahrscheinlich musste er sie als Erwachsene behandeln, wenn er etwas erreichen wollte, und nicht als das verwöhnte, eigensinnige Kind, das sie war.
„Bist du mir eigentlich böse, Jenni?“, fragte er, als sie nebeneinander auf der Couch saßen, rauchten und Orangensaft tranken.
„Weil du mich angemotzt hast?“ Sie zuckte mit den Schultern. „Nein, du hast ja recht: Füße gehören nicht auf den Tisch, und man sollte sich bei anderen nicht einfach bedienen. Aber zu Hause tue ich das, um Mutter und Jacques zu ärgern. Die sind so schrecklich spießig.“
„Ich meinte eher, ob du mir böse bist, weil ich mich in all den Jahren so wenig um dich gekümmert habe“, sagte er vorsichtig.
Sie warf ihm einen schrägen Seitenblick zu. „Lustig war das nicht, das kann ich dir sagen! Ich hätte dich schon gerne öfter gesehen – manchmal kam ich mir vor wie eine Halbwaise. Aber meine Freundinnen sind vor Neid immer fast geplatzt, wenn ich gesagt habe, mein Vater ist Gendarm auf Neukaledonien oder Detektiv in Indien.“
„Aber jetzt bist du fast erwachsen, und ich habe dich nicht heranwachsen sehen. Wir kennen uns kaum, eigentlich sind wir Fremde füreinander. Ist das nicht schade?“
„Das können wir ja nachholen, oder?“ Jennifer lachte ihn an und gab ihm einen raschen Kuss auf die Wange.
Dominique lächelte erleichtert und legte den Arm um sie. „Was ist das für ein Kerl, den deine Mutter geheiratet hat? Ist er wie ein Vater für dich?“
„Der? Eine blöde Type. Er ist über fünfzig. Und fürchterlich spießbürgerlich und konservativ, hält mir mit Vorliebe stundenlange Moralpredigten über alles Mögliche. Was ihn aber nicht daran hindert, mich anzugrabschen, sobald Mutter nicht hinguckt.“
„Hat er dich …“ Er starrte seine Tochter betroffen an.
„Nein, er hat mich nicht missbraucht. Er beschränkte sich aufs Grabschen. Aber seit ich ihm mal einen Finger gebrochen habe, rührt er mich nicht mehr an.“
Dominique hatte die Stirn gerunzelt und grinste nun. „Ich sehe, du weißt dir zu helfen – ganz meine Tochter.“ Ein gewisser Stolz lag in seiner Stimme.
„Wo soll ich schlafen?“
„Ich trete dir mein Bett ab. Du kannst dich in meinem Schlafzimmer breitmachen. Ich werde auf der Couch schlafen. Dann störe ich dich nicht, wenn ich spätabends nach Hause komme. Komm mit, du kannst gleich deine Sachen auspacken.“
Jennifer folgte ihrem Vater ins Schlafzimmer. Die tiefblauen Vorhänge in dezentem Kaschmirmuster und die dazu passenden Kissen auf dem Bett verliehen dem schlicht möblierten Raum Behaglichkeit. Auf der Kommode stand eine orientalische Lampe, die an Aladins Wunderlampe erinnerte. Den Boden aus dunklem Parkett zierte ein Läufer mit nordafrikanischem Wüstenmotiv. An der weißgetünchten Wand hing ein gerahmter Gauguin-Kunstdruck mit halbnackten Südsee-Schönheiten.
„Schön hast du es hier. So exotisch. Ethno-Look ist in Paris total in.“
„Tatsächlich?“
„Sag mal, Papa, hast du eigentlich eine Freundin oder so was?“, fragte sie, als sie ihre Reisetasche auf das breite französische Bett stellte.
„Eher ‚oder so was‘“, erwiderte Dominique trocken. „Es gibt da eine Dame, die ich gelegentlich treffe, aber … sie ist verheiratet.“
„Herrje, dann könnt ihr euch ja gar nicht mehr alleine sehen, wo ich jetzt hier bin.“
„Mach dir keine Sorgen, notfalls schicke ich dich ins Kino. Die indischen Filme dauern mindestens drei Stunden.“ Er zwinkerte ihr zu. „Die rechte Schrankhälfte ist deine, und diese beiden Schubladen kannst du auch benutzen.“
Jennifer verstaute T-Shirts, Blusen, lange Hosen und Sommerkleider. Ein Stapel zarter Dessous, der in einer Schublade verschwand, brachte Dominique auf einen Gedanken. „Hast du eigentlich einen petit ami, den du in Paris zurückgelassen hast?“
„Zwei sogar. Einen niedlichen Algerier in meinem Alter und einen sehr interessanten Mittdreißiger, leider verheiratet. Beide waren Mutter ein Dorn im Auge. Aber keine Sorge, ich werde mich nicht vor Liebeskummer verzehren. Bei den Indern gibt’s sicher auch süße Typen.“ Sie warf ein Nachthemd auf das Kopfkissen.
„Lass dir nicht einfallen, was mit einem Inder anzufangen. Du kennst die Mentalität nicht.“
„Wieso, wie ist sie denn?“
„Für Inder sind europäische Frauen leicht zu habende Weibchen. Sie würden mit dir ins Bett gehen, weil es ihr Prestige erhöht, mit einer weißen Frau zu schlafen, aber gleichzeitig würden sie dich dafür verachten. Und ich habe mir sagen lassen, dass Inder miserable Liebhaber sind.“
„Aha“, machte Jennifer enttäuscht. „Und was ist mit den Inderinnen? Hattest du mal eine indische Freundin?“
„Keine Inderin aus einer akzeptablen Kaste würde sich mit einem Europäer abgeben. Sie würde von ihrer Familie verstoßen werden – schließlich sind wir für die Hindus unrein. Abgesehen davon werden die indischen Frauen genauso unter Verschluss gehalten wie die arabischen, auch wenn sie sich mit nackten Armen und nackter Taille in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Aber sie haben im Vergleich zu Männern praktisch keine Rechte.“
„Aha“, sagte Jennifer wieder, und diesmal klang es etwas verwirrt. „Bist du mit Indern befreundet? Einfach so, meine ich.“
„Ich kenne den einen oder den anderen privat, ja. Viele zeigen Interesse an Europäern, aber echte Freundschaften werden daraus selten. Sie verachten uns, weil wir dreckiges Schweinefleisch und heiliges Rindfleisch essen. Sie finden es eklig, dass wir uns in ein Taschentuch schnäuzen und es dann wieder in die Hosentasche zurückstecken und mit uns herumtragen. Inder finden es appetitlicher, einfach auf den Boden zu rotzen, wo sie gerade gehen und stehen. Sie nennen uns ‚die roten Affen’, weil unsere Haut in der Sonne rot wird, und rufen uns manchmal auf der Straße Schimpfworte hinterher.“
„Warum?“, fragte Jennifer verblüfft.
„Die Vorurteile gegenüber jedem mit einer weißen Haut stammen noch von der Kolonialherrschaft. Das Schimpfwort ‚roter Affe’ kommt auch daher, dass früher die englischen Kolonialherren oft rothaarig waren.“
„Wie hältst du es schon seit sechs Jahren hier aus, wenn die Einheimischen so wenig gastfreundlich sind?“
„Ich versuche, ihre Denkweise zu verstehen. Es ist mein Beruf, Geheimnissen auf die Spur zu kommen, und Indien ist da eine große Herausforderung. Dafür sind die hier lebenden Europäer untereinander umso freundlicher. Und natürlich gibt es Ausnahmen, ich habe inzwischen auch etliche sehr nette und aufgeschlossene Inder kennengelernt. Zum Beispiel mein Kollege Rajiv, mit dem ich recht gut befreundet bin. Aber der ist pakistanischer Herkunft und nicht Hindu, sondern Moslem. Man kann hier schon gut leben, wenn man flexibel ist. Vieles ist auch lockerer als in Europa und wird nicht so genau genommen.“
Jennifer strahlte. „Oh, das klingt alles so aufregend! Ich war eigentlich ein bisschen sauer, dass Mutter mich ins Exil abgeschoben hat – aber vielleicht war das keine so schlechte Idee!“
„Wir werden sehen“, murmelte Dominique.
„Wann soll ich anfangen zu arbeiten?“
„Übermorgen. Den morgigen Tag lasse ich dir, damit du mit Zeitverschiebung und Klima-Umstellung fertig werden kannst. Bist du müde?“
„Nein, für mich ist es ja erst …“ Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Siebzehn Uhr. Wie spät ist es hier doch gleich?“
„Halb zehn. Höchste Zeit zum Abendessen, was meinst du?“
„Gute Idee. Ich hab einen Bärenhunger.“ Sie hängte sich bei ihm ein. „Dann zeig mir mal, wie du dich als Koch machst.“