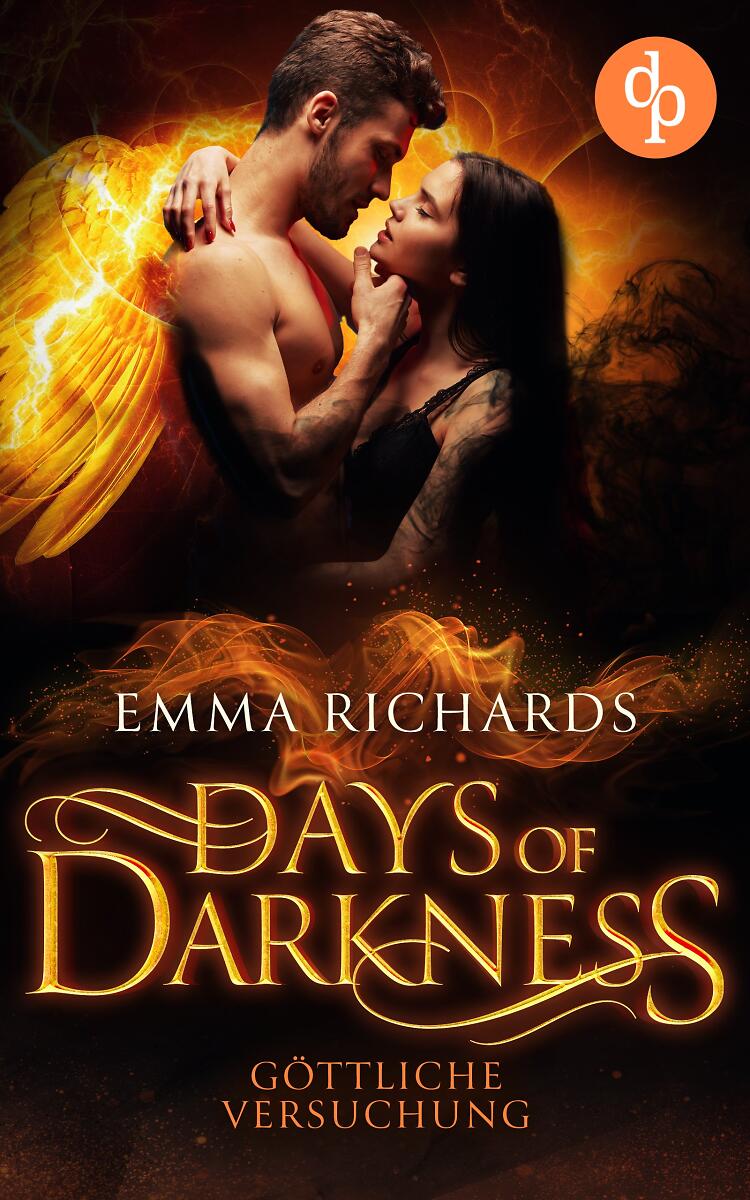1.
Sirenengeheul, wütendes Hupen, quietschende Reifen und pöbelnde Menschen auf ihrem Weg in den heiß ersehnten Feierabend, das war die Hintergrundmusik der Stadt, die niemals schlief. New York.
Der Wind trug den Lärm bis zu mir herauf aufs Dach, während ich gebannt das Geschehen weit unter mir betrachtete.
Mit dem Lärm Hand in Hand stiegen die Düfte der Stadt zu mir herauf. Essen aus den verschiedensten Ländern. Würzig scharfe Gerüche von dem Inder um die Ecke und frittiertes Fett von dem Fast–Food–Restaurant auf der anderen Straßenseite vermischten sich mit den Abgasen der Autos und dem Geruch von Unzufriedenheit und Wut.
Kaum etwas roch stärker. Neid, Abscheu, Zorn, Hass, Feindseligkeit. Sie alle schürten den Wunsch nach Rache. Rache am Chef, weil er einem heute die Kündigung ausgesprochen hatte. Rache am Ehemann, weil er fremdgegangen war. Rache an der Partnerin, weil sie einen für den heißen Typen aus dem Fitnessstudio verlassen hatte.
Jeder Mensch war auf irgendjemanden wütend. Ein Glück für mich, denn damit verdiente ich seit jeher mein Geld.
Mein Name ist Tess Hope und ich bin eine Furie, eine Rachegöttin. Jemand ruft und bezahlt mich dafür, Rache an einer Person zu nehmen. Ob sie nun wirklich die Schuld trägt oder nicht, spielt für die meisten Menschen oder … nun ja, andere Wesen, keine Rolle – und für mich damals auch nicht.
Ich erfüllte jeden Auftrag gewissenhaft und holte mir danach meine Bezahlung ab. Doch mit der Zeit wurden die Wünsche immer grausamer und blutiger. Damals schwelgte ich darin, Rache zu nehmen, und je schrecklicher sie ausfiel, desto glücklicher war die Furie in mir. Doch dann passierte diese eine Sache und alles änderte sich. Ich veränderte mich. Ich war nicht mehr die Furie, die ich früher einmal war, und das machte es erstaunlich schwer, Rache zu nehmen. Viel schwerer, als es einer Furie fallen sollte.
Ich lenkte meine Aufmerksamkeit von den trüben Gedanken zurück auf die wundervolle Stadt New York. Mein Blick streifte über die Dächer, die vielen Lichter, das Leben. Hier oben hatte ich eine tolle Aussicht. Ich befand mich auf dem Dach eines Wolkenkratzers und hielt Ausschau nach … tja, wonach genau konnte ich gar nicht sagen, nach Vergebung, schätze ich.
In einem Alter von etwas über fünfhundert Jahren brauchte anscheinend auch eine Furie mal so etwas wie Vergebung. Also saß ich hier und wartete. Wartete darauf, dass ich mir selbst vergeben konnte für das, was ich getan hatte. Meine Schuld wog schwer, und mit jedem Tag, an dem ich sie mit mir herumtrug, wurde sie schwerer. So langsam wusste ich nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Ich brauchte dringend einen Plan.
Ich lebte jetzt seit etwa einhundert Jahren unter den Menschen, und auch wenn sie es immer wieder schafften, mich zu überraschen, konnte ich doch nicht behaupten, mich hier wirklich wohlzufühlen. New York war klasse, eine der tollsten menschlichen Städte, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, aber dennoch … meine Heimat fehlte mir.
Leider konnte ich es mir nicht länger aussuchen, wo ich mein Leben verbringen wollte. Zumindest nicht in meiner Welt, aus diesem Grund war ich hier. Die Schuld hatte mich hierhergetrieben. Ich konnte nicht zurück. Mir blieb nur die Welt der Menschen. Dabei komme ich aus einer Stadt, die New York sehr ähnlich ist, geradezu zum Verwechseln ähnlich. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich mich für diesen Ort auf der Erde entschieden hatte. Der Big Apple kam meinem Zuhause am nächsten.
Eine kalte Windböe wurde zu mir heraufgetrieben und peitschte mir meine langen Haare aus dem Gesicht. Ich liebte die Nacht. Ich war schon immer lieber auf der Straße, wenn es dunkel wurde und die Sonne sich endlich zurückzog, um an einem anderen Ort zu scheinen. Der Mond und ich, die Finsternis und ich, wir waren enge und alte Freunde.
Einen Blick auf die Uhr werfend, entfuhr mir ein bedauerndes Seufzen. Ich hatte heute Abend noch eine Aufgabe zu erledigen und wenn ich nicht zu spät kommen wollte, musste ich mich langsam auf den Weg machen.
Mit einem resignierten Stöhnen stand ich auf und warf noch einmal einen wehmütigen Blick über die erwachende Stadt. Das war noch ein Grund, warum ich New York so liebte. Genau wie ich erwachte die Stadt erst so richtig zum Leben, wenn die Nacht hereinbrach. Vielleicht nannte man mich deswegen auch Tochter der Nacht. Wie ich schon sagte, die Dunkelheit und ich, wir waren alte Freunde.
Es wurde Zeit.
Mit einem Sprung stand ich auf der Balustrade des Gebäudes und konnte weit unter mir ganz klein die fahrenden Autos erkennen. Mit geschlossenen Augen breitete ich meine Arme aus und mit ihnen meine großen, schwarzen Flügel. Auf den ersten Blick hätte man sie als Engelsflügel bezeichnen können, wären da nicht die schwarzen Federn gewesen, die wie dunkler Satin schimmerten. Sie hatten nichts vor der Reinheit und der Unschuld der Engel und das war auch gut so. Ich war nicht unschuldig und das Wort Reinheit hätte man noch eher mit der abgasgeschwängerten Luft in Verbindung bringen können als mit mir. Meine Flügel waren schwarz. Schwarz wie die Nacht, schwarz wie mein Haar, schwarz wie ein Teil meiner Seele.
Den Kopf gen Himmel streckend und dem Mond ins Antlitz lächelnd, ließ ich mich fallen.
Der Wind rauschte an mir vorüber und all die Sorgen blieben oben auf dem Dach zurück. Von der Geschwindigkeit stiegen mir Tränen in die Augen und ich stieß ein freudiges Lachen aus. Dieser Moment des Fallens, des Fliegens, befreite mich. Mit der Schwerelosigkeit kam die Leichtigkeit, und dieses Gefühl der Freiheit war alles, wonach ich strebte.
Kurz bevor ich auf dem Boden aufkam, schlug ich einmal kräftig mit meinen schwarzen Schwingen und befand mich sofort wieder in der Luft. Die vielen Federn fingen den Wind unter mir auf und trieben mich wieder in die Höhe. Ich konnte jeden Luftzug bis in die kleinste Feder spüren. Es kitzelte leicht und zauberte mir wieder ein Lächeln ins Gesicht.
Es brauchte nur fünf weitere Schwünge mit meinen Flügeln und schon war ich an meinem Ziel angekommen. Der Vorteil, wenn man eine Furie ist: Taxi fahren in einer überfüllten Stadt wie New York war dank meiner Flügel überflüssig.
Etwas unsanft kam ich auf dem weichen Gras des Central Parks auf und zog meine Schwingen wieder ein. Es war inzwischen so spät und dunkel, dass ich sicher sein konnte, von niemandem gesehen worden zu sein, außer vielleicht von ein paar betrunkenen Jugendlichen, die glauben würden, ihre Augen spielten ihnen einen Streich. Meine Flügel waren für Menschen – Normalsterbliche – zwar nicht zu sehen, dennoch warf eine fliegende Frau, die um Mitternacht im Central Park landete, Fragen auf.
Ich atmete einmal tief ein und sah dann nach oben. Das Gebäude direkt vor mir war mein Ziel. Mit schnellen Schritten ging ich darauf zu und versuchte den Vollmond zu ignorieren, der inzwischen fast seinen Zenit erreicht hatte. Ich kam genau rechtzeitig. Wäre ich später losgeflogen, wäre diese Nacht sicher unschön verlaufen.
2.
Im 13. Stock des Wolkenkratzers angekommen, zog ich den Schlüssel aus meiner Tasche und schloss die Tür zu meinem Apartment auf. Hier lebte ich nun schon seit einhundert Jahren – und es gefiel mir. Ich konnte mich wirklich nicht beschweren.
Ich hatte eine fantastische Aussicht, eine wunderschöne, riesige Wohnung, tolles Mobiliar und eine unorthodoxe Mitbewohnerin – um es vorsichtig auszudrücken.
Apropos, ich war noch nicht einmal ganz in der Wohnung, da kam auch schon eine wutentbrannte Blondine auf mich zugestapft und funkelte mich wütend an.
„Jetzt bist du da?! Weißt du, wie spät es ist?“
„Ich bin auf die Minute pünktlich, würde ich sagen.“ Augenrollend schloss ich die Tür hinter mir zu und entledigte mich meiner geliebten Lederjacke. „Ich weiß nicht, warum du so einen Aufstand machst, bisher bin ich immer rechtzeitig da gewesen.“
Anni, meine Freundin und Mitbewohnerin, stemmte aufgebracht die Hände in ihre schmalen Hüften und versuchte mich mit ihren Blicken zu erdolchen. „Du weißt doch, was passiert, wenn Vollmond ist. Ich war kurz davor, auszugehen. Weißt du eigentlich, wie knapp es heute war? Wärst du nicht in diesem Moment zur Tür reingekommen, wäre ich losgegangen.“
Ein Blick auf ihr Äußeres sagte mir, dass sie nicht übertrieb. Ihre langen, blonden Haare waren leicht gelockt, sie hatte ihre Augen dunkel geschminkt und roten Lippenstift aufgelegt. Ihre schmale Figur wurde durch das enganliegende Glitzertop und die Lederröhre noch betont. Mörderisch hohe High Heels ließen sie mit ihren ein Meter achtzig größer erscheinen, als sie sowieso schon war.
Mit ihrer dünnen Figur und ihrem hübschen Gesicht war es kein Wunder, dass sie hauptberuflich als Model arbeitete. Wir hätten gegensätzlicher nicht sein können. Ich war kleiner und hatte auch keine Streichholzbeine. Ich war sportlich schlank und hatte durch das viele Laufen und Krafttraining einen sehnigen, eher muskulösen Körper. Meine Haut war bronzefarben und meine Augen so dunkelbraun, dass sie als schwarz hätten durchgehen können. Die einzige Gemeinsamkeit, die wir hatten, war die Länge unserer Haare, aber damit hatte es sich auch schon.
„Ich bin ja noch rechtzeitig gekommen, oder?!“, versuchte ich Ann zu beruhigen und ging erst einmal in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen.
„Willst du mich verarschen? Ich kann deinen zerzausten Haaren ansehen, dass du dich ganz schön beeilen musstest. Hast du etwa die Zeit vergessen? An einem so wichtigen Tag wie heute?“
Ach ja, eine Kleinigkeit hatte ich vergessen. Meinesgleichen kann – im Gegensatz zu den Menschen – meine Flügel sehen, und wenn ich meinesgleichen sage, meine ich nicht Furie. Anni, oder auch Ann, wie sie eigentlich hieß, war eine Sirene – und das nicht nur äußerlich. Sie stammte von den ersten Sirenen ab. Um genau zu sein von einer der Sirenen, die damals versucht hatte, Odysseus mit ihrem Gesang auf ihre Insel zu locken.
Drei Nächte im Monat, immer um den Vollmond herum, verspürte dieses hübsche Geschöpf den unwiderstehlichen Drang, eine Karaoke–Bar aufzusuchen und ihrer Stimme freien Lauf zu lassen. Das an sich wäre ja auch gar nicht so schlimm, heutzutage gab es keine Männer auf See mehr, die, einmal von ihrem Kurs abgekommen, nicht mehr nach Hause fanden. Allerdings lockte Annis Gesang buchstäblich jeden Mann im Umkreis von hundert Kilometern an. Bei so vielen Männern auf einem Haufen war der Ärger natürlich vorprogrammiert. Meistens endete das Ganze damit, dass sich die Männer gegenseitig k. o. – oder im schlechtesten Fall tot – schlugen, bis nur noch einer übrig war, der dann für jene Nacht seinen Anspruch auf Ann erhob.
Bei solch einer Gelegenheit hatten wir uns damals kennengelernt. Ich war gerade erst seit zehn Jahren in New York, für jemanden wie mich eine kurze Zeitspanne, als ich diese hübsche Blondine singend in einer Bar fand, in der eine Riesenschlägerei ausgebrochen war. Ich rannte in die Bar, um die Frau vor den ganzen Trunkenbolden zu retten, die sich dort gegenseitig Glasflaschen auf die Köpfe schlugen. Bis ich verstand, dass sie der Grund für die steigende Aggression war. Ich musste ihr eines der versifften Geschirrtücher in den Mund stopfen, weil sie einfach nicht aufhören wollte, zu singen. Später hatte ich ihr dann eine saftige Ohrfeige verpasst, die sie zumindest ohnmächtig hatte werden lassen, erst da hörten die Männer auf, sich gegenseitig zu Brei zu schlagen.
Ich nahm Ann mit zu mir und nahm mir vor, sie zu befragen, sobald sie wieder zu sich gekommen war.
Der blonde Engel nahm mir sämtlichen Wind aus den Segeln, als sie sich mit einem herzzerreißenden Schluchzen bei mir für die Hilfe bedankte. Sie habe sich selbst nicht unter Kontrolle und verspüre an drei Tagen im Monat immer diesen Drang, zu singen. Sie brauche jemanden, der ihr dabei helfe, sich unter Kontrolle zu bekommen. Es sollten keine Männer mehr ihretwegen sterben.
Offensichtlich wusste die kleine Sirene nicht, wer oder was sie war, und ihre Kräfte schien sie ebenfalls nicht unter Kontrolle zu haben.
Vielleicht hätte ich ihr damals erzählen müssen, was sie war und woher sie eigentlich kam, wo Wesen wie sie normalerweise lebten, aber um ehrlich zu sein … ich wollte nicht über meine Welt sprechen. Und Ann war, obwohl man es kaum glauben konnte, eine sehr genügsame Sirene, die, was meine Herkunft betraf, keinerlei Neugier hegte.
Als Ann, nachdem ich sie in der Bar k. o. geschlagen hatte, wieder zu sich kam und meine Flügel zum ersten Mal sah, erschreckte sie zwar, hatte sich aber relativ schnell wieder im Griff. Ich hatte keine Ahnung, ob sie mich für eine dunkle Fee hielt, die man zu ihr gesandt hatte, um ihr mit ihrem Problem zu helfen, oder einfach für einen Engel, der sich die Flügel schmutzig gemacht hatte. Sie fragte nie danach – und was sollte ich sagen, seit jener Nacht waren wir Freundinnen und sie zog bei mir ein.
„Es tut mir leid, in Ordnung?! Nächstes Mal bin ich rechtzeitiger hier“, versuchte ich Ann zu beruhigen.
„Wo bist du gewesen, Tess?“ Anni hatte die Arme vor der Brust verschränkt und sah mich mit schiefgelegtem Kopf an.
„Vielleicht sollten wir das morgen klären. Du gehörst in dein Zimmer, komm schon.“ Ich versuchte die schöne Sirene am Arm zu packen und auf ihr Zimmer zu geleiten.
Wir hatten es in einen schalldichten Raum verwandelt, in dem sie so laut singen konnte, wie sie wollte. Niemand würde sie hören. Das Fenster hatte eine Zeitschaltuhr, über die ich an drei Tagen im Monat die Macht hatte. Es würde sich erst wieder öffnen, wenn der Morgen anbrach und Anni nicht mehr das Bedürfnis verspürte, singen zu wollen.
„Nein, wir reden jetzt darüber“, fauchte sie und zeigte drohend mit dem Finger in meine Richtung.
„Ich habe einen weiteren Auftrag in den Wind geschossen, okay?!“
Anns wutverzerrtes Gesicht schlug augenblicklich in Mitleid um. „Das tut mir leid“, flüsterte sie.
„Ja, mir auch“, seufzte ich und griff mir in die Haare. Sich nicht mehr an Unschuldigen zu vergreifen war vielleicht das Richtige, aber auch nicht wirklich gewinnbringend. Dabei war ich nicht stolz auf meine Vergangenheit. Jeder hatte vielleicht schon mal etwas getan, was er bereute, aber ich hatte fast ein Jahrhundert lang gewütet und war die schlimmste aller Kreaturen gewesen. Ich wollte nie wieder so sein.
„Willst du reden?“, fragte mich Ann und berührte sanft meinen Arm. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie auf mich zugekommen war. „Wir könnten uns in irgendeine Bar setzen und es mit viel Alkohol vergessen, wenn du willst“, schlug sie unschuldig vor.
„Netter Versuch, Ann. Aber nicht heute.“ Damit fasste ich sie am Arm und bugsierte sie geradewegs in ihr Zimmer.
Der Vollmond hatte inzwischen seinen Zenit erreicht. Alles, was Ann nun sagen würde, würde allein zu ihrem Vorteil sein, um doch noch die Möglichkeit zu bekommen, vor einem männlichen Publikum zu singen.
Nachdem ich sie in ihr Zimmer gesperrt hatte, verschwand ich in unserem Badezimmer und versuchte, mir die schwere Stimmung abzuwaschen. Doch es half nicht. Egal, wie viel kaltes Wasser ich mir auch ins Gesicht klatschte, meine Gefühle waren immer noch so schwermütig wie zuvor.
Ja, okay, heute Abend gab es kein Geld, aber ansonsten lief mein Geschäft gut. Es gab jede Menge Menschen, die es verdient hatten, dass man sich an ihnen rächte, und das bedeutete für mich jede Menge Arbeit und jede Menge Geld.
Natürlich konnte nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Ich würde beispielsweise einen untreuen Ehemann nicht acht Stunden lang in einem Feuer brutzeln und anschließend sterben lassen, auch wenn die Ehefrau sich dies von Herzen wünschte.
Nein, meine Rache sah anders aus. Ich tauchte mit einem einzigen Blick in ihre Köpfe ein und ließ sie unter Qualen und Schmerzen erkennen, was sie getan hatten. Ich marterte sie so lange, bis sie einsahen, dass sie einen Fehler begangen hatten, und diesen bereuten. Reue war das Einzige, was sie von dieser Folter befreien konnte.
Schmerz entsteht im Kopf, hatte meine Schwester Megaera immer gesagt, lass sie glauben, dass du ihnen gerade ein Messer in die Brust gestochen, sie mit heißen Schürhaken traktiert oder ihnen die Finger abgeschnitten hast.
Meine Schwester Megaera war schon immer die Kreativere von uns dreien gewesen, dennoch hatte sie recht. Der Schmerz entstand im Kopf, und so ließ ich meine Geächteten wissen, was Schmerz eigentlich bedeutete. Erst wenn sie bereuten, hörte ich auf, sie zu peinigen – erst dann waren sie erlöst.
Ich schaute in den Spiegel und blickte in meine dunklen mandelförmigen Augen, die von langen schwarzen Wimpern umrahmt wurden. Wie oft hatten diese Augen schon gepeinigt, Leid zugefügt, gehasst und vernichtet? Wenn ich einen Schuldigen ansah, färbten sich diese Augen komplett schwarz und ein dunkler Schatten legte sich über mein Gesicht. Meine schwarzen Flügel breiteten sich aus und die silbernen Peitschen, die sich um meine Unterarme wanden, wurden lebendig und schlängelten sich wie Schlangen in meiner Hand.
Ich sah wirklich furchteinflößend aus, wenn ich auf einem Rachetrip war, und so sehr ich meine Opfer mit meinem Anblick und all den Schmerzen auch in die Knie zwang, bei mir selbst funktionierte das Ganze nicht.
Ich hatte es tatsächlich schon versucht. Ich hatte versucht, an mir selbst Rache zunehmen. Meine Sünden bestrafen, das, was ich getan hatte, sühnen. Doch ich konnte es nicht. Meine beiden Schwestern hätten mich ausgelacht, mich dafür verachtet.
Eine Furie fühlt sich niemals schuldig!
Das war das oberste Gebot meiner Art. Denn wie sollte man Rache nehmen, wenn man für eine begangene Tat Schuld empfand?
Dennoch konnte ich nichts dagegen tun. Ich fühlte mich schuldig. Und mit jedem weiteren Auftrag wurde es schwerer, die Kontrolle zu behalten. Da ich an mir selbst keine Rache verüben konnte, übertrug ich meine Schuldgefühle auf die Personen, an denen ich Rache übte. Je größer die Schuld, desto schlimmer die Strafe.
Meine Schuld war so groß, dass sie kaum Platz in dieser Welt fand. Furien töteten nur selten ihre Opfer. Meistens sahen diese ihre Schuld rechtzeitig ein und zeigten Reue, doch wenn sich meine Schuld auf meine Opfer übertrug, konnte ich meine Kraft nicht länger kontrollieren.
In den letzten Monaten waren zehn meiner Opfer unter den Qualen, die ich ihnen zugefügt hatte, gestorben, und es wurden mit jedem Auftrag mehr. Bisher waren es nur Vergewaltiger und Mörder gewesen, deswegen hielt sich meine Reue noch in Grenzen. Aber es blieb die Frage, wie weit ich noch gehen wollte.
Bisher hatte ich diese Angst immer verdrängt und sie so gut es ging mit Alkohol heruntergespült oder versucht zu vergessen, indem ich nachts über die Stadt flog. Doch an Abenden wie diesem … da kamen sie an die Oberfläche und ich konnte nichts dagegen tun.
Meinen Anblick im Spiegel nicht länger ertragend, ging ich zurück ins Wohnzimmer, um einen Tee aufzusetzen, als mir ein weißer Zettel ins Auge fiel, der vor unserer Wohnungstür lag.
Ich bückte mich danach und öffnete sofort die Tür, um vielleicht noch einen Blick auf die Person zu erhaschen, die diesen Zettel unter der Tür in unsere Wohnung geschoben haben musste. Doch da war niemand.
„Hm“, machte ich, schloss die Tür und setzte mich auf einen der Barhocker unseres Küchentresens.
Ich faltete den Zettel auseinander und las den einen Satz, der in schwarzer, geschwungener Schrift auf dem weißen Papier prangte. Unheilvoll brannten sich die Worte in meinen Kopf und eine dunkle Vorahnung überkam mich.
Komm aufs Dach!