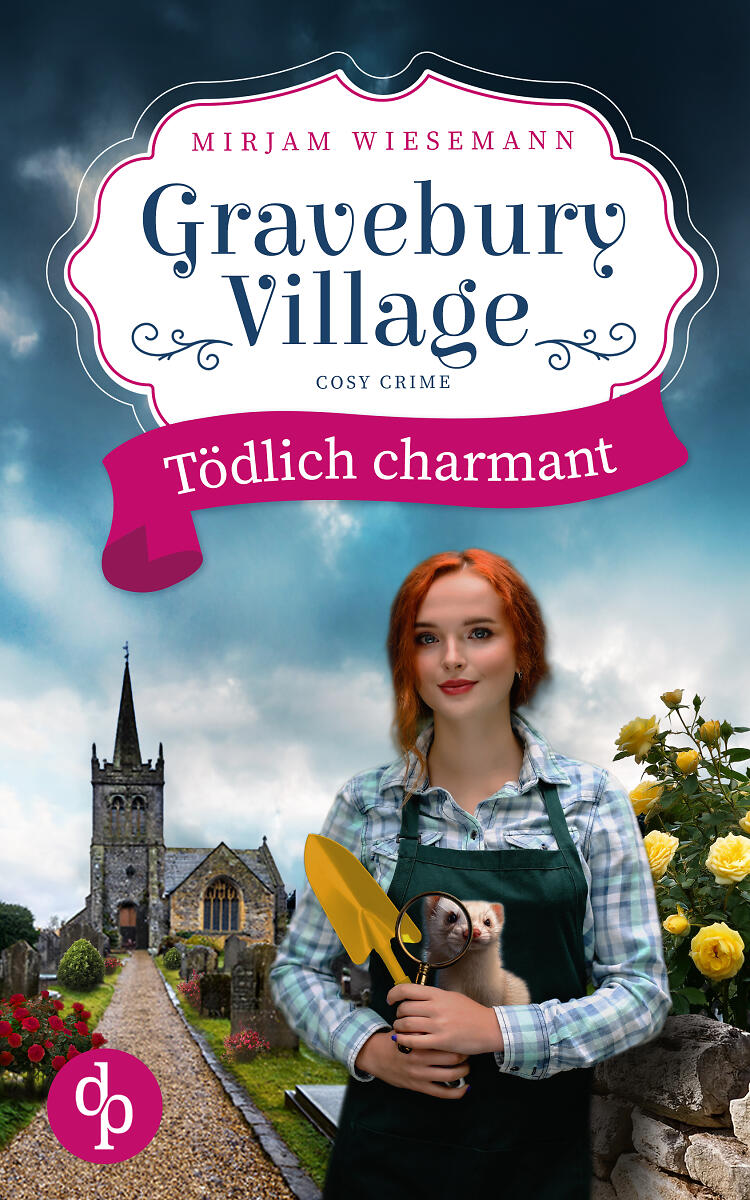Kapitel 1
„Weiße Lilien und rote Rosen, das wird ein besonders schöner Trauerkranz“. Justine lächelte.
Die Kundin konnte sich Tränen der Rührung nicht verkneifen. „Zu Ehren meines verstorbenen Ex-Mannes“, brachte sie hervor. „In ewiger Liebe, Deine Margret und Kinder. Könnten Sie diesen Text bitte auf die Trauerschleife drucken lassen?“
„Ja natürlich. Da wird er sich sicher freuen.“
Solch ein Aufwand für den Ex-Mann, das musste man sich mal vorstellen. „Es sind die gleichen Blumen, die wir vor dreiundfünfzig Jahren für den Hochzeitsstrauß ausgewählt hatten.“
„Seit wann sind Sie denn von Ihrem Verflossenen getrennt?“, erkundigte sich Justine mitfühlend.
„Seit siebenunddreißig Jahren“, antwortete die Lady und konnte einen weiteren Gefühlsausbruch nicht unterdrücken. „Ich kann es nicht fassen. Da wird sein toter Leib bald unter der Erde liegen und verrotten. Eine Schande! Er hatte so einen schönen Körper.“
Justine setzte gerade an, über eine passende Antwort nachzudenken, als das Telefon klingelte. Es war ihre Mutter, die es wieder und wieder versucht hatte. Das war ungewöhnlich, normalerweise rief Grace ihre Tochter nicht im Geschäft an, schon gar nicht mehrmals hintereinander. Justine bat die Trauernde um einen Augenblick Geduld und zog sich ins Hinterzimmer der Friedhofsgärtnerei zurück.
„Mum? Was gibt’s denn, ich bin gerade im Kundengespräch … Was? Nein! Das kann nicht sein. Wo? Nein! Ja … Bis gleich!“
Justine verließ das Hinterzimmer, kehrte zurück in den Verkaufsraum und suchte neben der Kasse nach ihrem Schlüssel.
„Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind ja leichenblass", erkundigte sich die Wartende besorgt. Justine hatte ihre Kundin in der Aufregung ganz vergessen.
„Entschuldigen Sie … nein, vielen Dank. Also …“ Justine versuchte, sich für einen Augenblick zu sammeln. „Ich muss heute leider früher schließen. Ihre Bestellung habe ich aufgenommen. Wenn noch etwas sein sollte, kommen Sie gern morgen wieder vorbei. Sie erreichen mich auch telefonisch. Wenn Sie gestatten …“ Justine komplimentierte die Trauernde höflich, aber bestimmt hinaus. Irritiert über den Stimmungsumschwung redete die Dame noch eine Weile auf Justine ein, die lächelte und nickte, obwohl keines der vielen Worte bis an ihr Ohr drang. Sie war mit ihren Gedanken bei dem Anruf ihrer Mutter und der Hiobsbotschaft, die sie überbracht hatte. Ihr Vater war angeblich von der Natursteintreppe zwischen Siedlung und Friedhof gestürzt! Schädel-Hirn-Trauma! Wie konnte das passieren?
Kapitel 2
Das hübsche Eigenheim in Gravebury Village, in dem Justine gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Grandma Emily seit vielen Jahren wohnte, lag nur wenige Minuten von ihrem Arbeitsplatz entfernt in einer beschaulichen Siedlung gleich auf der anderen Seite des Friedhofs. Außer sich vor Sorge um ihren Dad lief Justine quer über die Grünfläche des Areals, bis sie über ein kleines Holzkreuz stolperte. Das war gestern noch nicht da gewesen. Oder? Wo genau befand sie sich überhaupt? Sie hatte sich verlaufen! Das war ihr noch nie passiert. Sie kannte jeden Quadratmeter ihres Friedhofs und seiner Umgebung in- und auswendig. Nun stand sie zwischen der Familiengruft der Godschlings, dem Doppelgrab ihres Großvaters William und der neu angelegten Urnenwiese. Sie hatte die falsche Abkürzung genommen. Doch wenn sie nun schon einmal dort war, würde sie kurz die Natursteintreppe begutachten. Sie wurde von Kennern der Umgebung und Anwohnern als Schleichweg zur Siedlung benutzt, auch von ihrem Dad. Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg nach Hause spazierte er durch das kleine Waldstück über diese Treppe, die am Rand des Friedhofs entlangführte, unweit von Williams letzter Ruhestätte. Justine betrachtete die flachen Stufen und lief eine nach der anderen ab. Sie waren weder rutschig noch sonderlich verschmutzt. Es lagen auch keine Gegenstände im Weg, über die man hätte stolpern können. Und selbst, wenn es so gewesen wäre, ihr Dad kannte diese Treppe in- und auswendig. Wieso sollte er derart unglücklich ohne jeden Grund gestürzt sein? Es war seltsam. Irgendetwas stimmte nicht. Sie ließ von ihrer Untersuchung ab und eilte nach Hause.
Ihre Mum stand ganz aufgelöst vor der offenen Haustür. Ihr Kleid wehte im Wind und eine Strähne ihres zurückgesteckten, brünetten Haares hatte sich über ihre Lippen gelegt. Sie sah aus wie die Protagonistin eines französischen Liebesfilms. Grace schien Justine sehnlichst erwartet zu haben. Hinter ihr zeigte sich Justines Grandma Emily in ihrer Lieblingsreiterhose, die sie immer noch gerne trug, obwohl sie ihren Reiterhof schon lange verkauft hatte und kaum noch mit Pferden in Berührung kam. „William ist gestürzt“, rief Emily Justine schon von Weitem zu.
„Nein, Peter ist gestürzt!“, entgegnete Grace außer sich. „Peter, mein Mann! Verstehst du, Emily? Dein Mann, der William, ist doch schon lange tot.“
Justine sah ihre Mum vorwurfsvoll an. „Sprich nicht so mit ihr, sie kann doch nichts dafür", verteidigte sie ihre geliebte Grandma, deren fortschreitende Demenz ihr sehr zusetzte.
„Was ist denn nun eigentlich passiert?“
Grace rang nach Worten. „Ich weiß nichts Genaueres. Peter ist von der Treppe neben dem Friedhof gestürzt. Seitdem ist er bewusstlos. Ein Krankenwagen war da. Und ein Polizist, der das Ganze kurz protokolliert hat. Er sagte, es gäbe keinen Grund für weitere Ermittlungen. Es sei bedauerlicherweise offensichtlich ein tragischer Unfall gewesen.“
Emily weinte. Weil es Peter, ihrem Sohn, offensichtlich sehr schlecht ging. Weil Grace sie wieder einmal schmerzlich daran erinnert hatte, dass William, ihr geliebter Mann, tot war. Und weil sie wusste, dass sie sich verändert hatte. Sie war immer noch geistig fit genug, um sich im Klaren darüber zu sein, dass sie Dinge vergaß und durcheinanderbrachte. Das war schlimm für sie. Früher hatte sie alles im Griff gehabt. Das musste man auch, wenn man einen Reiterhof und eine Gaststätte zu leiten hatte. Sie war mit allem klargekommen. Mit wilden Pferden und betrunkenen Kerlen, die sich weigerten, ihren Pub zu verlassen. Die Kerle warf sie raus und die Pferde ritt sie ein. So einfach war das. „Schmeiß den Kerl raus!“, rief sie plötzlich, ganz in ihrer Vergangenheit als Gastwirtin aufgehend. „Wen willst du denn rausschmeißen, Mum? Hier gibt’s keinen Kerl mehr. Peter ist im Krankenhaus! Auf der Intensivstation.“ Grace versuchte, sich zu beherrschen, was ihr in ihrer Verzweiflung mehr schlecht als recht gelang.
„Im Krankenhaus? Das ist schlimm!“ Alle Krankenhausszenen ihrer langen Vergangenheit spielten sich vor Emilys innerem Auge ab und sie war völlig überfordert mit der beklagenswerten Situation. Nicht nur sie, auch Justine.
Mutter Grace fuhr ins Krankenhaus und Justine blieb mit Emily und dem Chaos ihrer Gedanken zurück. Sie schloss die weiße Holztür hinter sich und machte es sich auf dem braunen Chesterfield-Sofa neben einem turmhohen Bücherstapel bequem. Emily gesellte sich zu ihrer Enkelin und zog ein bebildertes, großes Buch aus dem Stapel, der daraufhin krachend in sich zusammenfiel.
„Grandma, pass doch auf!“, rief Justine entnervt.
„Entschuldige, Darling. Siehst du? Mein Buch über Jenseitskontakte. Darin möchte ich gerne lesen.“
„Du hast deine Lesebrille gestern mit dem Hausmüll entsorgt, erinnerst du dich? Wir müssen dir erst eine neue besorgen. Ich werde dir vorlesen.“
Emily interessierte sich für alles Spirituelle, das mit Magie zu tun hatte. In der Hoffnung, ihrem William auf die ein- oder andere Art wieder begegnen und mit ihm sprechen zu können, suchte sie ständig nach Möglichkeiten, mit ihm in Kontakt zu treten. Sie hätte nur zu gerne mit ihm über die schlimmen Neuigkeiten gesprochen. Jenseitskontakte waren das Letzte, wonach ihr zumute war. Sie stapelte die Bücher wieder aufeinander. Dabei fiel ihr ein Wälzer über Krafttiere im Schamanismus in die Hände. Justine schaffte es, Grandma für ein Kapitel über Einhörner zu interessieren. Sie las daraus vor, bis Grandma eingeschlafen war und Grace nach Hause kam.
Kapitel 3
Grace war aschfahl. „Peters Augen waren geöffnet.“
„Wirklich?“ Justine wollte sich schon freuen, sah ihrer Mum aber an, dass es keinerlei Grund dafür zu geben schien.
„Er hat durch mich hindurchgesehen. Wachkoma, sagen die Ärzte. Man muss abwarten.“
„Wieso denn abwarten?“, erwiderte Justine aufgebracht. „Man kann ihm doch bestimmt irgendwie helfen. Ich habe mal ein Buch über jemanden gelesen, der fünfzehn Jahre im Wachkoma gelegen hat. Fünfzehn Jahre! Weißt du, wie alt du in fünfzehn Jahren bist, Mum? Vierundsiebzig! Dad würde dich vielleicht gar nicht mehr wiedererkennen. Jedenfalls kann sich so ein Zustand ewig hinziehen.“
„Glaubst du, wir können etwas daran ändern?“ Grace wirkte erschöpft und niedergeschlagen. Derart still und in sich gekehrt erlebte man sie sonst selten.
„Hast du versucht, Kontakt mit Dad aufzunehmen, Mum?“, hakte Justine nach. „Hat er auf dich reagiert?“
„Ich weiß es nicht …“
Grace schwieg nachdenklich und Justine überschüttete sie mit Fragen. Verkehrte Welt. Normalerweise war Grace diejenige, die sich nach allem und jedem erkundigte und wie ein Wasserfall redete.
Justine brauchte Zeit für sich allein, entschuldigte sich bei ihrer Mutter und zog sich in ihr Zimmer zurück. Warum war ihr Dad gestürzt? Justine konnte nicht glauben, dass er ohne äußeren Anlass das Gleichgewicht verloren hatte. Ihre Gedanken drehten sich im Kreis, bis ihr schwindelig wurde. Wenn das Leben sie an den Rand des Wahnsinns trieb und ihre Gefühle sie zu überrollen drohten, hatte sie mehrere Möglichkeiten, ihr überreiztes Nervensystem zu beruhigen: Das Stricken, ihre Spaziergänge auf dem Friedhof oder ein Gespräch mit ihren Psychotherapeuten Thomas Cosy. Außerdem hatte sie ein Cello von einem entfernten Verwandten geerbt und es auf Anraten Cosys behalten, statt es zu verkaufen. Er meinte, dass Musik, insbesondere das Erlernen eines Instrumentes, der hochsensiblen Justine vielleicht helfen könnte, ihrem intensiven Gefühlsleben einen kreativen Ausdruck zu verleihen. Bislang war es ihr allerdings noch nicht gelungen, dem Cello mehr als ein paar Töne auf den leeren Saiten zu entlocken. Vielleicht würde sie es doch verkaufen und sich mit dem Hören von Musik begnügen.
Kapitel 4
Justine wählte die Nummer ihres Therapeuten, den sie glücklicherweise höchstpersönlich in seiner Praxis erreichte. Natürlich konnte sie nicht wissen, dass auch er sich in einer Ausnahmesituation befand. Er würde über Nacht in seiner Praxis bleiben, denn er war seit zwei Tagen ein Mann ohne festen Wohnsitz. Seine Frau hatte ihn an die Luft gesetzt, samt Albinofrettchen Wotan. Die weiße Fellnase war der endgültige Anlass für den Rauswurf gewesen. Dabei hatte Cosy seiner Tochter lediglich eine Freude zum Geburtstag machen wollen. Er hatte sich ihre leuchtenden Augen vorgestellt. Den Moment, in dem sie das bezaubernde Wesen sehen und ihrem Dad vor Glück in die Arme fallen würde. Mit diesem Geschenk hatte er alles wieder ausbügeln wollen, was er in den vergangenen Jahren vermasselt hatte. Es sollte all die Zeit wieder gutmachen, die er mit langweiligen, depressiven Hausfrauen und überarbeiteten, narzisstischen Managern verbracht hatte, statt sich um seine Familie zu kümmern. Leider war ihm die Überraschung nicht gelungen. Im Gegenteil. Das unerzogene Biest biss seine Tochter derart kräftig in die Nase, dass sie drei Tage lang nicht in die Schule gehen konnte. Außerdem führte es ein ausschweifendes Nachtleben. Nach einer schlaflosen Woche stand Cosys Frau mitten in der Nacht mit dem quiekenden Wollknäuel unter dem Arm vor seinem Bett und forderte ihn auf, das Haus mitsamt Frettchen auf der Stelle und für immer zu verlassen. Seitdem hatte Cosy sein Nachtlager vorübergehend in der Praxis aufgeschlagen und nicht länger als drei Stunden am Stück mehr durchschlafen können. Er hatte versucht, den Störenfried an seinen Besitzer zurückzugeben. Ohne Erfolg. Der war offensichtlich froh, das Tier losgeworden zu sein. Auch die Zoohandlungen lehnten Wotan ab.
So blieb der Therapeut auf der kleinen Nervensäge sitzen.
Er war geradezu glücklich, als seine Patientin Justine um einen Nottermin bat. Sie war eine willkommene Ablenkung von seiner eigenen Misere. Seine Lieblingspatientin. Eine seltsame, aber gerade deshalb interessante, hochsensible junge Frau. Thomas Cosy bestärkte sie in ihrem Anderssein. Ermutigte sie, zu ihren Eigenarten, ihren Neigungen und ungewöhnlichen Interessen zu stehen und sich nicht verbiegen zu lassen. Wenn er ehrlich war, sprach er auch für sich selbst. Er war kein einfacher Mensch. Ein Wunder, dass seine Frau ihn überhaupt so viele Jahre ertragen hatte. Nun ja, sie war ein harter Knochen und er das Weichei. Vielleicht war er der menschliche Anteil in ihrer Ehe, der ihr fehlte. Gefehlt hatte.
Der Therapeut machte sich ernsthafte Sorgen um Justine Blackwood. Derart aufgelöst wie in jenem Telefonat hatte er sie noch nie erlebt. Immerhin hatte sie ihn aufgrund eines tief liegenden Traumas aufgesucht, das sie bis heute belastete, und man konnte nie wissen, ob und wann es durch gewisse Umstände zu einer Retraumatisierung kommen konnte. Er gab ihr gleich den ersten Termin am kommenden Morgen und musste zugeben, dass er sich darauf freute, sie zu sehen. Wie immer.
Sie war eine größtenteils schwarz gekleidete, blasse, junge Frau mit großen, grauen Augen und kurzer Bob-Frisur. Alle paar Wochen experimentierte sie mit neuen Haarfärbemitteln. Sie wirkte sehr verletzlich und scheu, obwohl sie durchaus in der Lage war, ihre Meinung zu sagen und einen rauen Ton an den Tag zu legen.
Als sie Thomas Cosy an jenem Morgen gegenübersaß, bot er ihr erst einmal eine Tasse Tee an, was er sonst nie tat.
„Sie sind ja ganz aufgelöst. Was ist denn passiert?“, fragte er behutsam. Justine erzählte vom Sturz ihres Vaters und schilderte seinen besorgniserregenden Zustand.
„Meine Mutter sagte, dass er die Augen geöffnet hatte. Er hat an die Decke gestarrt und nicht auf ihre Anwesenheit reagiert.“
„Das ist schlimm. Was sagen denn die Ärzte?“
„Schädel-Hirn-Trauma. Wachkoma. Ich habe ihn noch nicht besucht. Das werde ich bald nachholen.“ Justine schaute ihren Therapeuten nachdenklich an. „Meiner Meinung nach stimmt da etwas nicht. Er ist zum tausendsten Mal über diese Treppe gelaufen. Die würde er auch im Halbschlaf und bei Nacht ohne Probleme bewältigen können. Da stürzt man nicht einfach so.“
„Also, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Aus den banalsten Gründen.“
„Die Treppe ist aber nicht in unserem Haushalt. Wenn meine Mutter sich die Finger in der Waschmaschine eingeklemmt oder sich am Wasserkocher verbrannt hätte oder wenn meiner Grandma ein unbekanntes Flugobjekt auf den Kopf gefallen wäre, hätte ich mich nicht gewundert, bestimmt nicht. Aber mein Vater? Er ist ein genauer, umsichtiger Mensch. Und kerngesund. Der Blutdruck war immer in Ordnung, Alkohol hat er nur Weihnachten und Silvester getrunken. Und er arbeitet beim Gesundheitsamt. So jemand stürzt nicht einfach so von der Treppe!“
„Was sagt denn die Polizei dazu? Die hat das Ganze doch sicher protokolliert, oder?“, forschte Thomas Cosy weiter nach.
„Die hat den Fall schnell ad acta gelegt und meiner Mutter klargemacht, dass wir uns mit der Tatsache abfinden sollen, dass so etwas geschehen könne, so schrecklich dies auch sei. Der Beamte schien froh gewesen zu sein, weiteren Fragen entkommen zu können.“ Justine hielt kurz inne, dachte nach und fuhr dann entschlossen fort: „Ich weiß, es klingt vielleicht nach einem Hirngespinst, aber ich bin mir absolut sicher, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn mir niemand dabei helfen will, werde ich eben allein nachforschen müssen.“
„Und wie stellen Sie sich das vor?“, fragte Thomas Cosy.
Obwohl seine Patientin sehr bemüht war, einen gefassten Eindruck zu machen, war dem Therapeuten klar, dass sie unter Schock stand.
„Sie wissen ja, dass ich es nicht ausstehen kann, mich mit den Nachbarn und ihrem Small Talk zu beschäftigen, aber ich denke, ich werde mich mal umhören müssen. Vielleicht hat der eine oder andere etwas mitbekommen. Es ist ja bekannt, dass die Menschen ihre Augen und Ohren überall haben, wenn es darum geht, sich über den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen“, bemerkte Justine. Sie hielt nicht viel von den Menschen, das wusste Thomas Cosy nur zu gut.
Er bemühte sich, ihr seine volle Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl er äußerst erschöpft war.
Seit der Trennung von seiner Frau war er nicht zur Ruhe gekommen, weder innerlich noch äußerlich. Durch seine Grübeleien und Wotans nächtliche Aktivitäten litt er unter massivem Schlafmangel.
Justine erschrak fürchterlich, als aus der hintersten Ecke des Raumes plötzlich ein zartes Niesgeräusch erklang.
„Was ist das?“, erkundigte sie sich beunruhigt.
„Das ist Wotan, mein Albinofrettchen. Ignorieren Sie ihn einfach.“ Justines Schreck wich der Neugier. Wotans Niesen ging in ein Husten über.
„Ein Albinofrettchen?! Wie interessant. Es scheint erkältet zu sein", bemerkte sie.
„Nein, ich denke, es handelt sich eher um eine Hausstauballergie. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn.“
„Ich würde ihn gern sehen!“
„Ich denke, wir sollten die Stunde besser nutzen, um uns mit Ihnen zu beschäftigen. Ich kann Wotan auch in den Nebenraum bringen, wenn er Sie stört.“
„Natürlich stört er mich nicht. Ich würde ihn wirklich gern mal sehen.“
Gut. Das wars. Cosy hatte zurzeit ein hauchdünnes Nervenkostüm, wodurch er zu Ungeduld und Reizbarkeit neigte. Er riss sich jedoch zusammen und bot Justine an, ihm in eine dunkle Nische zu folgen. Ein großer Käfig wurde hinter dem halb zugezogenen Vorhang am Fenster sichtbar.
Zwei feuerrote Augen starrten Justine durch die Gitterstäbe an. Sie gehörten zu einem weißen Fellwesen von der Größe eines Eichhörnchens, das in einer winzigen Hängematte lag. Justine konnte ihren Blick nicht von ihm abwenden. „Was für ein niedliches Wesen.“
„Das täuscht, glauben Sie mir.“
„Darf ich ihn anfassen?“
„Besser nicht. Wotan beißt.“ Der Therapeut hielt ihr seine Hand entgegen. Die kleinen Bisswunden waren deutlich erkennbar.
„Und ich kann ihn nicht allein lassen. Er braucht Gesellschaft, aber mit seinen Artgenossen kommt er nicht klar. Ganz untypisch. Frettchen sind normalerweise sehr soziale Tiere.“
„Offensichtlich kommt er auch mit Ihnen nicht klar.“
Der Therapeut lachte ein wenig gequält. „Sie haben recht, er kann mich nicht leiden. Aber das sollte nicht Ihr Problem sein. Setzen wir uns wieder.“
Als Justine sich vom Anblick des Albinofrettchens losreißen wollte, stellte es sich auf die Hinterbeine und gab ein hektisches Quieken von sich. „Ich glaube, Wotan will mich aufhalten!“, bemerkte sie erfreut.
„Ja, da werden Sie recht haben, Miss Blackwood. Er ist sehr ungestüm und spielfreudig. Ich habe zugegebenermaßen ein kleines Problem mit seiner einnehmenden Art. Bis zu ihrer nächsten Stunde werde ich ihn sicher irgendwo anders unterbringen können. Aber zurück zu Ihnen. Sie sind ja hier, um sich von mir helfen zu lassen und nicht umgekehrt. Ich würde vorschlagen …“
Das Frettchen wollte nicht schweigen. Nun war das Quieken in ein sirenenhaftes Flöten übergegangen.
„Das macht er sonst nie! Entschuldigen Sie, Miss Blackwood.“
„Ich glaube, er versucht, mich anzulocken. Darf ich ihn anfassen?“
Justine machte sich am Gitter zu schaffen.
„Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er beißt", mahnte ihr Therapeut.
„Mich beißt er nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Er flirtet mit mir, hören Sie das?“ Justine flötete sanft zurück, woraufhin Wotan mit dem Schwanz wedelte und erneut quiekte. Der Therapeut beobachtete die Annäherung der beiden mit leichtem Unbehagen. Was wäre, wenn Wotan Justine beißen würde? War ein solcher Fall versicherungstechnisch überhaupt abgedeckt? Er könnte in Teufels Küche kommen.
Die junge Frau kniete vor dem Käfig und betrachtete fasziniert das umtriebige Tierchen, das vor ihren Augen und vielleicht sogar zu ihren Ehren eine Art Begrüßungstanz vollführte.
„Frettchen sind keine Kuscheltiere, Miss Blackwood. Ich denke, Sie wären enttäuscht über seinen Charakter, wenn Sie Wotan näher kennenlernen würden.“
„Ich glaube, er freut sich, mich kennenzulernen.“
„Ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren.“
„Warum nicht? Sie als Psychologe müssten sich doch für Interpretationen interessieren. Oder verlassen Sie sich ausschließlich auf das, was die Patienten Ihnen erzählen?“
„Natürlich nicht, Miss Blackwood.“
Cosy verkniff es sich, zu bemerken, dass er schlicht und ergreifend keinerlei Interesse an der Kommunikation mit Frettchen hatte.
Statt sich weiter aufzuregen, fasste er einen Entschluss. Er kramte aus der Schublade seines Schreibtisches ein Frettchengeschirr mit rosa Plüsch und Glitzersternchen hervor und holte eine schmale, geflochtene Lederleine aus seiner Tasche.
Justine betrachtete die kitschigen Accessoires interessiert. „Haben Sie das ausgesucht?“, fragte sie fassungslos und konnte sich ein verschmitztes Grinsen nicht verkneifen.
„Nein, natürlich nicht“, erwiderte ihr Therapeut, ohne sich zu näheren Erklärungen hinreißen zu lassen.
„Ich leine ihn an. Dann können Sie meinetwegen außerhalb des Käfigs Bekanntschaft mit ihm machen, wenn es Ihnen guttut. Aber passen Sie auf.“
„Wieso wollen Sie ihn anleinen? Er kann doch nicht weglaufen, wenn die Tür geschlossen ist. Ich würde übrigens nicht aufhören können, zu niesen, wenn man mir ein solches Puschelgedöns um den Hals legen würde.“
Thomas Cosy warf Geschirr und Leine zurück in die Schublade. Hätte er in diesem Augenblick seinen Mund geöffnet, wäre nichts Nettes dabei herausgekommen. Wieso waren ihm genau die weiblichen Exemplare so besonders sympathisch, die ihn mit ihrem bockigen Dickschädel und ihrem widerspenstigen Querulantentum in den Wahnsinn trieben?
Mister Cosy war nervös, Wotan hingegen schien freudig erregt. Das wendige Frettchen verließ voller Entdeckerfreude sein Gehege und erkundete in rasendem Tempo sein Umfeld. Offensichtlich hatte es Auslauf bitter nötig und drehte erst einmal einige Runden durch den Raum, über den Schreibtisch, die Stühle, den Schoß und die Schultern von Justine und an der Fensterbank entlang, wobei es einen sehnsüchtigen Blick nach draußen warf. Justine war begeistert. Was für ein lebhaftes, aufmerksames, verspieltes Wesen! Plötzlich hielt Wotan inne, begutachtete Justine und gab ein stinkendes, leicht moschusartiges Sekret von sich. Justine war entzückt. „Er mag mich!“. Sie interpretierte seine ausgeprägte Reaktion interessanterweise als Zeichen der Zuneigung. Ihr Therapeut war mehr als erstaunt über das, was da vor sich ging. Wotan! Der Kriegsgott. Seine Frau hatte dem frechen Tier diesen Namen gegeben. Und es schien, als hätte sie vorausgeahnt, dass er der endgültige Anlass für ihr Zerwürfnis werden würde. Thomas Cosy wäre gern ein selbstsicherer, kerniger Mann gewesen wie sein Bruder. Der war bei der Army. Cosy hingegen war ein an sich selbst zweifelndes Weichei mit einer manchmal an Hysterie grenzenden Nervenschwäche. Verdammt unsexy und unmännlich. Auch all seine guten Eigenschaften waren eher weiblicher Natur. Sein Einfühlungsvermögen, die Emotionalität, seine Nachgiebigkeit. Deshalb war er auch Psychologe geworden und nicht Profiler. Fallanalytiker. Schlüsse auf Basis kriminalistischer und psychologischer Erkenntnisse ziehen. Das Zusammenspiel von sozio-ökonomischen Umständen, Indizien, DNA-Analysen, der Kriminalistik … ein so komplexes Aufgabengebiet hätte ihn ungemein gereizt. Stattdessen … nun ja, die Menschen und ihre Problemchen waren weit weniger interessant, als sie selbst im Allgemeinen annahmen. Und sehr viel weniger originell. Wenn er ehrlich war, musste er zugeben, dass er nach all den Jahren langsam anfing, sich in seinem Beruf zu langweilen.
Dabei war Cosy ein sehr guter Psychologe. Das lag nicht nur an seiner Empathie, sondern auch an seinen unkonventionellen Behandlungsmethoden. Er hatte sogar ein Buch geschrieben: Das Überraschungsmoment als therapeutisches Mittel. Ihm wurde bewusst, dass er soeben mit seinen eigenen Methoden schachmatt gesetzt worden war. Kein Wunder, dass seine Frau ihn knallhart abserviert hatte. Sie war das als Frau, was er nach seines Vaters Meinung als Mann hätte sein sollen: streitbar und streng. Harte Schale, harter Kern.
Wotan vollzog einen gewagten Sprung in Thomas Cosys Schoß. Der sprang auf wie von der Tarantel gestochen, und verließ den Raum. Im Affekt. Er brauchte einen Moment der Ruhe, um sich zu sammeln. Eine ganz und gar aus dem Ruder gelaufene Stunde. Er musste Haltung bewahren und sich wieder in den Griff bekommen. Nach mehrmaligem intensivem Durchatmen und Rückwärtszählen von zehn bis null öffnete er die Tür zum Behandlungszimmer, fest entschlossen, Wotan wieder hinter Gitter zu bringen und die Stunde mit Justine würdevoll zu beenden.
Der Anblick, der sich ihm bot, war unerwartet: Ms. Blackwood saß entspannt auf ihrem Stuhl, während Wotan auf ihrem Schoß lag und sich genüsslich von ihr kraulen ließ. Cosy musste zugeben, dass die beiden einen sehr erfreulichen Anblick boten, die in schwarz gekleidete junge Frau und das weiße, flauschige Frettchen. Einige Sekunden konnte er seinen Blick nicht von den beiden abwenden. Doch Justine riss ihn aus seiner Versenkung.
„Sie sagen, Wotan ist nachtaktiv?“
„Ja, allerdings.“
„Das bin ich auch. Wenn Sie möchten, kann ich ihn probehalber zu mir nehmen.“
„Ich glaube nicht, dass Ihre Mutter besonders erfreut über den neuen Mitbewohner sein würde.“
„Wieso? Sie kennt doch ihr Buch. Das mit dem Überraschungsmoment als therapeutisches Mittel. So sehr dürften Ihre ungewöhnlichen Behandlungsmethoden sie also nicht verblüffen, oder? “
Cosy hielt einen Moment lang inne. Ihm gefiel sowohl die Idee, den kleinen Racker für eine Weile nicht bespaßen zu müssen, als auch der Gedanke, seiner Lieblingspatientin eine persönliche Freude machen zu können, die gleichzeitig aus therapeutischer Sicht Sinn ergab.
„Sie haben recht, Ms. Blackwood. Gerade in Ihrer besonderen Situation kann ein Haustier Wunder wirken. Und zum Seelenheil beitragen. Ich befürworte tiergestützte Therapieformen ausdrücklich. Und sie beide scheinen sich ja wunderbar zu verstehen.“
„Das freut mich sehr, Mister Cosy!“ Justine hätte ihren Therapeuten am liebsten umarmt, doch sie hielt sich zurück.
„Fürs Erste sollten wir das Ganze als Experiment betrachten. Sie können Wotan natürlich jederzeit zurückgeben, wenn er Ihnen Probleme bereitet.“
Justine grinste. „Ich hoffe, Sie werden ihn nicht allzu sehr vermissen.“
„Ich werde damit zurechtkommen“, bemerkte Cosy und gab sich so nüchtern wie möglich.
„Den Käfig werde ich so bald wie möglich liefern, den werden Sie ja brauchen. In der Zwischenzeit können Sie ihn in dieser Transportbox unterbringen.“ Er holte eine graue Plastikbox mit Gittern unter seinem Schreibtisch hervor, reichte sie Justine und schaute diskret auf die Uhr, mit einem kurzen Blick, den Justine sofort bemerkte.
„Vielen Dank, Mister Cosy.“
Justine stand auf und griff nach ihrer Jacke. Sie wollte so schnell wie möglich mit Wotan im Gepäck das Weite suchen, bevor es sich ihr Therapeut anders überlegte.
Als die Tür hinter Justine ins Schloss fiel, fühlte sich Thomas Cosy sehr allein. Er legte sich an jenem Abend früh in sein provisorisches Reisebett. Es war nicht gerade bequem, aber nachdem er sich eine Weile hin und her gewälzt hatte, schlief er endlich ein. Doch selbst im Schlaf fand er keine Ruhe. Ein unangenehmer Traum suchte ihn heim:
Thomas befand sich am Rande einer endlos langen Straße, die aussah wie die berühmte Route 66, umgeben von weiter Steppe und farbenfrohen Bergen und Felsen. Seine Ex-Frau fuhr in einem knallroten Porsche Cabriolet auf ihn zu. Er, Thomas, stand halbverdurstet und sonnenverbrannt am Wegesrand und versuchte sich als Anhalter. Mit letzter Kraft hatte er seinen Arm ausgestreckt und mit dem Daumen in ihre Fahrtrichtung gewiesen. Sie war in schnittigem Tempo an ihm vorbeigefahren, bremste jedoch, als sie ihn bemerkte, und fuhr ihm rückwärts entgegen. Er war sich nicht sicher, ob sie vorhatte, ihn zu retten oder zu überfahren, hatte aber aufgrund seiner Erschöpfung keine Chance, ihr auszuweichen. Seine Reaktionsgeschwindigkeit war die eines hochbetagten Dreifinger-Faultiers. Glücklicherweise hielt der Wagen neben ihm. Als er aufschaute, saß plötzlich Justine am Steuer, lächelte ihm zu und öffnete einladend die Beifahrertür. Thomas war froh, sie zu sehen und hievte seinen schlappen Körper erleichtert auf den Beifahrersitz. Da sprang Wotan plötzlich aus dem Hinterhalt direkt in seinen Nacken und biss sich an seinem Hals fest. Fast ohnmächtig vor Schreck stürzte Thomas aus dem Wagen und versuchte, den wilden Nager loszuwerden. Ohne Erfolg.
Um sich schlagend und schweißnass wachte Thomas auf und griff in seinen Nacken, um nachzufühlen, ob Wotan ihn noch umklammerte, was glücklicherweise nicht der Fall war. Langsam kam er zu sich, fand sich in der fahlen Gegenwart wieder.
Zum wievielten Mal hatte er diesen Traum so oder ganz ähnlich geträumt? Diesmal hatte Wotan ihn rücklings überfallen. Beim letzten Mal war es seine kleine Tochter gewesen, die vom Rücksitz aus mit den Holzschienen ihrer Lieblingseisenbahn auf ihn eingedroschen hatte, und die waren ganz schön hart.
Zum ersten Mal hatte Justine Blackwood am Steuer des Wagens gesessen. Ihre Geschichte schien ihm nahegegangen zu sein.
Thomas wusste nicht, wie er mit diesen Träumen umgehen sollte. Und mit den Szenen seiner Ehe, die ihn Tag und Nacht verfolgten, wie Werbe-Pop-Ups beim Online-Surfen. Plötzlich ploppten sie auf, begleiteten ihn in seinen kurzen Nächten und auf seinen Wegen durch das tägliche Einerlei, das ihm von Tag zu Tag uninteressanter wurde. Ein leichter Nebel hatte sich über alles gelegt, der nur verschwand, wenn plötzlich wieder diese Spots auftauchten, die sich ihm farbig und lebensecht vor seinem inneren Auge präsentierten. Ostern, mit der Familie am großen Esstisch, Weihnachten. Jahr für Jahr, alle Jahre wieder. Im Nachhinein sah alles anders aus. Er befürchtete, dass er nicht in der Lage sein würde, sie loszuwerden, diese Ehe-Pop-Ups. Zwölfeinhalb gemeinsame Jahre waren nicht so einfach wegzudenken, leider, so sehr er sich auch darum bemühte. Wie wenig ihm da sein Beruf half, war erschreckend. In eigenen Angelegenheiten war er ein absoluter Versager. Er kam sich neuerdings vor wie ein mieser Hochstapler, wenn er seinen Patienten etwas von Trennung verarbeiten, mit Schmerz umgehen und Gefühlen sortieren erzählte. Bei ihm selbst wollte es nicht funktionieren. Und es hörte einfach nicht auf. Es war präsenter als die Gegenwart, sein öder Praxisalltag und die vorhersehbaren menschlichen Begegnungen. So würde er sich seiner Umgebung nicht mehr lange zumuten können. Er stand eindeutig am Rande einer Depression. Dabei war er in den ersten Tagen nach der Trennung voller Elan gewesen. Er hatte an heiße Affären und Abenteuertrips nach Indien gedacht. Eben an eine filmreife Verarbeitung der Trennung, wie in eat, pray, love mit Julia Roberts. Aber er war nun einmal keine Filmfigur. Eher eine männliche Florence Nightingale. Seine selbstlose Gutmütigkeit grenzte, wenn er ganz ehrlich war, in manchen Fällen schon an Dummheit. Und das bei einem IQ von über hundertvierzig. Eine Schande. Sein weiches Wesen manifestierte sich inzwischen in einem immer verweichlichteren Körper. Hätte es einen Menschen gegeben, der sich in seinen Armen hätte ausruhen wollen – ein solcher war weit und breit nicht in Sicht, – hätte dieser sich höchstwahrscheinlich an ein Wasserbett erinnert gefühlt. Das Straffe an ihm war fort. Auch in seinem Alltag. Alles waberte dahin. Wer war er, was war von ihm geblieben in diesem Stadium seines nicht mehr ganz jungen und noch nicht alten Lebens?
Er war ein etwas überempfindlicher Psychotherapeut mit einem Hang zu Antriebslosigkeit und Grübelei. Das Leben zu Hause fehlte ihm. Obwohl er nicht einmal wusste, ob er seine Ex-Frau noch liebte oder jemals auf eine romantische Art und Weise geliebt hatte. Sie hatte ihn nicht gut behandelt und er war nicht glücklich gewesen. Aber vielleicht war er ja auch ein Mensch, der das Glück nicht brauchte. Glück wurde seiner Meinung nach überbewertet. Ja, es war beinahe zum Zwang geworden. Er beschloss, sich diesem Joch des Glücklichseinmüssens nicht zu unterwerfen. Er war Melancholiker. Vielleicht sogar ein masochistischer Melancholiker. Die Sticheleien und boshaften Kommentare seiner Ex-Frau, ihre schneidende Stimme und ihr Aktionismus, ihr immer wieder belebender Tritt in den Allerwertesten, durch den er sich aufraffen konnte, sein tägliches Leben in Angriff zu nehmen. Nun war die Luft raus. Geblieben war ein schlaffer Sack voller Selbstmitleid. Wenn er es recht überlegte, hatte es seit der Trennung nur wenige Momente gegeben, in denen er sich so richtig lebendig gefühlt hatte. Zugegebenermaßen gehörten die Begegnungen mit Justine Blackwood dazu.
Kapitel 5
Justine lief mit Wotan, der in Begleitung seines neuen Frauchens noch ein wenig aufgeregt zu sein schien, die Natursteintreppe hinter dem Haus treppauf, treppab.
Ganz korrekt war es wohl nicht, dass Justine sich nun um das Haustier ihres Therapeuten kümmern würde. Aber gerade diesen Sonderstatus, dass er ihr Wotan anvertraut hatte, betrachtete sie als eine besondere Ehre. Sie wusste, dass er seine professionellen Grenzen zu wahren versuchte. Aber allein dadurch, dass er Wotan in seinem Patientenzimmer einen Unterschlupf geschaffen hatte, waren diese deutlich überschritten. Und alle weiteren Grenzen sprengte Wotan mit Leichtigkeit. Justine hatte ja bereits erlebt, wie er in der Praxis sein Unwesen getrieben hatte. Aber einem Tier konnte man keinen Vorwurf daraus machen.
Sie lief noch einmal, nach Auffälligkeiten suchend, mit Wotan treppauf und treppab. Sie konnte nicht anders, und er genoss den Auslauf ganz offensichtlich.
Es musste eine Erklärung für den Sturz ihres Vaters geben. Justine spürte die Unregelmäßigkeiten der Stufen, schaute rechts und links in die Büsche und auf die angrenzende Wiese. Doch es war nichts zu sehen, was zu einer Lösung hätte beitragen können. Das aufgeweckte Tier schnüffelte interessiert an jeder einzelnen Stufe. Justine beobachtete ihn angespannt. Rührte seine Aufgeregtheit vielleicht auch daher, dass er Ungewöhnliches witterte? Sein Verhalten bestätigte ihr Gefühl, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Was konnte sie unternehmen, um sich Klarheit zu verschaffen? Sie kümmerte sich normalerweise weniger um die Bewohner von Gravebury Village und ihrer kleinen Siedlung als um die Toten auf ihrem Friedhof, aber es war ihr nicht entgangen, dass es in der Nachbarschaft einige seltsame Gestalten gab. Mehrmals war sie schon unfreiwillige Zeugin heftiger Streitgespräche geworden. Deshalb hatte sie es auch bislang vorgezogen, sich aus den Querelen herauszuhalten und sich lieber mit der Verschönerung der Gräber zu beschäftigen. Hier war man sicher vor unliebsamen Begegnungen. Oder nicht? Wem könnte ihr Vater begegnet sein? Wotan quiekte laut, als wolle er sich über ihre Unaufmerksamkeit beschweren. Ob er etwas Interessantes entdeckt hatte? Sie kniete nieder, um die Stufen auf Augenhöhe mit Wotan genauer betrachten zu können und suchte jeden Millimeter akribisch ab, den er begutachtete. Außer Unkraut, das aus den Ritzen drang und ein paar trockenen Krümeln von Essensresten, die Wotan auf der Stelle verschlang, konnte sie nichts Auffälliges entdecken.
Oben am Ende der Treppe angelangt, zerrte er an der Leine Richtung Friedhof statt zur Siedlung. Justine gab nach, er war wirklich ein sehr willensstarkes Tier und wusste genau, was er wollte. Da sie ihm sowieso den Friedhof hatte zeigen wollen und es nicht eilig hatte, nach Hause zu kommen, führte sie ihn gern dorthin. Er fühlte sich offensichtlich pudelwohl zwischen den Grabsteinen und Blumenbeeten. Ja, er war vor Begeisterung ganz außer sich. Wunderbar, dachte Justine, nun hatte sie einen Begleiter gefunden für ihre nächtlichen Exkursionen, die sie regelmäßig unternahm, um Grandma Emily vom Grab ihres verstorbenen William abzuholen. Dieses pflegte die alte Dame, egal zu welchen Uhrzeiten, aufzusuchen, um in seiner Nähe zu sein. Sie vermisste ihn sehr. Manchmal vertrat Justine sich auch in ihren eigenen schlaflosen Nächten die Beine zwischen den Gräbern. Schließlich war der Friedhof neben der Siedlung ihr vertrautestes Terrain. Sie konnte nur schwer nachvollziehen, warum Friedhöfe bei so vielen Menschen Unbehagen auslösten. Der Tod war etwas völlig Natürliches und lebendige Menschen waren sehr viel wahrscheinlicher in der Lage, einem Leid zuzufügen als Verstorbene. Vielleicht hatte diese Beklemmung mit den vielen furchterregenden Filmen zu tun, in denen der Friedhof als Schauplatz des Schreckens herhalten musste. Vielleicht auch mit der Angst vor den Geistern der Toten. Justine jedenfalls empfand dort eher ein Gefühl des Friedens und der Ruhe. Meistens jedenfalls.
Plötzlich blieb Wotan wie versteinert vor einem der Gräber stehen, dem monströsen Familiengrab der Godschlings. Er schnüffelte, kratzte und grub. Justine musste ihm Einhalt gebieten. Ausgerechnet die Stelle, an der Benjamin Godschlings Mutter lag, hatte er auserkoren. Das emsige Frettchen sollte sie besser nicht ausbuddeln. Benjamin hatte lange genug gebraucht, um den Tod seiner Mutter zu verkraften. Viel länger als sein Vater, der Jäger Godschling. Die beiden wohnten gleich gegenüber vom Haus der Blackwoods. Ein seltsames Gespann.
Genauso seltsam nahm sich das Monstrum von Familiengrab aus, das alles andere als schön war. Ehrlich gesagt, es war absolut stillos. Aber pflegeleicht, immerhin. Ein wuchtiger Grabstein aus schwarzem Granit, der gute Chancen hatte, allen Arten von Naturkatastrophen standzuhalten, bildete das Zentrum. Granit entstand aus Magma, so viel wusste Justine. Kein Wunder, dass dieses Material jedem Härtetest gewachsen war. Das eher an ein Mahnmal, als an ein Denkmal erinnernde Monument war umgeben von einem graugesprenkelten Mäuerchen, das nicht einmal bis zu den Knien reichte. Als würde diese architektonische Untat einen Schutz gegen menschliche und tierische Besucher und potenzielle Grenzüberschreiter darstellen. Die große Fläche, unter der die Angehörigen des Jägers ruhten, war überwuchert von Bodendeckern aller Art, die pflegeleichteste Grabbepflanzung, die man sich vorstellen konnte, ideal für Menschen, die maximales Prestige mit minimalem Aufwand zu verbinden wünschten.
Zum Glück zog es Wotan weiter, direkt zum nächsten Komposthaufen neben dem Grab der verstorbenen Frau des Schriftstellers Johannes Johnson. Das Frettchen wälzte sich beglückt in der alten Pflanzenerde und den Blumenresten. Nelken, Lilien, Vergissmeinnicht. Die Lilien verströmten immer noch einen intensiven Duft. Manche waren noch nicht vollständig verblüht.
Gerade am Abend zuvor hatte Justine, wie so oft, eine Auswahl von Blumen, die sie nicht mehr verkaufen konnte, da sie bereits zu weit aufgeblüht waren, in einen Eimer mit Wasser gestellt. Sie würde sie in den leergebliebenen Vasen der unbetreuten Gräber verteilen. Eigentlich standen diese Blumen in der schönsten Blüte, aber die Leute wollten immer möglichst lange etwas davon haben. An der Dauer der Haltbarkeit wurde ihr Wert bemessen. Sie hatte das zu billigen, genauso wie Gemüsehändler die Tatsache zu akzeptieren hatten, dass ihre Kunden in den seltensten Fällen ungelenk verdrehte Gurken und außergewöhnlich geformte Kartoffeln zu kaufen bereit waren. Sie erinnerte sich an einen Bericht über einen riesigen Berg von Gurken, die entsorgt werden mussten, weil sie der optischen Norm nicht entsprachen. Wäre sie, Justine, eine Gurke, wäre sie längst auf einem solchen Berg gelandet. Alles, was ein wenig anders war, wurde misstrauisch beäugt. Justine kaufte bewusst die merkwürdig geformten Obst- und Gemüsereste. Seltsam, dass diese weniger wert sein sollten als die genormten, doch dies war nur ein winziges Detail all dessen, was Justine nicht verstand. Sie, der Zaungast auf dieser Erde.
Dies alles dachte sie, während sie vor dem Grab der Frau des Schriftstellers Johannes stand und Wotan bei seinen Ausgrabungen beobachtete.
Der buddelte sich maulwurfartig in die Untiefen des Komposthaufens vor. Fasziniert von seinem Gebaren wartete Justine gespannt, was er zutage befördern würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchte sein kleines, helles Köpfchen wieder aus dem Dreck auf. Im Maul hielt er einen glitzernden Gegenstand, den er ihr stolz präsentierte. Es war ein silberner Armreif. Wer ihn wohl dort verloren hatte? Sie würde ihn wohl besser liegen lassen, wo er war. Was Wotan wohl noch alles ans Tageslicht befördern würde? Er war schwer aus seinem Vergnügen herauszureißen, aber nachdem sie ihn mit einem Hühnerherz, einer besonderen Leckerei, die Thomas Cosy ihr für das Tier mitgegeben hatte, bestochen hatte, gelang es ihr mühelos.
Justine setzte ihren Spaziergang mit dem neugierigen Frettchen, das am liebsten an jedem Grashalm geschnüffelt hätte, fort. Es waren noch einige Blumen übrig. Sie ging an einem ihr unbekannten, noch recht frischen Grab vorüber und erkannte einen besonders aufwendigen, schönen Kranz, den sie vor Kurzem noch gebunden hatte und der wunderbar aufgeblüht war. Wenige Meter weiter lag neben einem der großen Mülleimer für Kompostabfälle ein ähnlicher Kranz in seiner verblühten Version. Die vertrockneten Blüten ließen ihre blass gewordenen Köpfe hängen. Mit ein wenig Druck wären sie in Dutzende Teile zerfallen und wie Konfetti auf den Boden gerieselt. Alles hatte seine Zeit.
Auch Margret, die Kundin, die Jahrzehnte später noch über die Trennung von ihrem Ex-Mann trauerte, würde wahrscheinlich in wenigen Tagen vor dem inzwischen verwelkten Kranz niederknien und die Vergänglichkeit des Lebens und der Liebe beweinen.
Justine legte eine ihrer Blumen auf dem Kranz ab. Eine besonders schöne. Vielleicht würde es die Trauernden ein wenig trösten, wenn sie vorbeikämen.
Sie ging weiter am Hauptweg entlang. Wotan zog es zum Grab ihrer Nachbarin Daisy Parker, die tragischerweise vor Kurzem gestorben war. Justine hatte ihr einen ganzen Kranz gespendet. Sie war eine jener unerreichbaren, wunderschönen Frauen gewesen, für die Jägersohn Benjamin heimlich geschwärmt hatte. Daisy hatte Justine vor einiger Zeit anvertraut, dass Benjamin sie mit dem Fernglas beobachtete. Daraufhin hatte Justine ihn genauer in Augenschein genommen und festgestellt, dass er auch sie heimlich von seinem Zimmerfenster aus beschattete. Seitdem hielt sie ihre Vorhänge geschlossen, sobald es dunkel wurde und sie das Licht anzündete. Justine konnte durchaus verstehen, dass Benjamin für Daisy geschwärmt hatte, aber es war ihr schleierhaft, was er an ihr fand. Justine entsprach ihrer eigenen Einschätzung nach nicht dem Klischee einer hübschen Frau und schon gar nicht dem einer solchen, die sich als Projektionsfläche für die Tagträumereien eines jungen Mannes geeignet hätte. Daisy hatte damals allerdings entgegnet, sie könne sich durchaus vorstellen, dass Justines geheimnisvolle und zurückhaltende Art durchaus interessant für Benjamin sein könnte. Justine würde Daisy vermissen. Sie war eine der wenigen Nachbarinnen gewesen, mit der sie sich gerne von Zeit zu Zeit ausgetauscht hatte.
Ihr Grab war noch frisch. Ein Berg voller Kränze zeugte von der großen Schar an Trauergästen, die ihr die letzte Ehre erwiesen hatten.
Daisy war mit Kind, Mann und Hund rundum glücklich gewesen, bis an ihr Lebensende, das ganz jäh eintraf, als sie von einem Stuhl steigen wollte, den sie erklommen hatte, um einen ihrer Hängeschränke zu erreichen. In letzter Sekunde hatte sie gesehen, dass ihr Chihuahua genau dort auf sie wartete. Um ihren kleinen Liebling nicht zu gefährden, hatte sie sich am Wandschrank festgehalten, dessen Tür aus den Angeln brach. Rücklings waren beide, Daisy und die Tür des Wandschranks, auf die steinharten Fliesen des Küchenbodens gestürzt. Daisy war sehr unglücklich aufgekommen und auf der Stelle tot gewesen. Ihr Therapeut hatte schon recht, die meisten tödlichen Unfälle passierten im Haushalt. Es waren oft die banalsten Anlässe, die zu großen Dramen führten.