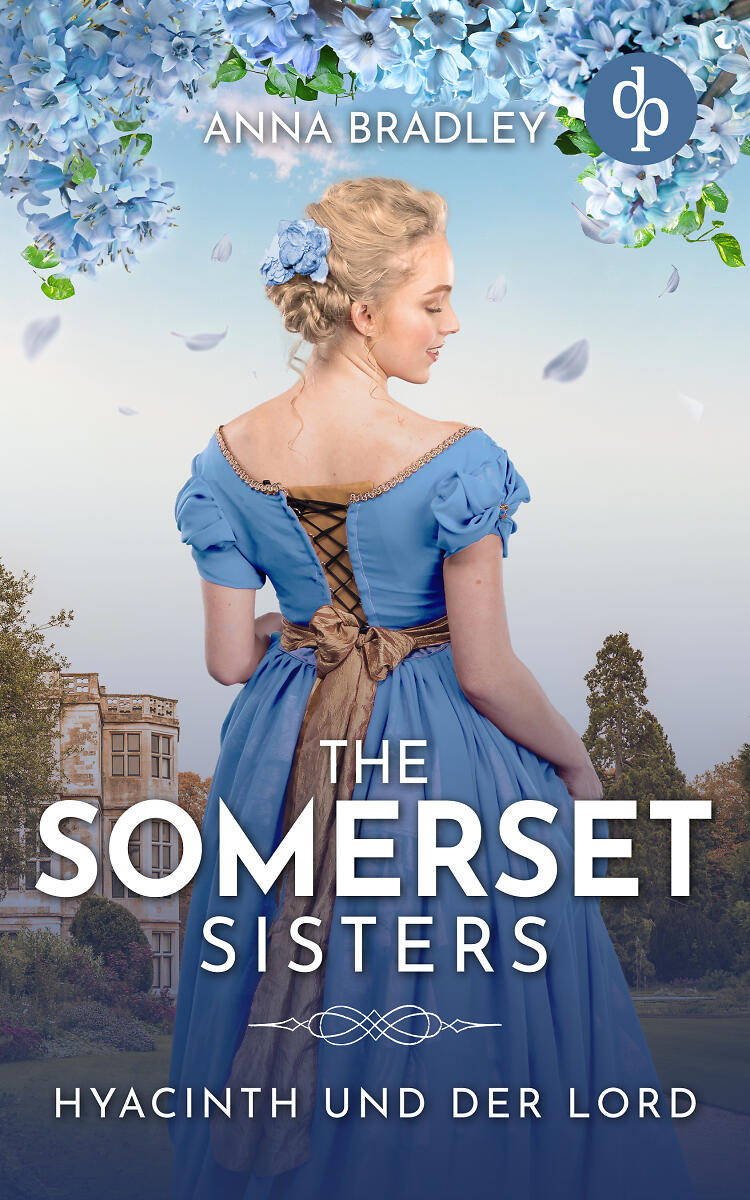Prolog
Lochinver, Schottland
Januar 1818
Seine Mutter würde sterben.
Lachlan Ramsey stand an ihrem Bett, blickte in ihr verfallenes Gesicht hinab und wusste es so sicher, wie er wusste, dass die Sonne an diesem Morgen aufgehen würde wie auch am darauffolgenden.
Vielleicht starb sie nicht heute oder morgen, doch eines nicht allzu fernen Tages würde die Sonne aufgehen und sie wäre nicht mehr hier, um sie zu sehen.
Elizabeth Ramsey zupfte mit blassen, skelettartigen Fingern an ihrer Bettdecke. „Was ist mit Isobel Campbell? Sicher hat sie nicht davon abgesehen …“
„Doch, hat sie.“ Lachlan fiel ihr ins Wort, bevor sie ihren Satz beenden konnte, weil er die mitleiderregende Hoffnung in ihrem Gesicht nicht ertragen konnte. „Isobel und Ewan ebenfalls.“
Isobel Campbell, die Verlobte seines Bruders Ciaran, sowie ihr Bruder Ewan, Lachlans ältester Freund. Er besaß kaum eine Erinnerung, die Ewan Campbell nicht mit einschloss. Als Jungen waren sie auf ihren Ponys durch die Moore gestreift, hatten sich als rastlose Heranwachsende mit den Fitzwilliam-Brüdern gebalgt und waren später als liebeshungrige junge Männer den rothaarigen schottischen Mädchen hinterhergestiegen. Bei jeder blutigen Nase und jeder Schuljungenschwärmerei war Ewan an seiner Seite gewesen. Noch vor einem Monat hätte Lachlan nicht geglaubt, dass Ewan ihm je den Rücken kehren würde.
Doch genau das hatte er getan. Das hatten sie alle getan.
„Isobel, und auch Ewan.“ Elizabeth schloss ihre Augen und schwieg eine lange Weile. Als sie sie wieder öffnete, strahlten sie mit fiebriger Entschlossenheit. „Es ist vorbei, Lachlan. Für dich gibt es hier nichts mehr. Nimm Ciaran und Isla und verlass diesen Ort. Wenn du gegangen bist, schau nicht mehr zurück.“
„Vielleicht ändern sie ihre Meinung noch.“
„Das werden sie nicht. Du kennst die Leute hier. Sie sind stur und ebenso stolz. Sie werden ihre Meinung nicht ändern.“
„Wir werden dich nicht zurücklassen.“
„Von mir wird bald nicht viel übrigsein, das ihr zurücklassen könnt. Ich sterbe, Lachlan. Lass uns nicht so tun, als wäre es nicht so.“
Er wollte es leugnen, mit ihr schimpfen, durch jeden Raum dieses Schlosses stürmen. Er wollte nichts als Verwüstung hinter sich lassen, nur um die ohnmächtige Wut loszuwerden, die ihn gepackt hielt und ihre Krallen tief in sein Fleisch grub.
Doch Wut würde ihm nicht nützen. Seine Mutter hatte recht. Elizabeth Ramsey war nie jemand gewesen, der die Wahrheit geleugnet hatte, so schmerzhaft sie auch gewesen war. Sie würde sterben und sie würden sie in der kalten Erde zurücklassen mit ihrem Grab als einzigem Beweis, dass die Ramsays je hier gewesen waren.
„Wohin sollen wir gehen?“ Er sagte nicht, dass es keine Rolle spielte, obwohl es so war.
Elizabeth drehte ihren Kopf auf dem Kissen und deutete mit einer schwachen Geste auf den kleinen Tisch neben ihrem Bett.
„Da, in der Schublade. Ein Schlüssel. Hol ihn mir.“
Lachlan wühlte in der Schublade, bis seine langen Finger sich um einen winzigen silbernen Schlüssel schlossen. „Diesen hier?“ Er hielt ihn hoch und seine Mutter nickte.
„In meinem Ankleidezimmer, unter einem Stapel Quilts, befindet sich eine Holzschachtel. Hol sie mir.“
Lachlan tat wie ihm geheißen. Seine gedämpften Schritte und das Rasseln ihres angestrengten Atems waren die einzigen Geräusche, während er den Raum durchquerte und ihr Ankleidezimmer betrat. Er kniete nieder und schob die Decken beiseite. Als er die Schachtel fand, hielt er inne und setzte sich auf seine Fersen. Es war eine einfache, in jeder Hinsicht unscheinbare Holzkiste, und doch schien ein Schatten über das Zimmer zu gleiten, sobald er sie ansah. Lachlan hätte nicht erklären können, warum, aber alles in ihm sträubte sich dagegen, diese Schachtel zu öffnen.
„Lachlan?“
Beim Klang der Stimme seiner Mutter drehte er sich um, stand auf und nahm die Kiste in die Hände. Zögern nützte nun nichts. Was immer der Inhalt war, er konnte nicht schlimmer sein als das, was bereits geschehen war.
Viel später, nachdem seine Mutter ihre Geheimnisse offenbart hatte, und er, Ciaran und Isla auf dem Weg nach England waren, dachte er an diesen Moment zurück und schimpfte sich selbst einen Narren.
Die Dinge konnten immer schlimmer werden.
„Stell sie hierher, aufs Bett.“ Seine Mutter kämpfte sich in eine sitzende Position und Lachlan half ihr, sich in die Kissen in ihrem Rücken zu lehnen. Er versuchte zu ignorieren, wie ausgemergelt sie war, doch als er sie stützte, überkam ihn die Erinnerung an einen toten Vogel, den er als kleiner Junge gefunden hatte. Die Hunde hatten ihn getötet und unter seinem zerzausten Gefieder war ein Haufen winziger, zerbrechlicher Knochen gewesen – weiß, unglaublich dünn und kläglich verletzlich.
Seine Mutter drehte den Schlüssel im Schloss der Kiste. Lachlan hob den schweren Deckel und spähte hinein.
Papiere. Dünne Stapel lagen aufeinander. Zumeist waren es Briefe, deren Siegel gebrochen waren. Sie sahen aus, als wäre ein Wappen in dunkelrotes Wachs gepresst worden, doch mit den Jahren war es hart und brüchig geworden, sodass er es nicht erkennen konnte.
„Die Papiere, Lachlan. Gib sie mir, ja?“
Wieder gehorchte Lachlan seiner Mutter. Statt sie zu lesen, sank seine Mutter in die Kissen zurück. Ihre dünnen Finger umklammerten die vergilbten Seiten. „Vielleicht war es ein Fehler, das hier vor dir zu verbergen, doch ich habe nie viel für Bedauern übriggehabt. Es hat keinen Zweck und nützt niemandem. Wenn ich sterbe, Lachlan, möchte ich neben Niall Ramsey begraben werden.“
Niall Ramsey. Nicht „dein Vater“, sondern Niall Ramsey. Er hätte vorhersehen können, was als Nächstes kam, doch es gelang ihm nicht. Wie hätte es ihm auch gelingen können? Wie hätte es irgendwem gelingen können?
„Sobald ich unter der Erde bin, bringst du deinen Bruder und deine Schwester nach Buckinghamshire, zu einem Anwesen namens Huntington Lodge. Wende dich an Phineas Knight, wenn du ankommst. Er ist der Marquess von Huntington. Möglicherweise freut er sich nicht, dich zu sehen, denn nach allem, was man hört, ist er ein stolzer, ernsthafter Mann, doch das spielt keine Rolle. Er kann sich nicht weigern, dich anzuerkennen.“
Lachlan starrte sie an. „Mich als was anzuerkennen?“
„Als seinen Bruder.“ Ihre Finger schlossen sich um die Seiten in ihrer Hand. „Der vorherige Marquess of Huntington erkennt dich in diesen Briefen als seinen Sohn an. Der aktuelle Marquess, Phineas Knight, ist dein älterer Bruder, Lachlan.“
„Ciaran ist mein einziger Bruder.“ Dutzende von Bildern von Ciaran kamen ihm in den Sinn: Ciaran als Kleinkind in den Armen ihrer Mutter, Ciaran als Junge, der Lachlan auf seinen kurzen Beinen hinterherrannte und den Älteren mit seiner Anbetung nervte, wie es alle jüngeren Brüder taten.
„Nein, Lachlan. Ciaran ist dein Halbbruder und Isla deine Halbschwester. Niall Ramsey ist ihr Vater, aber er … er ist nicht deiner. Er liebte dich wie seinen eigenen Sohn – kein Mann könnte dich mehr geliebt haben – aber dein richtiger Vater ist der verstorbene Marquess of Huntington, der Vater des aktuellen Marquess.“
Lachlan nahm ihr die Papiere aus der Hand und starrte einen Moment lang blicklos darauf, bevor er sie beiseite warf. Selbst wenn sie seinen Anspruch auf ein anderes Leben bewiesen, konnte er in ihnen keine Bedeutung für sich selbst erkennen, keine Verbindung zu sich herstellen. Es waren nur Zeichen auf Papier, geschrieben in verblassender schwarzer Tinte.
„Ich bin der Bastard eines Marquess?“ Es war merkwürdig, wie ruhig er klang. Beinahe, als wäre er nicht soeben zerrissen und in einer Weise wieder zusammengesetzt worden, die er nicht erkannte.
„Du bist kein … Ich war mit Lord Huntington verheiratet, als ich dich empfing. Als ich deinem Va- als ich Niall Ramsey begegnete, wuchst du bereits in meinem Leib heran.“
Lachlan schnappte nach Luft, als hätte er soeben einen heftigen Schlag in die Magengrube erhalten. „Du bist aus deiner Ehe geflohen und hast deinen ersten Sohn zurückgelassen? Was für eine Mutter-“
Was für eine Mutter verlässt ihren Sohn? Was für ein Vater lässt sie gehen, wissend, dass sie sein ungeborenes Kind trägt?
Er schluckte die bitteren Worte hinunter, denn was spielten ihre Gründe jetzt noch für eine Rolle? Es gab keine Antwort, die sie ihm hätte geben können, die irgendetwas davon aus seiner Sicht richtig erscheinen lassen hätte, und gegenseitige Anschuldigungen waren ebenso nutzlos wie Bedauern.
Dann kam ihm etwas anderes in den Sinn und seine Brust krampfte sich vor Entsetzen zusammen. „Was ist mit Ciaran und Isla? Der Marquess von Huntington ließ sich von dir scheiden, nachdem du ihn verlassen hast, nicht wahr?“
Denn wenn er das nicht getan hatte, wenn es keine Scheidung gegeben hatte …
„Nein. Er starb einige Jahre später. Ich heiratete dann Niall Ramsey, doch nicht bevor-“
„Nicht bevor Ciaran auf der Welt war.“
„Nein, nicht davor.“ Sie zögerte nicht und zeigte auch keine Scham – nur Entschlossenheit. „Du bist mein Sohn, Lachlan, der rechtmäßige Sohn des verstorbenen Marquess of Huntington und der jüngere Bruder des gegenwärtigen Marquess. Isla ist meine rechtmäßige Tochter mit Niall Ramsey und Ciaran-“
„Kam als Bastard zur Welt.“ Lachlan starrte die Holzkiste an und erwartete beinahe, ein Nest von Giftschlangen zu sehen. „Es ist pures Glück, dass er heute kein Bastard mehr ist. Und ich bin … Jesus, ich bin nicht einmal Schotte. Ich bin Engländer.“ Betäubt schüttelte er den Kopf. Vor weniger als einer Stunde hatte er diesen Raum als Lachlan Ramsey betreten, der Sohn von Niall und Elizabeth Ramsey, der Bruder von Ciaran und Isla.
Nun war er jemand anders. Jemand, den er nicht kannte und von dem er nicht die geringste Ahnung hatte, wer er war.
„Nicht nur ein Engländer, sondern ein englischer Lord, der Sohn eines Marquess. Es ist dein Geburtsrecht und deine Zukunft. Hör mir zu, Lachlan.“ Seine Mutter umfasste seine Hand mit überraschender Stärke. „Wenn du Lochinver verlässt, musst du deine Vergangenheit hier zurücklassen. Islas … Unglück und alles, was darauf folgte. Du darfst niemandem davon erzählen. Versprich es mir.“
Abgestoßen von der Berührung ihrer kalten, verschrumpelten Finger zog er seine Hand fort. „Noch mehr Lügen? Haben sie nicht bereits genug Schaden angerichtet?“
„Lange nicht so viel, wie die Wahrheit es tun würde, würde irgendwer in England sie erfahren. Als Beweis dafür musst du nur nach Lochinver schauen. Diese Menschen kennen dich ihr ganzes Leben und sie alle haben dir den Rücken gekehrt. Denkst du, Fremde würden anders reagieren, wenn sie die Wahrheit kennen würden? Ich habe im englischen Adel gelebt, Lachlan. Ich weiß, wie böse diese Menschen sein können. Die Vergangenheit muss in der Vergangenheit bleiben. Tut sie das nicht, werden Ciaran und Isla diejenigen sein, die darunter leiden müssen.“
Und Ciaran und Isla haben bereits genug gelitten.
Seine Mutter sagte es nicht, doch das war auch nicht nötig. Lachlan hatte ihren Schmerz mitangesehen. Ihre Wunden hatten Narben auf seinem eigenen Herzen hinterlassen.
„Beschütze sie, Lachlan. Ich flehe dich an, auf meinem Sterbebett, das Geheimnis zu wahren. Fang ein neues Leben an, ohne die Last der Vergangenheit auf deinen Schultern.“
War ein Geheimnis nicht auch eine Last? Er legte eine Hand auf die Holzkiste und bemerkte wieder, wie schwer sie war.
Schwer von Geheimnissen und Lügen …
Tränen standen in den Augen seiner Mutter. „Versprich es mir, Lachlan.“
Ihr ein Versprechen geben, wo sie doch jedes Versprechen gebrochen hatte, das sie ihm, Ciaran und Isla je gegeben hatte, indem sie die Wahrheit in ihrem Ankleidezimmer versteckt gehalten hatte, verschlossen in einer hölzernen Kiste.
Doch sie war seine Mutter und sie würde sterben, also gab Lachlan ihr schließlich das geforderte Versprechen. Nicht nur, weil sie ihn angefleht hatte und er sie trotz allem liebte, was auch immer sie getan hatte, sondern weil er die Wahrheit in ihren Worten nicht leugnen konnte.
Er konnte niemandem vertrauen. Nicht denen, die er für seine Freunde gehalten hatte, nicht dem Mann, den er Vater genannt hatte, und nicht seiner Mutter, die ihre eigenen Geheimnisse hatte, die sie mit ins Grab genommen hätte, hätte sie die Wahl gehabt.
Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, war Elizabeth Ramsey tot. Am Ende der Woche begruben sie sie. Die Blumen, die sie auf ihr Grab gelegt hatten, waren noch frisch, als Lachlan, Ciaran und Isla nach Buckinghamshire aufbrachen.
Ihre Mutter hatte ihnen geraten, ihre Vergangenheit zu vergessen, und sie folgten ihren Worten. Die Geschwister ließen das einzige Zuhause, das sie je gekannt hatten, ihre einzigen Freunde und die zwei kalten, stillen Gräber hinter sich.
Keiner von ihnen blickte zurück. Es gab keinen Grund dafür. Es gab nichts mehr zu sehen.
Kapitel Eins
Aylesbury, England
Spät im Januar 1818
Blut quoll aus Lachlans Mundwinkel, rann sein Kinn hinab und tropfte auf seine perfekt gebundene, schneeweiße Krawatte.
Verdammt. Eine weitere Nacht, ein weiteres Gerangel und eine weitere ruinierte Krawatte.
„Verdammt noch mal, Ciaran! Warum musst du mich immer auf den Mund schlagen?“ Lachlan packte seinen jüngeren Bruder am Kragen und schubste ihn rückwärts. Die beiden großen Hände, die sich um Lachlans Hals gelegt hatten, lösten sich, als Ciaran gegen das Geländer hinter ihm stolperte. Er und Ciaran waren ungefähr gleich groß und demzufolge war es nicht leicht, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Allerdings war Ciaran bereits ins Stolpern geraten, bevor Lachlan ihn berührt hatte. Den größten Teil einer Whiskyflasche zu leeren, konnte so etwas bei einem Mann anrichten. Ciaran, der viel zu betrunken war, um es besser zu wissen, kam auf die Füße und schoss wieder nach vorn. „Ohne Blut ist es kein richtiges Gerangel, Bruder. Und Lippen bluten so gut.“
Wie um seine Aussage zu untermalen, flog eine von Ciarans riesigen Fäusten auf Lachlans Gesicht zu, doch bevor er einen Treffer landen konnte, packte Lachlan seine Hand, brachte ihn mit einer Drehung seines Arms aus dem Gleichgewicht und trat ihm gegen das Schienbein. Ciaran ging in die Knie. Lachlan war sofort über ihm und fasste ihn bei den Haaren, damit er still liegen blieb. Er beugte sich so dicht über ihn, dass ihre Nasen sich beinahe berührten. „Nasen bluten auch gut. Du bettelst geradezu um meine Faust auf deiner Nase, aber ich verspüre heute Nacht nicht den Wunsch, dein Blut zu vergießen.“
Er hatte Ciarans Blut bereits in der Nacht davor vergossen, ebenso wie in der davor, doch alle Hoffnungen, es heute nicht vergießen zu müssen, schwanden, als ein plötzlicher Hieb in seine Rippen ihm den Atem raubte.
„Uff!“ Er stolperte seitwärts und landete nach Luft schnappend neben seinem Bruder auf dem Boden. Er drehte sich auf den Rücken, doch bevor er wieder auf die Füße kommen konnte, hatte er Ciarans Knie auf der Brust, das ihn am Boden hielt.
„Oh, komm schon, Lach, das hättest du kommen sehen müssen.“
Lachlan grunzte nur. Er hatte nicht genug Luft zum Streiten und außerdem hatte er genug. Er hätte es wirklich kommen sehen müssen. Schon als sie noch Jungen gewesen waren, hatte Ciaran immer zuerst auf den Mund gezielt, dann auf die Rippen, und dann …
Oh Gott.
Ihm blieb keine Zeit, um den Fluch in Worte zu fassen, bevor Ciarans Faust auf seinen Kiefer krachte.
Mund, Rippen, Kiefer. Immer der Kiefer.
„Du versuchst es ja nicht mal“, beschwerte sich Ciaran. Er fasste Lachlan in die Haare, riss seinen Kopf hoch und stieß ihn dann zurück, sodass er mit einem hörbaren Geräusch wieder auf dem Boden landete. „Es macht keinen Spaß, wenn du es nicht einmal versuchst.“
Lachlan versuchte es sehr wohl – versuchte, die Rauferei mit seinem Bruder zu beenden, ohne ihn dabei zu verletzen, doch er verließ sich zu sehr darauf, dass der Whisky für ihn erledigte, was er mit seinen Fäusten nicht tun wollte. „Verdammt noch mal, wie zum Teufel kann es sein, dass du immer noch bei Bewusstsein bist, Ciaran?“
Ciaran grinste. „Keine verdammte Ahnung, aber so ist es, Bruder, und ich bezweifle, dass dein Gesicht morgen noch so hübsch aussieht wie es das heute tat.“
Lachlan wand sich und zappelte wie ein Fisch am Haken, doch seine Bemühungen, Ciaran abzuwerfen, glichen denen, ein unwilliges Pferd zu bewegen. Er musste ihm eine verpassen. Entweder das oder er würde eine Pfütze Blut und vielleicht ein oder zwei Zähne zurücklassen, wenn sie dieses Gasthaus verließen.
Lachlan spannte seinen Arm an. Er ballte seine Hand zur Faust und wartete. Ciaran hatte seine Raufereien gern blutig, also würde er auf seinen Mund oder seine Nase zielen, und dann würde sich sein Körpergewicht ein wenig verlagern, und …
Jetzt.
Ciaran zog seine Faust zurück, bekam aber keine Möglichkeit zuzuschlagen, bevor Lachlans eigene Faust von der Seite her angeflogen kam. Sie war so weit rechts, dass Ciaran sie nicht kommen sah. Lachlan zuckte zusammen, als seine Knöchel auf den Wangenknochen seines Bruders krachten, doch der Hieb tat sein Übriges. Ciaran wurde von der Wucht des Aufpralls zur Seite geworfen und bevor er sein Gleichgewicht zurückgewann, schob Lachlan seine Hände unter Ciarans Knie, drehte ihn auf den Rücken und kam selbst auf die Füße.
„Möchtest du heute Nacht noch mehr Blut vergießen, Ciaran?“
Für einen Mann, der so viel getrunken hatte, kam Ciaran mit beeindruckender Anmut auf die Beine. „Es ist nicht nötig, noch einen weiteren Tropfen deines Blutes zu vergießen. Das hier ist nicht dein Kampf, Bruder. Nicht, solange du dich mir nicht in den Weg stellst.“
Aber es war sehr wohl sein Kampf. Seiner und Ciarans, genau wie jeder Kampf, seit sie Schottland verlassen hatten, ihr Kampf gewesen war. Statt sein Schicksal zu akzeptieren, wuchs Ciarans Widerstand wie die Infektion einer eitrigen Wunde. Unterstützt von großen Mengen Whisky, versteht sich.
„Wenn ich dir verdammt noch mal aus dem Weg gehen wollen würde, hätte ich es längst getan.“ Lachlan drehte sich langsam im Kreis und behielt seinen Bruder im Auge, während der sich auf ihn zubewegte. „Jetzt geh hinauf in dein Schlafzimmer, bevor ich dir deinen Dickschädel vom Hals schlage.“
„Nein, ich denke nicht, dass ich jetzt schon nach oben gehe. Ich möchte noch etwas trinken.“
„Du hattest bereits genug.“ Wenn Ciaran ins Gasthaus zurückkehrte und zufällig auf den Engländer traf, den er gerade des Betrugs am Kartentisch beschuldigt hatte, hätte er viel größere Sorgen als Lachlans Faust in seinem Gesicht. Zum Beispiel eine Kugel des Engländers zwischen seinen Augen.
Ciaran lachte bitter. „Ein Schotte, der in England gefangen ist, kann nicht genug zu trinken haben. Aber davon weißt du nichts, nicht wahr, Bruder, da du ja jetzt ein Engländer bist?“
Lachlan ballte seine Hände zu Fäusten. Seit sie vor neun Tagen auf englischem Boden angekommen waren, hatte er ein Dutzend kleine, halbmondförmige Abdrücke in seine Handflächen gegraben. „Ich bin noch immer Schotte genug, um dich für den Rest der Nacht bewusstlos zu schlagen.“
Ciaran zuckte die Achseln und hob die Fäuste. „Wie du willst. Zuerst dein Blut und dann seines.“
„Na los dann.“ Lachlan duckte sich und wartete auf den Angriff seines Bruders.
Es war ein Uhr morgens und so dunkel, dass Lachlan Ciarans Gesicht in dem schummrigen Licht, das aus dem Fenster des Gasthauses in den Hof fiel, gerade so erkennen konnte. Ciaran war so betrunken, dass er sich am nächsten Morgen möglicherweise gar nicht mehr an diese Begegnung erinnern würde, doch Lachlan würde seinen Bruder erst blutig schlagen müssen, bevor das hier heute Nacht ein Ende fand.
Sein Magen revoltierte bei dem Gedanken. Egal. Er konnte sich übergeben, so viel er wollte, und es würde keinen Unterschied machen. Was auch immer heute noch passieren würde, eines war sicher. Er und Ciaran würden sich prügeln. Wieder einmal.
Nur zwei Zentimeter. Ein bloßer Hauch und nicht mehr. Zwei Zentimeter war alles, was sie sich traute.
Hyacinth Somerset kämpfte sich auf dem Fenstersitz auf ihre Knie und presste ihre Wange gegen das kalte Glas. Sie hob ihr Kinn, damit das bisschen frische Luft, das hereinströmte, ihren geöffneten Mund erreichte.
So weit war es also gekommen. Ihre Welt war seit Wochen geschrumpft. Nein, länger. Seit Monaten? Einem Jahr? Sie war kleiner geworden, enger, in sich selbst zusammengestürzt, und nun sollte sie in einem luftleeren Grab ersticken. Alles war still bis auf das tiefe, andauernde Dröhnen des drohenden Verhängnisses in ihren Ohren …
„Hyacinth! Was um alles in der Welt machst du da, Kind? Mach sofort das Fenster zu.“
Hyacinth sprang erschrocken auf und sackte mit einem dumpfen Geräusch auf ihren Sitz zurück.
Oh, na schön. Sie war nicht in einem luftleeren Grab gefangen, sondern in einem vollgestopften Schlafzimmer im Gasthaus Horse and Groom. Das Dröhnen war nicht das drohende Verhängnis, sondern das Schnarchen ihrer Großmutter.
Zumindest war es das gewesen.
Wie um alles in der Welt konnte es sein, dass ihre Großmutter noch bei Bewusstsein war? Entgegen Hyacinths Warnung hatte sie eine Menge Laudanum zu sich genommen, die ein Pferd ins Koma versetzt hätte.
„Oh, es ist schrecklich, auf Landstraßen zu reisen“, zeterte Lady Chase. „Hyacinth? Hast du mich gehört? Schließ das Fenster und geh zu Bett.“
Hyacinth saugte einen letzten, verzweifelten Atemzug Frischluft ein und schloss dann das Fenster mit einem ergebenen Seufzer. „Ich dachte, du würdest schlafen. Sicher würdest du dich nach einem langen, tiefen Schlaf viel besser fühlen.“
Ein tiefer Schlaf oder eine Bewusstlosigkeit – beides wäre von Vorteil. Hyacinth war eine liebevolle und pflichtbewusste Enkelin, doch nach Stunden in einer engen Kutsche ohne einen Hauch von Frischluft war ihre Geduld am Ende.
Sie eilte durch das Zimmer und setzte sich auf den Rand des Bettes ihrer Großmutter. „Nun leg dich hin und schließ die Augen, ja?“
Lady Chase legte ihre zittrige Hand mit dem Handrücken an ihre Stirn. „Ich kann bestimmt nicht schlafen. All der Staub und der Schmutz haben meine Nerven überanstrengt.“
Hyacinth hatte kein Staubkörnchen und keinen Schmutzfleck gesehen, seit sie Huntington Lodge verlassen hatten, da ihre Großmutter darauf bestanden hatte, die Kutsche dichter als … nun ja, als ein Grab zu versiegeln. Dennoch, sie schuldete den schwachen Nerven ihrer Großmutter Dankbarkeit. Ohne ihre Reizbarkeit hätten sie auf ihrem Weg zurück nach London nicht in Aylesford haltgemacht, und Hyacinth würde noch immer in dieser Kutsche sitzen. Wenn ihre Nerven die gute alte Dame nun in den Schlaf führen würden, wäre Hyacinth ihnen wirklich dankbar.
„Hast du mein Riechfläschchen, Hyacinth?“
Hyacinth drückte ihrer Großmutter das kleine Gefäß in die Hand und zog die Bettdecke unter ihr Kinn. „Ja, hier ist es. Nun schlaf, ja?“
Lady Chase tätschelte ihre Hand. „Ich werde es versuchen. Du bist ein gutes Mädchen, Liebes.“ Sie war wirklich ein gutes Mädchen. So gut, so fügsam und hilfsbereit.
Eine süße junge Dame, auf alle Fälle, und natürlich eine Erbin. Doch es lässt sich nicht leugnen, dass sie ein wenig seltsam ist. Und übertrieben bescheiden. Sicher findet man keine kleinlautere junge Dame in ganz London. Es wird so kurzweilig werden zuzusehen, wie sie versuchen wird, ihre Saison zu überleben. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass das arme Ding auch nur einen einzigen Ball übersteht, ohne in den Ruheraum der Damen zu flüchten und sich dort für den Rest der Nacht zu verstecken.
War das ihre eigene Stimme, die sie da beleidigte, oder wiederholte sie schlicht und einfach das Geflüster, das sie hinter ihrem Rücken von anderen gehört hatte? Hyacinth hatte es aufgegeben, darüber nachzudenken. Am Ende machte es keinen Unterschied.
Es war schließlich nicht so, als hätte die Stimme unrecht.
Es hatte jedoch einfach keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken, wo ihre Lunge nur ein Keuchen von der Kapitulation entfernt war.
„Du siehst, wie zerbrechlich Iris ist, Hyacinth.“ Ihre Großmutter setzte sich in ihren Kissen auf, als hätte sie plötzlich wieder Aufwind bekommen. „Ich bezweifle, dass sie uns in dieser Saison von großem Nutzen sein wird.“
Hyacinths Schwester Iris und deren Mann Finn, der Marquess of Huntington, hatten sie auf der Reise nach London begleitet und wollten während Hyacinths Saison in der Stadt bleiben. Ihre andere Schwester Violet und deren Mann Nick, der Earl of Dare, waren von Ashdown Park nach London unterwegs.
Gott sei Dank, denn Hyacinth würde jeden ihr zur Verfügung stehenden Rückhalt brauchen, wenn sie ihre Saison überleben wollte. Wenn man in die Schlacht ziehen wollte, war ihr Schwager Finn genau der richtige Gentleman, um das Kommando zu übernehmen. Nicht nur, weil der Adel seinem Rang so viel Ehrerbietung entgegenbrachte, sondern weil er hochgewachsen, ernst und eindrucksvoll war. Und weil er sie leidenschaftlich beschützen würde.
Finn war ziemlich furchteinflößend, was eine nützliche Eigenschaft war, wenn man mit dem Adel umgehen musste.
„Finn wird da sein.“
Lady Chase stieß einen schweren Seufzer aus. „Ja, ja. Aber Männer sind in diesen Dingen nie eine große Hilfe, obwohl ich zu behaupten wage, dass er nützlicher sein wird als Iris oder Violet.“
Ihre Schwestern waren beide guter Hoffnung und litten unter extremer Reizbarkeit … äh, unter Erschöpfung. Ja, ja, das war das richtige Wort dafür. Selbst die kurze Reise von Huntington Lodge hatte Iris erregt … äh, erschöpft, und Finn hatte sie auf ihr Zimmer gebracht, sobald sie heute Abend das Gasthaus erreicht hatten.
„Eine Schwangerschaft ist ein gesegnetes Ereignis, ganz ohne Zweifel, aber ich verstehe nicht, warum deine beiden Schwestern gerade jetzt gesegnet sein müssen. Das ist sehr unpassend von ihnen. Ich sehe kommen, dass die Organisation deiner Saison gänzlich an mir hängenbleiben wird. Sicher wird das in Bezug auf meine Gesundheit einen Tribut fordern, doch es lässt sich nicht ändern, und wie du weißt, denke ich in solchen Fällen niemals an mich selbst.“
Verstohlen wischte Hyacinth sich ihre Hände an ihren Röcken ab. Ihre Handflächen wurden feucht, sobald jemand auch nur ein Wort über ihre bevorstehende Saison verlor. Es war nicht auszudenken, was für eine Katastrophe möglicherweise mit ihrem Kleid geschehen könnte, wenn sie inmitten eines Ballsaals stand. Hauchdünne Seide passte nicht gut zu klebriger Panik.
„Ich weiß, Großmutter, und es ist deine Gesundheit, um die ich mir gerade Sorgen mache. Du musst dich ausruhen.“ Hyacinth versuchte, die Verzweiflung aus ihrer Stimme herauszuhalten. „Denk an deine Nerven.“
„Ja, ja. Das werde ich.“ Lady Chase schloss gehorsam ihre Augen. Doch bevor Hyacinth erleichtert aufatmen konnte, flogen ihre Lider wieder auf. „Ich werde versuchen, mich auszuruhen, aber ich befürchte, ich werde nicht schlafen. Kein bisschen, Hyacinth, bis du sicher unter der Haube bist. Ein weiterer Marquess, denke ich, oder vielleicht diesmal ein Duke …“
Hyacinth sah zu, wie die Lider ihrer Großmutter endlich schwer wurden. Lady Chases Wimpern flatterten und schließlich seufzte sie tief. Ihr Kopf sank auf dem Kissen zur Seite und ein sonores Schnarchen erfüllte den Raum.
„Großmutter?“ Hyacinth wartete mit angehaltenem Atem darauf, dass die Augen ihrer Großmutter sich wieder öffneten, doch Lady Chase war schließlich dem Laudanum erlegen.
Gott sei Dank.
Hyacinth liebte ihre Großmutter sehr, doch die alte Dame war höchst zänkisch, wenn ihre Routine unterbrochen wurde. Das war ein Grund zur Besorgnis, denn Hyacinths Präsentation auf dem Heiratsmarkt war nur noch eine Woche entfernt und würde auf jeden Fall ihre Routine unterbrechen. Bestenfalls.
Schlimmstenfalls würde es in einer kompletten Katastrophe enden. Es war nicht so, dass sie sich eine Saison wünschte. Das tat sie nicht. Der bloße Gedanke daran, sich für jeden adligen Gentleman in London zur Schau zu stellen und sich angaffen zu lassen, verursachte ihr Übelkeit.
Sie wollte … etwas. Irgendetwas. Es war nicht wichtig, was, solange es einen winzigen Riss in die Schale zauberte, die sie um sich errichtet hatte. Das Problem war, dass sie nicht die geringste Ahnung hatte, was dieses Ding sein konnte, nach dem sie sich sehnte. Ein Verehrer, eine Liebeswerbung, eine Ehe – sie hatte keine großen Hoffnungen, dass ihre Saison ihr das bescheren würde, aber vielleicht bekam sie etwas anderes.
Etwas, das ich mir nicht vorstellen kann …
Bevor ihre Schwestern geheiratet hatten, hatte Hyacinth sich gesagt, dass sie zufrieden damit sein würde, ihr Leben in Bedford Square, dem Haus ihrer Großmutter, zu verbringen. Nachdem Iris und Violet gegangen waren, wurde die Ruhe, die sie einst geschätzt hatte, ohrenbetäubend, und ihr ungestörter Frieden wurde zu einer schmerzenden Einsamkeit. Mit jedem Tag, der verging, rückten die Wände des Hauses näher und näher, und ihre Welt wurde um einen weiteren Zentimeter kleiner.
Niemand, nicht einmal sie, konnte in einem so kleinen Raum leben. Also hatte sie einer Saison zugestimmt, weil sie buchstäblich nichts zu verlieren hatte. Hyacinth stand vom Bett auf, nahm ihren Mantel von der Stuhllehne und hielt inne, als sie ihr Spiegelbild im Fenster sah, das von der Lampe hinter ihr beleuchtet wurde. Mit dem Mantel in ihrer Hand zögerte sie. Sie hatte einen kurzen Spaziergang im Hof des Gasthauses machen wollen, um frische Luft zu bekommen, doch draußen war es dunkler als in der tiefsten Nacht. Sie wollte nicht im Dunkeln auf dem Hof eines Gasthauses umherwandern, doch ebenso wenig wollte sie ihrer Lunge den dringend benötigten Sauerstoff vorenthalten, und sie war den ganzen Tag lang beinahe erstickt. Sie könnte jetzt das Fenster öffnen, doch sicher würde die kalte Luft ihre Großmutter aufwecken. Vielleicht sollte sie einfach ebenfalls ins Bett gehen. Sicher konnte sie weitere acht oder zehn Stunden mit wenig Luft auskommen …
Um Himmels willen, hast du jetzt Angst vor der Dunkelheit? Ist es schon so weit gekommen?
Es war eine Sache, ihre Saison zu fürchten – schließlich war so etwas tatsächlich furchteinflößend – doch es war etwas anderes, sich kindlichen Ängsten zu unterwerfen. Wenn sie so weitermachte, wohin würde sie das führen? Angst vor Geistern? Unwettern? Großen Hunden? Spinnen?
Nein. Das würde sie nicht zulassen. Das war kompletter Unsinn. Nun, von Spinnen vielleicht abgesehen, denn das waren wirklich eklige, wuselige Geschöpfe.
Hyacinth nahm ihre Schultern zurück, zog ihre Kapuze tief ins Gesicht und verließ auf Zehenspitzen den Raum. Als sie spät am heutigen Abend das Horse and Groom erreicht hatten, war der Hof des Gasthauses mit Kutschen gefüllt gewesen, doch nun saß keine Menschenseele an den Holztischen im Gastraum und auch die Zufahrt war unheimlich still.
Ein seltsamer Anflug einer Vorahnung glitt Hyacinths Rückgrat hinab, doch sie schüttelte ihn ab und hielt auf den offenen Raum zwischen der Hausecke und den Ställen zu. Sie würde eine schnelle Runde im Hof drehen, damit das Blut wieder in ihre steifen Glieder floss, und dann würde sie in ihr Schlafzimmer zurückkehren.
„Ich bin noch immer Schotte genug, um dich für den Rest der Nacht bewusstlos zu schlagen.“
Verwirrt drehte sich Hyacinth zu der Stimme um, doch sobald sie die beiden Männer erblickte, blieb sie stehen.
Sie standen gerade außerhalb eines schwachen Lichtkegels, der aus dem Esszimmerfenster des Gasthauses fiel. Beide hatten dunkles Haar und … große Güte, beide waren Riesen mit Schultern, die sich endlos ausdehnten, und Brustkörben wie Steinmauern. Sie hatten ihre Mäntel beiseite geworfen und umkreisten einander in Hemdsärmeln, doch der feine Schnitt und der teure Stoff wies sie als Gentlemen aus, nicht als Diener oder Stallburschen.
Sie duckte sich in die Schatten neben dem Gasthaus. Ein Instinkt verriet ihr, dass keiner dieser Männer eine Zeugin wollte für das, was zwischen ihnen geschehen mochte.
Der Größere der beiden blickte grimmig, wohingegen der Mund des anderen zu einem spöttischen Grinsen verzogen war, als würde er irgendetwas schrecklich lustig finden. Es schien ihn anzustrengen, aufrecht stehenzubleiben. Hyacinth nahm an, dass er betrunken war, doch er zuckte unbeeindruckt von der Warnung seines Gegenübers mit den Schultern.
„Wie du willst. Zuerst dein Blut und dann seines.“
Selbst im schwachen Licht sah Hyacinth, wie die Schultern des größeren Mannes sich strafften.
„Na los dann.“
Er sprach mit dem Anflug eines Akzents, doch was ein angenehmer, singender Tonfall hätte sein können, wurde von einer Kälte zerstört, die klang, als würde er Eissplitter ausspucken. Kein bisschen Weichheit war in seinem Gesicht und auch kein Anflug von Unschlüssigkeit.
Hyacinth starrte ihn an. In ihrem Magen verspürte sie aufsteigende Übelkeit. Dieser Mann, mit seiner ruhigen Hand und seiner kalten Stimme, würde seinen Gegner ohne zu zögern und ohne mit der Wimper zu zucken bewusstlos schlagen.
Sie schüttelte den Kopf, um einen plötzlichen Schwindel zu vertreiben, und starrte weiterhin wie gebannt auf die Szene vor ihr. Nur Sekunden trennten die Männer von einem Kampf, direkt hier, hinter dem Horse and Groom, und man musste ihnen nur ins Gesicht sehen, um zu wissen, dass dieser Kampf hässlich werden würde.
Doch das war unmöglich, oder? Sie beobachtete, wie die beiden sich umkreisten. Ihre Gedanken waren vor Entsetzen gelähmt. Nichts hiervon ergab Sinn. Gentlemen rissen sich nicht hinter einem öffentlichen Gasthaus gegenseitig in Stücke.
Nur diese beiden Männer, in diesem merkwürdig ruhigen Moment, verborgen im Schatten des Gasthauses …
Sie würden es tun. Sie taten es bereits.
Bereits bevor die Männer aufeinander losgingen, wusste Hyacinth, dass die Auseinandersetzung zwischen ihnen unvermeidlich war. Was auch immer sie an diesen Punkt getrieben hatte, hatte sie nun fest im Griff, und wie bei einem Felsbrocken, der über die Kante einer Klippe fällt, wäre der Fall nicht aufzuhalten, bis es zum Aufprall am Boden kam.
Eine tödliche Stille legte sich über die beiden Männer und Hyacinth hatte gerade noch Zeit, sich zu wünschen, sie wäre bei ihrer Großmutter im Zimmer geblieben, bevor ein wildes Grinsen die Lippen des zweiten Mannes teilte und er nach vorn stürzte. Der Arm des anderen Mannes schnellte so geschwind nach vorn, dass Hyacinth erst begriff, dass er zugeschlagen hatte, als sie ein widerliches Knirschen hörte. Der Kopf des ersten Mannes flog zur Seite und er stolperte zurück. Er taumelte ein paar Schritte, bis er wieder aufrecht stand, und als er das tat …
Oh, lieber Gott.
Hyacinth presste ihre Hand auf ihren Mund, bis ihre Zähne sich in ihre Unterlippe gruben. Sein Gesicht war blutüberströmt. Es schoss in einem roten Strom aus seiner Nase und befleckte sein weißes Hemd. Er hob seinen Unterarm an sein Gesicht, um den Blutfluss zu stoppen. Als er ihn einen Moment später wieder fortnahm, war sein Ärmel blutverschmiert.
„Lassen wir es gut sein, Bruder.“ Der erste Mann sprach ruhig, als hätte er dem anderen nicht soeben die Nase gebrochen. Er stand nun von Hyacinth abgewandt und sie konnte seine harten Muskeln sehen, die sich unter seinem Hemd wölbten und streckten. Seine Schultern hatten sich gelockert und er erschien entspannt, gerade so, als würde er …
Als würde er sich amüsieren.
Ihr Magen rebellierte. Sie ließ ihre Hand von ihrem Mund zu ihrem Bauch sinken und presste sie darauf, denn sie befürchtete, sie müsste sich übergeben.
„Gut sein?“ Der andere Mann spuckte dem ersten einen Mund voll Blut vor die Füße. Er hob den Kopf, sah seinen Gegner an und lachte.
Er lachte.
Blut tropfte von seinem Kinn, und er lachte. „Oh nein. Wir haben gerade erst angefangen.“
Er hob seine Fäuste und stürzte wieder nach vorn. Diesmal gelang es ihm, einen Treffer im Gesicht des anderen Mannes zu landen, gefolgt von einem weiteren in dessen Rippen, der ihn zurücktaumeln ließ.
Hyacinth holte scharf Luft. Ihre Knie zitterten vor Angst. Sicher war das das Ende? Kein Mann konnte solche Schläge einstecken und auf seinen Füßen bleiben.
Noch bevor sie zu Ende gedacht hatte, erlangte der erste Mann sein Gleichgewicht zurück und schloss die Distanz zwischen sich und seinem Gegner mit einem anmutigen Satz. Er versetzte dem anderen Mann zwei harte Schläge in die Magengrube.
Sein Gegner beugte sich mit einem schmerzerfüllten Grunzen vornüber. Dann würgte er und übergab sich auf seine Stiefel.
Der erste Mann hielt seinen Arm dicht an seinem Körper, doch davon abgesehen zeigte er keine Anzeichen von Verletzung.
„Genug?“ Seine Stimme klang jetzt knapp und angespannt. Jeder Anflug von lässiger Höflichkeit war verschwunden. Sein Hemd war durchsichtig vor Schweiß und seine Brust hob und senkte sich schnell.
Der andere Mann mühte sich auf seine Knie. Der Kampf war vorbei, aber zu Hyacinths Entsetzen fluchte der Mann am Boden lästerlich, anstatt zu kapitulieren, und holte mit einem Bein aus. Er traf seinen Rivalen in der Kniekehle. Diesmal ging der größere Mann zu Boden, doch er war ebenso schnell wieder auf den Beinen. Als er wieder zuschlug, war klar, dass er den Kampf ein für alle Mal beenden wollte. Diesmal zeigte er keine Gnade. Dann war es in wenigen Sekunden vorbei, doch es waren die längsten Sekunden in Hyacinths Leben.
Er packte ihn am Kragen, riss ihn mit einem mächtigen Zug auf die Füße und versetzte ihm einen Schlag gegen den Kiefer, der den Mann wieder in die Knie hätte zwingen müssen, doch der erste Mann ließ das nicht zu. Gnadenlos hielt er ihn am Kragen aufrecht, als er seine Faust zum zweiten Mal in sein Gesicht krachen ließ. Schließlich sackte das unglückliche Opfer nach vorn und lag dann reglos auf dem Boden.
War er nur bewusstlos oder …
Hyacinth starrte auf das geprügelte Gesicht des Mannes, auf das Blut, das überallhin gespritzt war und auf die Lache von Erbrochenem, die neben ihm ins Erdreich sickerte. Er war so blass, dass sich das Blut scharf gegen sein Gesicht abzeichnete, das weißer als sein Hemd geworden war.
Sie hielt sich ihren Bauch und beugte sich nach vorn, als wäre sie selbst geschlagen worden. Galle stieg in ihrer Kehle auf, doch in ihrer Angst, der Mann könnte sie hören und sie aus ihrem Versteck holen, schluckte sie sie wieder hinunter.
Oh Gott. Hatte er sie gesehen? Ihr stockte der Atem, als sein Kopf in ihre Richtung schnellte. Mit zusammengekniffenen Augen starrte er in die Dunkelheit. Sie drückte sich an die Wand. Ihre Lippen bewegten sich in einem stummen Gebet.
Bitte, mach, dass er mich nicht gesehen hat. Bitte …
Es war nicht auszudenken, was ein solcher Mann täte, wenn er sie entdeckte. Sie hatte gerade eine blutige, brutale Schlägerei beobachtet.
Eine Schlägerei oder einen Mord.
Ihr gebannter Blick war noch immer auf den Mann am Boden gerichtet. Als sie den anderen Mann wieder ansah, atmete sie erleichtert auf, da er sich wieder abgewandt hatte und den reglosen Körper zu seinen Füßen betrachtete. Er fuhr sich mit der Hand durch sein feuchtes Haar, als würde er überlegen, was er als Nächstes tun sollte.
Letztendlich tat er, was jeder Mörder tut.
Die Leiche verstecken.
Er beugte sich hinab, fasste den hingestreckten Mann unter den Armen und zog ihn aus dem Hof. Noch lange nachdem er verschwunden war, konnte Hyacinth sich nicht regen. Zitternd presste sie sich an die Wand und holte flach und panisch Luft. Ihr Gehirn war vor Entsetzen gelähmt und sie fragte sich bereits, ob sie sich alles nur eingebildet hatte. Doch sie konnte das Blut sehen, die Lache von Erbrochenem und die beiden Spuren, die die Stiefel des Besiegten im Staub hinterlassen hatten, als er fortgezogen worden war. All das konnte sie mit ihren eigenen Augen sehen. Und da waren auch zwei Mäntel, die auf eine Seite des Hofes geworfen worden waren.
Zwei Mäntel.
Wenn sie die Mäntel nicht zufällig bemerkt hätte, wäre sie vielleicht noch stundenlang an der Wand geblieben, starr vor Entsetzen. Doch die Erkenntnis, dass der Mann wegen der Mäntel zurückkommen könnte, veranlasste sie, sich aus ihrem Versteck zu trauen. Rauschendes Blut und ihre eigenen panischen Atemzüge hallten in ihren Ohren wider, als sie zurück zu ihrem Zimmer rannte. Sobald sie es erreicht hatte, eilte sie hinein, warf die Tür zu und lehnte sich erleichtert seufzend dagegen.
„Hyacinth? Bist du das?“ Ihre Großmutter drehte sich im Bett um und blinzelte sie mit schläfrigem, unscharfem Blick an. „Meine Güte, Kind. Du siehst aus, als wärest du einem Geist begegnet.“
„N-nein, es geht mir gut. I-ich …“ Ihr Leugnen wurde zu einem entsetzten Schweigen, als die Wahrheit sie einholte und aufgestellte Nackenhaare und Gänsehaut hinterließ.
Ich hätte genauso gut einen Geist gesehen haben können.
Oder zumindest einen Mann, der gerade zu einem wurde.
„Hyacinth?“
„Es ist schon g-gut, Großmutter. Ich h-hatte nur einen schlechten T-traum, das ist alles. Schlaf weiter.“
Ihre Großmutter murmelte etwas und drehte sich um. Innerhalb von Sekunden schnarchte sie wieder, doch Hyacinth tat in dieser Nacht kein Auge mehr zu. Sie war sich nicht sicher, ob sie überhaupt einmal blinzelte. Mit fest um sich geschlungenen, zitternden Armen lag sie im Bett und starrte stundenlang ins Feuer. Tränen rannen über ihr Gesicht, als sie an den Mann dachte, der zu einer blutigen Masse geschlagen im Schmutz gelegen hatte.
Keine halbe Stunde, bevor er zusammengeschlagen worden war, hatte sie sich gewünscht, dass etwas passierte.
Irgendetwas.
Sie schloss fest die Augen und wünschte sich von ganzem Herzen, sie wäre mit ihren Wünschen vorsichtiger gewesen.