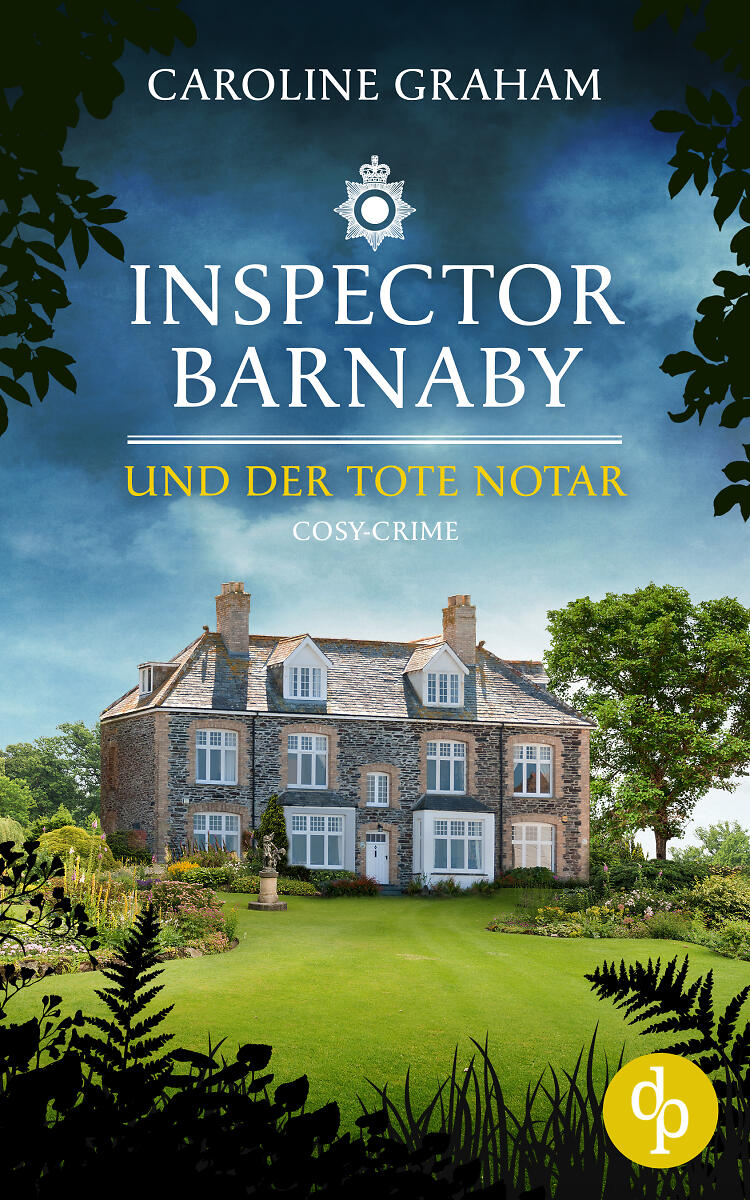1
Mallory Lawsons Tante war einzigartig. Seine ganze Kindheit hindurch hatte Mallory die Schulferien bei ihr verbracht, hatte in ihrem großen, weitläufigen Haus und dem halb verwilderten Garten die unendlichen Möglichkeiten für Abenteuerspiele genutzt. Tante Carey hatte immer instinktiv gewusst, wann er allein gelassen werden wollte und wann er Gesellschaft brauchte. Sie fütterte ihn mit wunderbar fetttriefendem, höchst kalorienreichem Essen, bei dem seine Mutter vor Entsetzen in Ohnmacht gefallen wäre. Und bei der Abreise steckte sie ihm jedes Mal mehr Geld in die Tasche, als er in einem Jahr mit dem Waschen des Familienautos verdiente. Das Beste war, als sie den vierzehnjährigen Mallory eine ihrer kostbaren Havanna-Cohiba-Zigarren bis zu Ende rauchen ließ. Davon war ihm so fürchterlich schlecht geworden, dass er seitdem keinen Tabak mehr anrührte.
Und nun war die alte Dame mit achtundachtzig Jahren friedlich im Schlaf gestorben. Weitsichtig und vorausschauend wie immer hatte sie dies genau in dem Augenblick getan, als ihr geliebter Neffe geistig und körperlich kurz vor dem Zusammenbruch stand. Damals und noch lange danach dachte Mallory, dass ihn diese Erbschaft zu diesem Zeitpunkt davor bewahrt hatte, den Verstand zu verlieren. Ihm vielleicht sogar das Leben rettete.
Die Nachricht vom Tod seiner Tante platzte mitten in einen Familienstreit. Kate, Mallorys Frau, war gerade dabei, all die schwierigen, konfliktträchtigen Punkte anzusprechen, die besorgte Eltern manchmal meinen, ihren Kindern vorhalten zu müssen, auch wenn diese Kinder offiziell Erwachsene sind. Diese Aufgabe war Kate nun schon eine ganze Weile zugefallen. Selbst wenn Mallory seine Tochter nicht vom Tage ihrer Geburt an verwöhnt hätte, fehlte ihm zurzeit die Kraft, um sich auch nur in den kleinsten Streit einzumischen.
Polly hatte gerade ihr zweites Jahr an der LSE, der London School of Economics, im Fach Finanzwirtschaft abgeschlossen. Obwohl das Haus der Lawsons nur eine Viertelstunde mit der U-Bahn von der LSE entfernt war, hatte sie darauf bestanden, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Im ersten Jahr wohnte sie in einem Studentenheim. Dann, nach den langen Semesterferien, hatte sie ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Dalston gefunden. Die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern reichte für Miete, Essen und ein bescheidenes Taschengeld.
In den ersten zwölf Monaten hatten ihre Eltern Polly kaum gesehen. Mallory hatte das schrecklich gekränkt, aber Kate hatte es verstanden. Ihre Tochter stand an der Schwelle zu einer neuen Welt, einem neuen Leben. Kate betrachtete es als Erfolg, dass es Polly kaum erwarten konnte, auf das höchste Sprungbrett zu klettern, sich die Nase zuzuhalten und in die Tiefe zu springen. Polly war klug, ausgesprochen hübsch und selbstbewusst. Psychologisch gesprochen konnte sie schwimmen. Aber finanziell? Nun, das war etwas anderes. Und genau darum ging es bei dieser Zusammenkunft.
Denn jetzt hatte Polly offenbar vor, erneut umzuziehen. Sie hatte eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern in Shoreditch aufgetan. Und sie hatte die Absicht, die Schlafzimmer zu vermieten, um davon die Miete zu bezahlen. Die Agentur wollte drei Monatsmieten als Kaution, die bei Kündigung zurückgezahlt wurde, und ein Viertel der Miete im Voraus.
»Und wo schläfst du?«, fragte ihre Mutter.
»Es gibt einen kleinen Raum, in den genau ein Futon reinpasst – tagsüber kann ich ihn zusammenrollen. In Japan machen das alle.« Die immer ungeduldige Polly holte langsam und tief Luft. Die Diskussion, die bereits eine halbe Stunde andauerte, verlief schwieriger, als sie erwartet hatte. Wenn nur ihre Mutter nicht da wäre. »Schau nicht so entsetzt. Ich schlafe ja schließlich nicht auf der Straße.«
»Ist die Wohnung möbliert?«
»Nein …«
»Dann brauchst du also außerdem noch Geld …«
»Ich koste euch weniger, verdammt noch mal!«
»Sprich nicht so mit deiner Mutter, Polly!« Mallory runzelte die Stirn, wobei sich die tiefen Furchen zwischen seinen Augenbrauen zusammenzogen. Seine Finger zupften nervös an seinen Manschetten. »Sie macht sich Sorgen um dich.«
»Aber versteht ihr denn nicht, was es heißt? Ihr braucht meine Miete nicht mehr zu bezahlen!«
»Du machst das also für uns?«
»Kein Grund, ironisch zu sein.«
Kate hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Warum bin ich nur so?, fragte sie sich. Mallory ist immer geduldig mit ihr – er hört zu, hat Verständnis. Er gibt meistens nach und wird dafür umarmt und geküsst. Aber Kate – die kleinste Kritik von ihr, jeder Versuch, sich gegen unvernünftige Forderungen zur Wehr zu setzen oder zumindest ein klein wenig Regelmäßigkeit und Disziplin zu erreichen, hatte bei Polly, schon als sie klein war, zu dem ständigen Vorwurf geführt, ihre Mutter habe sie nie wirklich geliebt. Kate kam es meistens umgekehrt vor. Dennoch war ihre Bemerkung nicht angebracht gewesen. Sie wollte sich schon entschuldigen, als Mallory das Wort ergriff.
»Was die Einrichtung angeht …«
»Einrichtung! Ich habe nicht vor, zu Heal’s zu gehen. Nur auf Flohmärkte und in Trödelläden.«
»Du kannst doch nicht zweihundert Pfund pro Woche für ein möbliertes Zimmer voll Gerümpel verlangen …«
»Das sind keine möblierten Zimmer!« Polly hielt inne, atmete tief und zählte laut bis zehn. »Ich habe dir schon gesagt – es wird eine Wohngemeinschaft.«
Kate zögerte. Sie hatte immer geglaubt, Wohngemeinschaften seien billiger als möblierte Zimmer. Und wollten die Leute normalerweise nicht nur eine Monatsmiete Kaution?
»Außerdem weißt du gar nichts über die Flohmarktkultur. Die Leute schmeißen die erstaunlichsten Sachen weg.«
»Wir müssen uns die Wohnung mal anschauen«, sagte Kate.
»Warum denn?« Und dann, als ihre Mutter sie erstaunt ansah: »Ich will doch nur läppische zehntausend Pfund. Ich zahl sie zurück, mit Zinsen, wenn ihr wollt.«
»Mach dich doch nicht lächerlich.«
»Und was macht dir das aus? Es ist ja nicht dein Geld!« Könnte es aber sein, dachte Kate. Denn sie arbeitete praktisch immer noch ganztags. Aber das war nicht das Problem. Sie machte sich darüber Sorgen, wofür das Geld in Wirklichkeit war. Erst vor ein paar Tagen hatte sie im Radio eine Sendung gehört, in der gesagt wurde, dass ungefähr siebzig Prozent der in der Innenstadt zirkulierenden Banknoten Spuren von Kokain aufwiesen. Wenn Polly, Gott behüte, das Geld dafür brauchte …
»Es wäre aber schon ganz nett zu sehen, wo du wohnen wirst, Liebling.« Mallory versuchte, die Situation zu entspannen.
»Die Sache ist nur die …« Polly sah ihre Eltern offen an, schaute ihnen treuherzig direkt in die Augen. Sie wusste nicht, dass genau dieser Blick für ihre Mutter, seit Polly klein war, ein untrügliches Zeichen dafür war, dass sie log. »Es wohnen noch Leute drin. Die Wohnung wird erst in ein paar Wochen frei.«
Kate sagte: »Ich verstehe immer noch nicht, warum …«
»Ich will was Größeres, okay? Mehr Platz!«
»Aber wenn ihr zu dritt da wohnt …«
»Ach, Mist. Ich habe es satt, wie eine Kriminelle ins Kreuzverhör genommen zu werden. Wenn ihr mir das Geld nicht leihen wollt, dann sagt es doch einfach, und ich bin weg.«
»Kommt mir bekannt vor.«
»Was soll das denn jetzt heißen?«
Diese Bemerkung war der Auftakt zu einer langen Tirade darüber, wann jemals einer von ihnen in ihrem ganzen selbstsüchtigen Leben einem anderen Menschen wirklich geholfen oder sich ernsthaft für ihn interessiert habe. Und jetzt hatten sie die Chance, jemandem zu helfen, ihrer einzigen Tochter, aber sie hätte es wissen müssen – sie seien ja schon immer so widerlich knauserig gewesen. Na gut, dann würde sie sich das Geld eben von der Bank borgen müssen, und wenn sie dann hoffnungslos verschuldet wäre, weil die Zinsen so astronomisch hoch …
Und in diesem Moment klingelte das Telefon. Der Anrufbeantworter der Lawsons, der sich, auch wenn sie zu Hause waren, immer einschaltete, piepte und pfiff. Man hörte verzweifeltes Weinen und Schluchzen.
»Das ist Benny!« Mallory eilte zum Telefon. Hörte zu und antwortete beruhigend. Seine Frau und seine Tochter sahen, wie sich in seinem Gesicht plötzlich Schock und Kummer breitmachten, und ihr Ärger löste sich in Luft auf.
Die Beerdigung fand an einem ziemlich windigen Sommernachmittag statt. Die volle Kirche leerte sich langsam, und der Organist spielte »Der Tag, den du uns gabst, o Herr, ist nun zu Ende«. Mallory, Kate und Polly nahmen die Beileidsbekundungen entgegen.
Fast das ganze Dorf war erschienen, ebenso alle Freunde und Verwandte von Tante Carey, sofern sie noch am Leben waren. Ein älterer Mann im Rollstuhl war sogar aus Aberdeen gekommen. Mallory war von der tief empfundenen Trauer der Anwesenden gerührt, aber nicht überrascht. Es war vielleicht nicht immer einfach gewesen, seine Tante zu lieben, aber sie nicht zu mögen, war fast unmöglich.
Die Lawsons standen noch eine Weile am Grab, während alle anderen entweder nach Hause oder zum Appleby House hinübergingen. Und Mallory, der immer geglaubt hatte, dass sich der Tod eines Menschen, der ein langes und weitgehend glückliches Leben gehabt hatte, leichter ertragen ließe, musste feststellen, dass er sich geirrt hatte. Dennoch war er froh, dass der Tod so plötzlich gekommen war, auch wenn er bedauerte, dass ihm dadurch die Möglichkeit genommen war, sich zu verabschieden. Mit einem langsamen und schmerzhaften Verfall wäre Carey nicht gut zurechtgekommen. Er spürte, dass Kate, die die alte Dame sehr geliebt hatte, still weinte. Polly, die nur anwesend war, um, wie sie es nannte, »emotionales Armdrücken« zu betreiben, stand ein paar Meter von ihren Eltern entfernt und versuchte, mitfühlend auszusehen, während sie ungeduldig auf ihrer Unterlippe herumkaute. Wirkliche Trauer empfand sie nicht, denn sie hatte ihre Großtante mehrere Jahre nicht mehr gesehen, und eigentlich wollte sie auch keine Trauer vortäuschen, nur um anderen einen Gefallen zu tun.
Langsam traten sie den Rückweg nach Appleby House an, wo gebratenes Fleisch und Apfelwein aus Steinkrügen gereicht wurde. Der Wein stammte aus den Früchten des Apfelgartens, der dem Haus seinen Namen gab. Alles war von Benny Frayle organisiert worden, einer Freundin der Verstorbenen. Benny hatte jede Hilfe abgelehnt. Sie suchte verzweifelt eine Aufgabe, um die ersten Tage auszufüllen. Die schwersten Tage. Sie hatte gewuselt, gerackert und geackert wie ein kummergebeutelter Derwisch, der nie zur Ruhe kam.
Obwohl die Flügeltüren zwischen den großen Räumen im Erdgeschoss offen standen, strömten die Leute auf die Terrasse und in den Garten hinaus. Zwei Mädchen aus dem Dorf in Jeans und Oasis-T-Shirts reichten Tabletts herum, auf denen knödelartige, dunkelbraune Teilchen und gräuliche Hefezöpfe lagen. Die meisten Leute tranken etwas, aber der alkoholfreie Früchtepunsch war kaum angerührt worden. Offensichtlich bevorzugten die meisten den selbst gemachten Apfelwein. Das war in Ordnung. Der Großteil der Trauergäste konnte sowieso zu Fuß nach Hause gehen, und die von außerhalb würden mit dem Taxi zu ihrem Hotel im nahe gelegenen Princes Risborough fahren.
Es lässt sich nicht verhehlen, dass sich die meisten Anwesenden gut amüsieren, dachte Kate, als sie die keineswegs ordentlich gekleidete Menge um sich herum betrachtete. Was ist so besonders an Beerdigungen? Die nahe liegende Antwort – alle Anwesenden waren sich plötzlich dankbar bewusst geworden, dass sie noch am Leben waren – war bestimmt nicht das ganze Geheimnis. Trauer hatte sicher mehrere Gesichter. Da war zum Beispiel Mrs. Crudge, seit dreißig Jahren Putzfrau im Appleby House. Noch vor ein paar Stunden hatte sie sich in der Küche die Seele aus dem Leib geheult. Jetzt lächelte sie, plauderte und zupfte dabei nervös an den Falten des schwarzen Schleiers, den sie ungeschickt an einen formlosen Filzhut gepinnt hatte.
Die Lawsons waren seit fünf Tagen in Forbes Abbot. Kate, die Mallory ein Glas Wein brachte, bemerkte bereits eine Veränderung bei ihm. Sie war winzig nach so kurzer Zeit – niemandem sonst würde sie auffallen –, aber als sie seinen Unterarm berührte, gaben die Sehnen, die, seit sie denken konnte, immer straff gespannt wie Violinsaiten waren, ein wenig unter ihrer Hand nach.
»Das Zeug ist absolut tödlich«, sagte Mallory, nahm aber trotzdem ein Glas. »Das kenne ich von früher.«
»Meinst du, wir sollten alle begrüßen?«, fragte Kate.
»Als Hauptleidtragende finde ich, dass die Leute zu uns kommen und an uns vorbeidefilieren müssen«, sagte Polly.
»Wie bei einer griechischen Hochzeit.«
Wenn sie lange genug still mit einem süßen Lächeln dastand, würde vielleicht jemand kommen, und ihr Geld zustecken. Es müsste allerdings viel Geld sein, denn sie hatte hohe Schulden. Sehr hohe Schulden. Zusammen mit den Zinsen wurde es jeden Tag, wenn nicht jede Stunde furchtbarer. Die Schulden schwollen an wie ein monströser Dämon im Glas. Ärgerlich versuchte Polly, ihre Gedanken wieder in die Gegenwart zurückzuzwingen. Sie hatte sich geschworen … was? Angst? Nein, Polly hatte nie Angst gehabt. Sagen wir einfach, sie hatte sich geschworen, sich das Bild der Schlange Billy Slaughter vom Leib zu halten. Vierschrötig, mit glanzlosen Augen, widerlich anzufassen. Erinnerung an einen Kinderreim: »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand! Wenn er aber kommt …«
Polly bemühte sich, ihre Gedanken in den Griff zu bekommen, sie zu zähmen und abzustellen. Sie zwang sich, sich auf die versammelte Menge zu konzentrieren. Sie nahm jedes Detail in sich auf – Kleidung, Schmuck, Verhalten, Stimmen – und kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Anwesenden um einen Haufen echter Verlierer handelte. Durchschnittsalter siebzig; eher ausgepolstert als angezogen und mit Kukident zusammengehalten. Bei der Vorstellung von all den klappernden Gebissen musste Polly laut auflachen.
»Polly!«
»Ups. Entschuldigung. Entschuldigung, Dad.«
Er sah richtig empört aus. Polly war plötzlich voller Reue und nahm sich vor, es wiedergutzumachen. Was würde ihn am meisten freuen? Ihn stolz auf sie machen? Sie beschloss, sich unters Volk zu mischen. Und nicht nur das, sie würde auch super charmant zu allen sein, egal wie altersschwach oder schwerhörig sie auch sein mochten. Und wenn das ihren Vater das nächste Mal, wenn sie um Hilfe bat, aufgeschlossener machen würde – nun, dann wäre das auch nicht schlecht. Ihr Gesichtsausdruck verwandelte sich, drückte leidendes Mitgefühl aus. Ihr Lächeln war fast spirituell. Sie murmelte ihren Eltern »Bis später!« zu und verschwand in der Menge.
Polly kannte kaum jemanden der Anwesenden, obwohl sich einige daran erinnerten, wie sie als kleines Mädchen ihre Großtante besucht hatte. Mehrere ließen sich lang und breit darüber aus. Einmal saß sie fünf Minuten lang neben einer sehr exzentrischen Cousine von Carey, beugte sich ehrfürchtig zu ihr hinüber und merkte sich die Sätze und Marotten der alten Dame, in der Absicht, sie später zur Unterhaltung anderer nachzuahmen.
Der Vikar kreuzte auf – eine stattliche Erscheinung undefinierbaren Alters. Er hatte volles, weiches, hellbraunes Haar, das manchmal in der Haarspraywerbung als wehend bezeichnet wird. Im Moment tat es jedenfalls sein Bestes, es hob und senkte sich über seinem Kopf wie ein lebendiger Heiligenschein. Der Pfarrer legte seine feuchte Hand auf Pollys Handgelenk.
»Können Sie sich das vorstellen, meine Liebe, Mrs. Crudge hat mich gerade gefragt, ob ich mich hier auch gut unterhalte!« Polly versuchte ein ungläubiges Gesicht zu machen, was ihr allerdings schwerfiel. Sie fand die Frage erstens harmlos und
zweitens passend.
»Was ist bloß aus dem Wort ›Totenwache‹ geworden?«
»Ich verstehe nicht …«
»Eben! Völlig ›aus der Mode‹ heutzutage!« Er angelte sich die Anführungszeichen mit seiner freien Hand aus der Luft.
»Und doch so metaphysisch passend. Denn in dem Wort Totenwache ist der glückliche Zustand enthalten, in dem sich unsere liebe Mrs. Lawson derzeit befindet: wach in den Armen ihres Himmlischen Vaters.«
O Gott, dachte Polly. Sie schob die Hand des Vikars von ihrem Arm.
»Schaut euch Polly an.« Mallorys Stimme klang zärtlich. Seine Tochter hatte ihr gedankenloses Benehmen von vorhin wohl schon mehr als wettgemacht.
»Ich habe das Gefühl, die Leute haben sowieso fast nur Augen für Polly.«
Das stimmte. Fast alle – und nicht nur Männer – beobachteten Polly unauffällig. Vor allem betrachteten sie ihre schlanken, endlos langen Beine in den glänzenden schwarzen Strumpfhosen. Sie trug außerdem ein langes schwarzes Leinenjackett und offenbar nichts darunter. Normalerweise trug Polly Röcke, die nicht länger als eine Tortenmanschette waren, heute war ihr Rock – zweifellos wegen des ernsten Anlasses – irgendwie länger als sonst. Dieser hätte fast für einen Blumentopf gereicht.
Kate schämte sich etwas und hatte das Gefühl, ihr knapper Kommentar habe Verachtung oder sogar Neid auf ihre Tochter offenbart. Aber das konnte doch nicht sein? Als ein kleiner rotblonder Mann über den Rasen auf sie zukam, begrüßte sie ihn mit einem befreiten Lächeln, froh über die Ablenkung.
»Dennis!«, sagte Mallory herzlich. »Schön, dich zu sehen!«
»Wir sprechen uns ja morgen, wie ihr wisst. Aber ich wollte euch mein Beileid ausdrücken. Mallory, mein lieber Freund.« Dennis Brinkley streckte die Hand aus, deren Rückseite mit rotgoldenen Härchen übersät war. »Deine Tante war wirklich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit.«
»Soll ich dir das abnehmen?« Kate bot Dennis an, ihn von seinem halb vollen Teller zu befreien. Sie hatte den Walnussstrudel und die Wurstkringel in der Küche probiert, als Benny sie vorbereitet hatte.
»Nein, auf keinen Fall.« Dennis hielt seinen Teller fest.
»Das esse ich alles ganz und gar auf.«
Dann bist du der Einzige, der das tut, dachte Kate. Wir werden wahrscheinlich noch in ein paar Jahren Kringel und Strudelteile in den Blumentöpfen und im Gebüsch finden. In späteren Jahrhunderten werden Archäologen an den außergewöhnlichen Formen schaben und sich verwirrt fragen, wozu diese je gebraucht wurden. Kate, die Bennys Kochkünste schon lange kannte, hatte bei Marks & Spencer vorsorglich noch mehrere Packungen Partyhäppchen besorgt und Benny extra darauf hingewiesen, dass diese nur für den Notfall gedacht seien. Bevor sie in die Kirche gingen, hatte sie das Gebäck heimlich auf einen Abstelltisch im Gebüsch gestellt. Lange vor ihrer Rückkehr war alles verschwunden.
Mallory dankte Dennis für seine Hilfe nach Careys Tod. Dass er den, wie er es nannte, »ganzen technischen Kram« übernommen hatte. Ihm fiel auch auf, wie fit und vital Dennis wirkte. Dennis war neun Jahre älter als er, aber Mallory hatte den Eindruck, dass ein Fremder durchaus falsch raten könnte, wer von ihnen der Ältere war.
Mallory war elf Jahre alt gewesen, als Dennis Brinkley das erste Mal ins Haus seiner Tante gekommen war, um einige Details ihrer Auslandsinvestitionen zu überprüfen. Er war gerade erst bei einer Makler- und Finanzberatungsfirma angestellt, war extrem intelligent und redegewandt, wenn es um Zahlen ging, aber sonst schrecklich scheu. Die Firma hieß damals Fallon & Pearson, obwohl Letzterer längst gestorben war. Als sich George Fallon zur Ruhe setzte, war Dennis bereits dreißig Jahre in der Firma, zwanzig davon als gleichberechtigter Partner. In dieser langen Zeit hatte er sich zwangsläufig mehr geöffnet und an Selbstbewusstsein gewonnen, aber es gab immer noch nur sehr wenige Menschen, denen er wirklich nahestand. Mallory war einer davon. Benny Frayle ein anderer.
»Passt dir ein Termin am Morgen, Kate? Ich glaube, es gibt eine Menge äh … zu klären.« Dennis klang vage, als sei er nicht sicher, was »klären« beinhaltete. Er selbst war extrem ordentlich und klar, privat wie geschäftlich. Seine Putzfrau – eben jene Mrs. Crudge, die auch bei Carey geputzt hatte – und seine ausgezeichnete Sekretärin hatten selten viel zu tun.
Kate versicherte ihm, dass ihr der nächste Morgen recht sei.
Ein plötzlicher Ausbruch von rauer Fröhlichkeit, der schnell mit vielen Psst! zum Schweigen gebracht wurde, ließ alle drei die Köpfe drehen.
»Ah«, sagte Mallory. »Ich sehe, dass Drew und Gilda netterweise doch noch gekommen sind, um ihre Aufwartung zu machen.«
»Ich habe sie nicht eingeladen, das versichere ich euch.«
Die Abwesenheit von jedweder Herzlichkeit in Dennis’ Stimme sagte alles. Andrew Latham war der andere Partner der Firma, die nun Brinkley & Latham hieß. Er hatte nie irgendetwas mit Mallorys Tante zu tun gehabt. Da sie selten ins Büro gekommen war, waren sie sich wahrscheinlich sogar nie begegnet.
»Er hat zweifellos seine Gründe.« Mallorys Ton war ebenfalls kühl.
»O ja. Die hat er bestimmt.«
Kate murmelte eine Entschuldigung und wandte sich wieder der versammelten Gesellschaft zu, nicht um noch mehr tröstende Worte zu hören, sondern eher in der Hoffnung, sich irgendwie nützlich machen zu können.
Sie sah, dass David und Helen Morrison allein herumstanden und ziemlich verloren wirkten. Sie kamen von Pippins Direct, der Firma, die in den letzten zwanzig Jahren Careys Apfelgarten gepachtet hatte, ihn pflegte und die Äpfel und den Saft verkaufte. Kate wusste, dass Mallory viel daran lag, dieses Arrangement beizubehalten. Als sie sich aber auf den Weg zu ihnen machte, kam ihr ein anderes Paar zuvor. Sie stellten sich vor und die vier begannen ein Gespräch.
Eines der Oasis-T-Shirts saß unter einer Konifere, trank Apfelwein und tat das offenbar schon eine ganze Weile. Kate seufzte und hielt nach dem anderen Mädchen Ausschau, das offenbar verschwunden war. Sie konnte jedoch Bennys Perücke mit den dicken goldenen Locken sehen, die wie Würste aus Messing herunterbaumelten. Benny sammelte erhitzt und aufgeregt Teller und Gläser ein und stapelte sie auf ein Tablett in der Nähe.
»Mutter!« Polly sprang auf, als Kate herankam, und überließ Brigadier Ruff-Bonney, den älteren, an den Rollstuhl gefesselten Verwandten aus Aberdeen, sich selbst. Sie unter-brach den armen Mann, der gerade anschaulich seine Graue-Star-Operation unter örtlicher Betäubung schilderte, mitten im Satz.
»Es war so nett, mit Ihnen zu plaudern.« Polly schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln, nahm Kate am Arm und zog sie fort. »Hoffentlich sterbe ich, bevor ich alt werde!«
»Das sagt man nur, solange man jung ist. Hast du das Mädchen gesehen, das helfen soll?«
»Meinst du die, die sich gerade unter der Konifere volllaufen lässt?«
»Nein, ich meine die andere.«
»Nein.«
»Jemand sollte der armen Benny helfen.«
So lange Polly zurückdenken konnte, war Benny Frayle die »arme Benny« gewesen. Als kleines Mädchen hatte sie die Worte zusammengezogen und geglaubt, das sei Bennys wirklicher Name. Als Kate das eines Tages zufällig hörte, klärte sie Polly auf und bat sie, es nie wieder zu sagen, da es verletzend sein könnte.
Jetzt beobachtete Polly ihre Mutter, wie sie der Freundin ihrer Großtante Carey ein schweres Tablett abnahm. Sie bemerkte, wie beiläufig Kate das machte, ohne großes Theater, ohne irgendwie zu unterstellen, dass sich Benny vielleicht zu viel vorgenommen hatte. Darin war sie wirklich gut. Polly konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Mutter jemals mit Absicht jemanden erniedrigen oder seine Schwachstelle suchen würde, um dann zuzustechen. Ihr Vater übrigens auch nicht.
Manchmal rätselte Polly, die derlei meisterhaft beherrschte, woher sie das wohl hatte.
»Warte, ich helfe dir«, rief sie Kate, die gerade in Hörweite vorbeiging, aus einem Impuls heraus zu, bereute es aber sofort, wie alle Entscheidungen, die mit Arbeit verbunden waren. Aber wenigstens war sie auf diese Weise außer Reichweite des alten Tattergreises. Mal ehrlich: Für den einen oder anderen schien sich der Weg zurück vom Friedhof kaum noch zu lohnen.
»Fein«, rief Kate zurück und versuchte, nicht überrascht zu klingen. »Dann bis gleich.«
Sie ging durch den Gemüsegarten und über den Krocketrasen auf das Haus zu. Die Küche öffnete sich zu einem ziemlich großen Wintergarten mit eisenverstrebten Fenstern im Stil Edwards des VII. Einige Leute, die Kate alle nicht kannte, lümmelten leicht komatös auf Deckstühlen und einem riesigen Rattansofa. Kate lächelte ihnen freundlich und warmherzig zu, als sie über ihre Füße kletterte.
Die Küche war bis auf Croydon, Tante Careys Katze, leer. Croydon schlief in seinem Körbchen, an das Benny eine schwarze Seidenschleife gebunden hatte. Kate erinnerte sich noch an den Tag, an dem Carey das Tier heimgebracht hatte. Mallorys Tante hatte eine Freundin besucht und musste in Croydon umsteigen, wo sie die Katze in einem Weidenkörbchen hinter einem Stapel Holzkisten versteckt fand. Sowohl der Korb als auch die Katze waren total verdreckt. Carey beschrieb später, mit welcher Würde sich die halb verhungerte Kreatur in dem Dreck aufgesetzt, hoffnungsvoll um sich geschaut und miaut hatte.
Nachdem Carey zehn Minuten lang mit den Eisenbahnangestellten herumgebrüllt hatte, nahm sie ein Taxi in die Innenstadt, kaufte einen Korb, Katzenfutter, einen Napf und ein paar Handtücher, verzichtete auf die Weiterreise und nahm die Katze mit nach Hause. In sauberem Zustand erwies sich das Tier als außergewöhnlich schön mit einem beige und bernsteinfarben gemusterten Fell, einer orange-rötlichen Halskrause und riesigen goldenen Augen. Croydon zeigte sich so dankbar wie es einer Katze nur möglich ist – was zugegebenermaßen nichts heißen will. Sie schnurrte ausgiebig und setzte sich Carey immer dann auf den Schoß, wenn sie an ihrem Wandteppich arbeiten oder Zeitung lesen wollte.
Kate bückte sich und streichelte Croydon. Sie sagte: »Sei nicht traurig«, aber die Katze gähnte nur. Es war schwer zu sagen, ob sie traurig war oder nicht. Katzengesichter verändern sich nicht sehr.
Kate zog sich Gummihandschuhe an, spritzte etwas Spülmittel ins Becken und drehte die Hähne voll auf. Die Gläser waren ziemlich wertvoll, und sie wollte nicht riskieren, sie in die Geschirrspülmaschine zu stecken. Als das Spülbecken halb voll war, tauchte sie sie sanft in die Lauge und wusch sie vorsichtig ab. Von Polly war nichts zu sehen. Kate hatte das auch nicht ernsthaft angenommen. Warum also das Angebot? Und was machte Polly stattdessen?
Obwohl sie sich wegen der Kleinlichkeit eines solchen Manövers schalt, ging Kate durchs Esszimmer zurück auf die Terrassenstufen. Sie entdeckte Polly gleich auf einem niedrigen Holzschemel, sah sie reden, lachen, sich die Haare aus dem Gesicht schütteln. Sie hockte neben Ashley Parnell, dem unmittelbaren Nachbarn von Appleby House, der in einem grün-weiß gestreiften Liegestuhl lag; er ruhte, was er meistens tat, da sein Gesundheitszustand keine großen Sprünge erlaubte. Aber aus der Ferne betrachtet war seine Schönheit immer noch bemerkenswert, so krank er auch war. Kate beobachtete, wie er Polly antwortete, die sofort ganz aufmerksam war und ihm tief in die Augen blickte. Sie stützte das Kinn in die Hand und beugte sich vor.
Kate sah, wie sich Ashleys Frau Judith auf das Paar zubewegte, und das ziemlich schnell, als habe sie es eilig. Sie stellte sich vor die beiden, unterbrach brüsk ihre Unterhaltung und deutete auf den Weg. Halb half sie ihrem Mann, halb zerrte sie ihn aus dem Liegestuhl, und beide gingen weg, wobei Ashley sich mit einem Abschiedslächeln umdrehte.
Polly winkte, stand dann sofort auf und legte sich nun selbst in den frei gewordenen Liegestuhl. Lange bewegte sie sich gar nicht. Sie lag einfach nur da und starrte in den klaren blauen Himmel hinauf.
Erst eine halbe Stunde später erholte sich Judith Parnell langsam, obwohl sie sich immer noch ein bisschen wacklig fühlte.
»Tut mir leid, dass ich dich – weggezerrt habe. Ich habe mich wirklich komisch gefühlt.«
»Geht es dir jetzt besser?«
»Ja. Ich brauchte bloß eine Pause.«
Judith schaute zu ihrem Mann hinüber, der trotz der Hitze mit einer Angoradecke über den Beinen in einem Korbstuhl mit hoher Lehne saß. Er starrte, ziemlich sehnsüchtig, wie sie fand, über ihren Vorgarten hinweg in Richtung Appleby House.
Judith betrachtete seine glänzenden, dunkelblauen Augen, die feinen glatten Wangen, das perfekte Kinn, und nun wurde ihr wirklich ein bisschen übel. Bis jetzt waren die Auswirkungen seiner mysteriösen Krankheit nur geringfügig. Aber es war auch erst drei Monate her, seit die ersten Symptome aufgetaucht waren. Judith konnte nicht anders, sie durchquerte den Raum und legte ihm die Hand auf sein weiches hellblondes Haar. Ashleys Kopf zuckte zurück.
»Entschuldige, Liebling.« In letzter Zeit waren ihm Berührungen unangenehm. Judith vergaß das oft und erinnerte sich jetzt, dass sie schon beim Frühstück versucht hatte, seine Hand zu halten.
»Nein, mir tut es leid.« Er umschloss ihre Finger mit seiner Hand und drückte sie sanft. »Meine Kopfhaut tut heute weh, das ist alles.«
»Armer Ash.«
War das wirklich der wahre Grund? Gehörte eine empfindliche Kopfhaut zu den Symptomen seiner Krankheit? Da man immer noch nicht herausgefunden hatte, was für eine Krankheit es überhaupt war, ließ sich das unmöglich sagen. Er konnte sich das ausgedacht haben, es benutzen, um sie auf Distanz zu halten. Vielleicht liebte er sie nicht mehr.
Es gab eine Zeit, da hätte sie ihn überall und an jeder Stelle berühren können, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Einmal hatten sie Sex in seinem Büro auf dem Schreibtisch bei nicht abgeschlossener Tür, kurz bevor eine japanische Geschäftsdelegation hereingeführt werden sollte. Und jetzt hatte er sich ihr schon wochenlang nicht mehr genähert.
Judith würde niemals irgendjemandem gegenüber zugeben, dass sie froh über Ashleys Krankheit war. Auch sich selbst hatte sie es nur einmal in einem schmerzhaften Augenblick scharfsinniger Einsicht eingestanden. Krank bedeutete: aus dem Verkehr gezogen. Sie wollte, dass es ihm besser ging – natürlich wollte sie das –, aber vielleicht nicht hundertprozentig besser. Nicht wiederhergestellt zu seiner früheren apollonischen Form und Schönheit, denn dann wäre sie wieder in der alten Tretmühle. Würde eifersüchtig jede Frau einschätzen, die er ansah oder ansprach, würde immer alles an ihnen abwerten müssen: ihre Haare, ihre Haut, ihre Augen, ihre Kleider. Nicht laut, natürlich. Es wäre nicht gut, wenn Ashley merkte, dass sie furchtbare Angst hatte, ihn zu verlieren; das würde ihn womöglich erst darauf bringen.
Judiths Gedanken wanderten nervös zu der Trauerfeier in Carey Lawsons Garten zurück. Trotz seiner Müdigkeit schien Ashley sich richtig gefreut zu haben, draußen zu sein und sich unter die Leute zu mischen. Und er war richtig traurig gewesen, als sie ihn, unter dem Vorwand eines plötzlichen Anfalls von Übelkeit, nach Hause gezerrt hatte. Das lag natürlich daran, dass die grässliche Tochter der Lawsons ihn mit ihren Beinen und ihrem Lächeln bezirzt hatte, halb nackt wie eine Nutte im Bordell. Provozierend eigentlich, denn was für ein Interesse konnte ein kränkelnder Mann in mittleren Jahren schon an einem jungen, starken, reizenden Mädchen haben …? Judith bemühte sich, ruhig zu bleiben, atmete langsam und gleichmäßig. Sie hatte ihn weggezogen, das war die Hauptsache. Das Mädchen war zur Beerdigung hier, in ein oder zwei Tagen würde sie fort sein.
Aber es ging das Gerücht im Dorf, dass ihre Eltern vielleicht für immer herziehen würden. Dann würde Kate mit ihrer sommersprossigen Aprikosenhaut und ihrem weichen, aschblonden, meist irgendwie hochgesteckten Haar nur einen Steinwurf entfernt wohnen. Obwohl sie schon Ende vierzig war, sah sie trotz der harten Zeiten, die sie mit Mallory durchgemacht hatte, gute zehn Jahre jünger aus. Ashley hatte Kate immer gemocht. Sie war sanft und intelligent, ziemlich sexy auf so eine Schulmädchenart – ach Mist!
»Was ist los?«
»Nichts.«
»Wirklich?« Ashley sah besorgt aus. Er fing an, nervös über die Haut seiner Arme zu streichen. »Vielleicht könntest du das Treffen heute Abend verschieben, Jude. Sag, dass du dich nicht wohl fühlst.«
»Lieber nicht. Es ist ein neuer Kontakt. Ich will keinen schlechten Eindruck machen.«
»Was macht er gleich wieder?«
»Er stellt chirurgische Instrumente her. Es ist eine kleine Firma, aber offenbar stabil. Es sieht so aus, als ob sein Buchhalter in Rente geht, deshalb sucht er Ersatz.«
»Ist es nicht komisch, dass ihr euch nicht in der Fabrik trefft?«
»Überhaupt nicht. Geschäftsbesprechungen finden oft in Hotels statt.«
In diesem Moment fing das Fax in Judiths Büro, einem kleinen dunklen Verschlag neben der Treppe, zu rattern an. ›Besuchersalon‹ hatten sie es spaßhaft getauft, als sie in ihr viktorianisches Landhaus eingezogen waren. Wo einst die Oberschicht ihre Visitenkarten gezeigt und dann trockenen Sherry und Kümmelcracker gereicht bekam, bevor man in den größeren Salon spazierte, um diskreten Klatsch auszutauschen. Sie hatten sich auch vorgestellt, auf bescheidene Art Gäste zu empfangen, aber irgendwie war es nie dazu gekommen. Und jetzt, wo jeder Penny in Ashleys Gesundheit investiert wurde, konnten sie es sich nicht mehr leisten.
»Ich weiß, von wem das ist.« Sie ging vom Fenster weg und vergrößerte damit den Abstand zwischen sich und ihrem Mann. Gab Ashley, was er »Raum zum Atmen« nannte. »Es ist von Alec, dem Schleimer.«
»Spricht man so von einem Klienten?«
»Er faxt seine getürkten Ausgaben. Will einen neuen Alfa Romeo, weil seiner, kaum ausgeliefert, schon geklaut wurde. Leider …«
»… waren die Papiere noch im Handschuhfach.«
»Du weißt mehr als ich.«
»Sag ihm doch einfach, er soll dich in Ruhe lassen.«
Judith ging zögernd in die Diele und wunderte sich über die beiläufige Leichtigkeit, mit der er diese Lösung vorgeschlagen hatte. Es war nicht Ashleys Fehler. Er hatte keine Ahnung, wie schwierig, ja sogar verzweifelt die Lage geworden war. Er dachte, seine Frau habe ihr Büro in Aylesbury aufgegeben und ihre Sekretärin nur entlassen, damit sie von zu Hause aus arbeiten und für ihn sorgen konnte. Aber das war nur ein Teil der Wahrheit.
Das eigentliche Problem war, dass die Versicherung nicht zahlte, solange Ashleys Krankheit keinen Namen hatte. Und die Leute von der Berufsunfähigkeitsrente stellten sich auch quer. Und Judith konnte nicht beides übernehmen und auch noch Büromiete und Löhne bezahlen.
Eine unerwartete Begleiterscheinung ihrer Entscheidung, zu Hause zu arbeiten, war auch der Vorschlag eines sehr hochkarätigen Kunden gewesen: Da jetzt ihre Unkosten so viel niedriger seien, sollten auch seine Gebühren sinken. Statt ihm die Umstände zu erklären, die hinter ihrer Entscheidung steckten, lehnte sie aus Sorge und nervöser Anspannung einfach schnell und mit scharfen Worten ab. Er übertrug seine Geschäfte jemand anderem.
Die Maul- und Klauenseuche in England forderte ihren Tribut, und viele ihrer Kunden aus der Landwirtschaft entschieden sich, dieses Jahr aufzugeben. Und dann war da noch das junge Paar mit einem blühenden Unternehmen für Spezialnahrung, das beschlossen hatte, mit Rat und Hilfe aus dem Internet allein weiterzumachen.
Es war also keine Rede davon, dachte Judith, während sie zusah, wie seitenweise Endlospapier mit makellos gedruckten Lügen sanft in ihren Ablagekorb fielen, Alec, dem Schleimer, zu sagen, er solle sie in Ruhe lassen.
In einem viel feineren Haus nur ein paar Meilen weiter südlich, im Dorf Bunting St. Clare, waren die Lathams inzwischen von Carey Lawsons Beerdigung heimgekehrt.
Gilda begann, den glitzernden schwarzen Spitzenmantel aufzuknöpfen, der unter der Anstrengung, ihren massiven Busen zusammenzuhalten, nahezu am Platzen war. Man konnte ihn fast vor Erleichterung seufzen hören, als die Knöpfe aufsprangen. Darunter lagen mehrere Meter Taft, die die Wirkung einer mit Rüschen besetzten Jalousie hatten: ein fleischfarbenes Unterkleid, so breit wie kurz, das dem erschreckten Blick ihres Mannes einen Moment lang so vorkam, wie eine entsetzlich zerknitterte Version der Person darunter.
»Wie seh’ ich aus?«
»Es macht deinem Leichenbestatter alle Ehre, Liebling.«
»Nuschel nicht so, das hab ich dir schon mal gesagt.« Sie zog den Saum ihres Kleides herunter. Es rutschte wieder hoch. Sie seufzte. »Wenn das kein vergeudeter Nachmittag war, dann sag du mir, was es war.«
Andrew begriff, dass die Bemerkung seiner Frau eher der Beginn einer längeren Tirade als eine ernsthafte Frage war, und antwortete nicht sofort. Er war ein Mann, der den Kopf voll wilder Gedanken hatte – rohe, gewalttätige, unerbittliche Gedanken – und im Munde stets Plattitüden parat hatte – höfliche, versöhnliche, schlaffe. Manchmal lief beides parallel zueinander ab, wie jetzt gerade.
»Es tut mir leid, dass es dir nicht gefallen hat, Liebste.«
Man definiere einen vergeudeten Nachmittag. Davon konnte man sprechen, wenn man zum Beispiel den Rasenmäher über den blöden Rasen zerrte, während das eigentliche Problem in einer gepolsterten Hängematte lag, mit ihrer Furcht erregenden Kinnlade Schokoladenzigarren zermalmte und dich darauf hinwies, dass deine Mähspur nicht mit dem Lineal gezogen war. Oder wenn man ein sehr teures Mittagessen mit einer Partnerin zu sich nahm, die man sich nicht unbedingt ausgesucht hatte, die mit offenem Mund kaute, von jedem Gang erst einmal drei Viertel verschlang, um sich dann über den sonderbaren Geschmack zu beschweren und es zurück in die Küche gehen ließ. Aber die wirklich schlimmste, die allerallerschlimmste Vergeudung eines Nachmittags wagte Andrew Latham nicht einmal eine Sekunde lang zu denken, aus Angst, der Gedanke könnte ansteckend sein.
»Und was habe ich gesagt, als wir losgegangen sind?«
»Sieht mein Hintern darin fett aus?«
»Jetzt nuschelst du schon wieder.« Sie entfernte eine Hutnadel, an deren Ende ein Klumpen Bernstein klebte und die so lang wie ein Schwert war. »Ich habe gesagt, sie wollen bestimmt keine deiner armseligen Möchtegernwitze hören.«
»Hast du das gesagt?« Andrew konnte seine Augen nicht von der Hutnadel lassen. Der Klumpen am Ende kam ihm vor wie der glänzende Kot eines kleinen Säugetieres, das nur mit Karamellbonbons gefüttert worden war.
»Als uns dieser arme alte Mann erzählt hat, dass er kürzlich seine Frau verloren hat und du ihm angeboten hast, ihm suchen zu helfen, habe ich nicht gewusst, wo ich hingucken sollte.«
»Ich habe ihn missverstanden …«
»Quatsch. Ich weiß, du bist der Meinung, du müsstest der Mittelpunkt und die Seele jeder Party sein, aber das war eine Beerdigung, verdammt noch mal.«
»Eine Beerdigung!!?«
»Fang nicht wieder an!« Sie nahm den Hut ab. Es war ein schwarzes hauchdünnes Etwas, das eher wie eine fliegende Untertasse aussah, bestückt mit einer Sammlung seltsamer Pflanzen, die am Rand herunterhingen. »Ich verstehe nicht, warum wir uns da überhaupt hinschleppen mussten. Sie war Dennis’ Mandantin, nicht deine.« Sie legte den Hut vorsichtig auf ein goldenes Dralonsofa, das so groß wie ein Lastkahn war. »Er wird dich für das Letzte halten.«
Den Bruchteil einer Sekunde verlor Andrew die Beherrschung. »Ich scheiß drauf, was er von mir denkt.«
»Sprich nicht so«, rief Gilda vergnügt.
»Tja, ich spreche eben, wenn ich kommunizieren will. Nenn mich altmodisch …«
»Es ist ja nicht so, als müsstest du Werbung fürs Geschäft machen.«
Werbung? Ach so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
»Und wem musst du dafür danken, Andrew?«
»Dir, mein kleines Bonbon.«
»Und was kriege ich dafür?«
Einen Roboter kriegst du. Einen lächelnden Totenkopf. Einen Kopf voller Abscheu, der immer woanders ist. Mechanischen Sex. Wenn du ein Mensch wärst, würdest du den Unterschied merken.
Er murmelte, »Gilly …«. Ihre Unterlippe schob sich vor, voll und glänzend wie eine rosa Wurst. »Gilleee …« Er durchquerte den Raum, beugte sich hinunter und küsste sie auf die Wange. Ihre Haut war trocken und leicht körnig. Ihr Haar roch nach verwelkten Blumen. »Warum gehst du nicht und legst die Füßchen hoch? Und Drew bringt dir einen schönen Gin Tonic.«
»Du glaubst wohl, das sei ein Allheilmittel.«
Für ihren Mann war es ein Allheilmittel. Ohne Gin konnte er auf keinen Fall aufstehen, sein fettiges Frühstück hinunterwürgen, sich ins Büro manövrieren und dort den Großteil des Tages sitzen und sich dann noch nach Hause schleppen. Er sagte: »Was hättest du denn gerne, mein Engel?«
Ohne eine Spur von Zuneigung oder auch nur Interesse sagte ihm Gilda, was sie gerne hätte.
»Und diesmal gut. Ausnahmsweise.«
Sie ging davon, wobei sie ihren glitzernden Spitzenmantel zwischen zwei Fingern mit sich trug und ihn über den Teppich schleifen ließ wie über einen Laufsteg. Anscheinend hatten ihr alle möglichen Leute einst gesagt, sie solle Model werden. Sie hatte sogar einen Kurs belegt, aber dann hatte Daddy ein Machtwort gesprochen. Andrew hatte ihm kopfschüttelnd zugestimmt. Seiner Meinung nach wäre Gilda ein hervorragendes Model geworden. Hundert Kilo leichter, dreißig Jahre jünger plus Schönheitsoperationen im Wert von einer Million Pfund, und Kate Moss müsste sich von Beachy Head hinunterstürzen.
Er wählte ein Glas, tat Eis hinein und ließ Gin hineingluckern. Dann nahm er einen tiefen Schluck und wartete die Wirkung ab. Gleichgewicht war alles. Glück auf einem Stecknadelkopf. Er wollte den Punkt erreichen, wo Glauben entstand. Dieser köstliche, fast mystische Augenblick, in dem man plötzlich der tiefen Überzeugung war, dass es nur gute Zeiten gab, und zwar gleich um die Ecke, und dass die Zukunft voll glänzender Hoffnung war. Noch ein Schluck. Und ein dritter. Warum nicht? Warum zum Teufel denn nicht? Eins war sicher: Nüchtern konnte er es ihr niemals gut besorgen …
Und trotzdem …
Es gab einmal eine Zeit, und die lag kaum zehn Jahre zurück, da hatte Andrew Latham sich eingebildet, dass er durch die Heirat mit Gilda Berryman den Coup des Jahrhunderts gelandet hatte.
Hungernde Menschen sind bereit, alles in Kauf zu nehmen, solange Essen dazugehört. Andrew hatte natürlich nie gehungert, er war sogar nie wirklich hungrig gewesen, aber ihm mangelte es an allem, was für ihn das Leben lebenswert machte. Ein eigenes Haus, ein schönes Auto, wirklich gute Kleidung, Reisen, Geld – nicht nur ein Taschengeld, sondern richtig Geld. Guter Wein, essen in schicken Restaurants, ein Taxi rufen, um damit um die nächste Ecke zu fahren.
Wenn man Andrew reden hörte, war es wirklich nicht seine Schuld, dass er das alles nicht hatte. Er hatte einfach kein Glück gehabt, das war die ganze Wahrheit. Er hatte Energie, Enthusiasmus, Ideen – Mann, und was für Ideen er hatte! Die Unternehmen, die er plante, die Träume. Wenn man ihm begegnete, konnte man schwören, dass er wie geschaffen war für Erfolg. Was auch fast immer stimmte, denn Erfolg begleitete die meisten von Andrews Geschäften. Das Problem war nur, dass sich nach einer Weile herausstellte, dass der Preis für den Erfolg der Verlust von allem war, was das Leben schön machte. Keine Zeit für einen Drink mit den Kumpels oder für eine Pferdewette. Keine Gelegenheit für ein Sonnenbad bei Sonnenschein. Jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe aus den Federn,was bedeutete, keine Nachtclubs. Dann gab es noch die Frauen – die mehr Zeit in Anspruch nahmen als alles andere auf der Welt, aber, oh, es lohnte sich. Das Problem war, dass man für sie da sein musste. Sie ausführen, mit ihnen reden, ihnen zuhören, ins Kino und spazieren gehen, mit ihnen herumfahren, Picknicks machen, tanzen gehen, schmusen, sie dauernd küssen. Wie sollte ein Mann das alles schaffen und gleichzeitig noch eine Firma leiten?
Nicht, dass seine Geschäfte immer legal waren. Tatsächlich segelte er eine Zeit lang ziemlich nah am Wind. Einer, mit dem er zum Rennen ging, lieh ihm ein paar hundert Pfund für einen todsicheren Tipp, der sich als todsicherer Flop erwies. Völlig pleite wurde er aufgefordert, diesem Mann bei allem zu assistieren, was nötig war, bis seine Schulden abbezahlt waren. Die raue Alternative hatte keinen Reiz – Andrew hing an seinem Leben –, also stimmte er zu. Es war gar nicht so schlimm. Manchmal fuhr er einen Lastwagen, meistens nachts, zu einem verabredeten Ort, wartete, während Kisten unterschiedlicher Größe aufgeladen wurden, fuhr weiter zu einer anderen Adresse, wo die Kisten rasch ausgeladen wurden. Des Öfteren brachte er schwere Koffer zu einer Reinigung in Limehouse, wo sie ihm ohne Dank oder Kommentar abgenommen wurden. Von Zeit zu Zeit stand er Schmiere, und bei einer dieser Gelegenheiten ging das Arrangement zwischen ihm und seinem früheren Gläubiger plötzlich zu Ende.
Andrew befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade im Garten eines großen Hauses in der Nähe von Highgate und hielt die Augen offen, ob sich Besucher, Hunde oder Streifenwagen näherten. Das Haus war dunkel gewesen, als der Dieb, den er deckte, eingestiegen war, aber nach einiger Zeit ging in einem der oberen Zimmer das Licht an. Bald darauf gab es viel Geschrei und fast gleichzeitig heulte eine Sirene.
Der Dieb kam aus dem Haus gerannt und blieb nur stehen, um Andrew etwas in die Tasche zu stopfen und einen Beutel vor seinen Füßen fallen zu lassen, bevor er über eine Hecke sprang und in der Nacht verschwand. Andrew beobachtete, wie ein Streifenwagen durch das Tor fuhr, sah die Beamten in das Haus stürmen und rannte dann seinerseits los. Er ließ den Beutel liegen, in dem das Werkzeug war, da er keine Lust hatte, wegen »versuchten Einbruchs« angeklagt zu werden, sprang, sobald die erste U-Bahn fuhr, in die Piccadilly-Linie und verließ London.
Das »Souvenir« dieses unerfreulichen Erlebnisses – die Dietriche des Einbrechers, die ihm dieser in die Tasche geschoben hatte, besaß er immer noch. Wenn ihn jemand gefragt hätte, warum er sie behalten hatte, hätte Andrew es nicht sagen können. Er hatte bestimmt nie die Absicht, eine Verbrecherlaufbahn einzuschlagen. Dieses eine knappe Entrinnen hatte ihn völlig fertiggemacht.
Die U-Bahn hatte irgendwann in Uxbridge Halt gemacht. Nur mit den Sachen, die er am Leibe hatte, trug er sich bei einer Arbeitslosenvermittlung ein und begann am nächsten Tag mit dem ersten von vielen anspruchslosen Bürojobs. Er mietete ein Zimmer und dann eine Atelierwohnung und wagte schließlich die Reise zurück nach London, um seine Sachen zu holen.
Aber die Arbeit war so öde, dass er vor Langeweile fast verrückt wurde. Das führte natürlich zu Fehlzeiten, ausgedehnten Mittagspausen und ständigen Kündigungen. Die Tatsache, dass er Computer langweilig und dumm fand, war auch nicht gerade hilfreich. Mit einfacher Textverarbeitung kam er zwar gerade noch zurecht, aber ansonsten waren Computer für ihn wie eine fremde Landschaft ohne Landkarte.
Was sollte er also tun? Andrew hatte oft gedacht, dass der angenehmste Weg aus seinem Dilemma eine reiche Gönnerin wäre – eine Frau, die ihn auf eine Weise unterstützen würde, an die er sich hoffentlich gewöhnen würde, als Gegenleistung für geistreiche Konversation, großen Respekt und lebenslange Hingabe und Dankbarkeit. Nun beschloss er, statt nur davon zu träumen, etwas dafür zu unternehmen. Er fing an, Bekanntschaftsanzeigen aufzugeben, beschrieb sich als Geschäftsführer (mit Sinn für Humor, eigenem Haus und eigenem Wagen), damit nicht der Eindruck entstand, er sei nur auf Geld aus. Natürlich wurde er von vielen Frauen kontaktiert, die kein eigenes Haus hatten, ein Auto, das nicht ansprang und so viel Sinn für Humor, dass sie sich kaputtlachten, wenn sie seine wirklichen Lebensumstände herausfanden. Bis auf die eine, die ihm Baileys Irish Cream über die Krawatte goss. Er war kurz davor, sich von der nächsten Eisenbahnbrücke zu stürzen, als er Gilda traf.
Zu dieser Zeit arbeitete er seit fast zwei Monaten im höchst exklusiven Palm Springs Hotel. Seine Hauptaufgabe bestand darin, telefonisch zwischen den Restaurantköchen und ihren vielen Lieferanten zu vermitteln – und die Schläge von beiden Seiten einzustecken, wenn etwas nicht klappte, was jeden Tag der Fall war.
Dem Hotel angeschlossen waren ein Fitnessclub und ein Schwimmbad. Der Mitgliedsbeitrag war demonstrativ hoch, um die Mitgliederzahl niedrig und den Pöbel draußen zu halten. Obwohl es strenge Regeln gab, sich nicht unter die Gäste zu mischen, schlüpfte Drew, wenn er sich unbeobachtet fühlte, in die Umkleideräume, verkleidete sich mit einer teuren Brille und einer diskreten Badehose ohne Markennamen und schwamm im Pool.
Unauffällig beobachtete er die Frauen. Die Mehrzahl war eher gut erhalten als jung: zu dünn, unter UV-Lampen zu tiefen Karamelltönen verbrutzelt und klimpernd vor Geld. Er sah einer beim Kraulen zu, deren Arm das Wasser zerschnitt und sich nach oben bog, wobei glänzende Armreifen von ihrem Handgelenk nach unten fielen, um dann wieder zurückzufallen, als der Arm eintauchte. Sie trug an jedem Finger Ringe, unter anderem auch einen Ehering. Den trugen fast alle.
Gilda hob sich von den anderen ab. Schon damals war sie mollig. Andrew schätzte sie auf ungefähr hundertfünfzig Pfund, als er auf einer angenehm kitzelnden Düse im Whirlpool saß und Gilda zusah, wie sie über den künstlichen Rasen zum Pool spazierte. Sie trug ein geblümtes Badekorsett, an das ein krauses Röckchen geheftet war. Mehrere Minuten stand sie am Rand und versuchte schließlich einen Kopfsprung, fiel aber nur unbeholfen ins Wasser. Sie schwamm im Kreis und spritzte und paddelte dabei wie ein Hund.
Andrew begann, seine Chancen abzuwägen. Sie trug keinen Ring, aber das musste nicht unbedingt etwas heißen. Ihre Haut war sahnig weiß, sie hatte eine Menge seidiges helles Haar, und auch wenn man sich nie nach ihr umdrehte, war sie nicht völlig unattraktiv. Er zog sich an, schlüpfte durch den Notausgang hinaus und wartete, bis sie herauskam. Als sie den Hotelparkplatz überquerte, winkte jemand und rief
»Hallo Gilda!« So erfuhr er ihren Namen. Sie fuhr in einem BMW 328 i davon, der ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Andrew schaute sich ihre Daten in den Unterlagen des Fitnessclubs an, und auch diese klangen sehr vielversprechend. Sie war Single und wohnte am Mount Pleasant, einer bewachten Wohnanlage von großen Villen mit vielen Zimmern, die als Millionärssiedlung bekannt und von Rasenflächen und schön angelegten Gärten umgeben war. Auf dem Anmeldebogen stand ihre Telefonnummer, aber das Kästchen mit ihrem Alter war leer.
Es war zwar verboten, mit Gästen und Clubmitgliedern persönlichen Kontakt zu pflegen, aber es war nicht verboten mit den Angestellten über sie zu tratschen. Das war sehr beliebt und machte die öden Bürostunden wesentlich heiterer. Drew brauchte bloß den tollen Wagen zu erwähnen, um alles über die Berrymans zu erfahren, père et fille.
Berryman war ein Selfmademan. Er hatte in den frühen siebziger Jahren mit einem einzigen Maklerbüro angefangen, es zu einer Kette ausgebaut und dann verkauft. Sich in Sportausrüstung eingekauft und viel Erfolg gehabt. War mit zwei kreativen jungen Leuten ins Geschäft gekommen, die Unterstützung für ihre virtuellen Reality Games brauchten. Eines davon hob in die Stratosphäre ab, woran Charlie Berryman ein Vermögen verdiente, was aber die beiden Jungen aufgrund der Bescheidenheit ihrer eigenen Gewinne sehr bestürzte. Danach spekulierte Berryman an der Börse, investierte klug und verkaufte seine Anteile noch klüger.
So weit, dachte Andrew, kann man zufrieden sein. Aber was war mit Gilda los? Warum gab es da keinen Ehemann? Stand vielleicht eine Heirat bevor? Tania Travis von der Auslandsbuchung konnte Drew gleich ins Bild setzen. Es versteht sich von selbst, dass bei all dem Geld Männer um sie herumschnüffelten. Gilda ging auch eine Zeit lang mit ihnen aus, aber dann lief jedes Mal etwas schief. Tania konnte natürlich nicht genau sagen, was, weil sie ja sozusagen nicht dabei war. Und wie war Gilda so? Na ja, wie bei den meisten reichen Leuten musste alles nach ihrem Willen gehen, und sie konnte ein bisschen scharf werden, wenn das nicht der Fall war. Aber Tania war schon schlimmeren begegnet. Zum Beispiel dieser Kuh Melanie Bradstock …
Andrew ging sich das Haus anschauen, aber ohne viel Erfolg. Rund um das Grundstück verlief eine vier Meter hohe Mauer mit einem riesigen verzierten Tor. Das Tor war an bronzenen Säulen aufgehängt. In einer dieser Säulen war ein elektronisches Sicherheitssystem installiert. Gleich daneben stand ein Wachhäuschen. Als sich Drew in seinem schäbigen Fiesta anschickte zu parken, um sich das Haus genauer anzuschauen, kam ein Mann in Uniform aus dem Häuschen, musterte ihn und schrieb etwas in ein kleines Buch. Gilda vorgestellt zu werden, schien unmöglich. Die Kreise, in denen sich beide bewegten, konnten nicht unterschiedlicher sein. Er würde sich auf seinen alten Trick verlassen müssen, »absichtlich
zufällig« mit ihr zusammenzustoßen. Auch das war nicht einfach. Er hatte einen Tag in der Woche frei und verbrachte ihn damit, im Mount Pleasant Drive zu parken, um sie dann zu verfolgen, sobald sie herauskam. Das machte er einen Monat lang. Ergebnis: null.
Dann beschloss er, ihr das nächste Mal zu folgen, wenn sie den Club verließ. Das bedeutete, die Arbeit mitten in der Schicht zu verlassen, was zur Kündigung führen konnte, aber die Sache war es wert, und der Job war sowieso Mist.
Gilda fuhr nach Amersham, um nach dem Schwimmen bei Mane Line ihre Haare trocknen zu lassen. Als sie herauskam, verstellte ihr Drew auf dem schmalen Bürgersteig den Weg. Beide wichen erst in die eine, dann in die andere Richtung aus und entschuldigten sich.
»Meine Schuld«, sagte Andrew. Und dann: »Haben wir … ist es … ich bin sicher, dass ich Sie schon mal gesehen habe. War das im Springs Hotel? Äh … Gilda, richtig?«
Und das war’s mehr oder weniger auch schon. Seltsam, dass der Trick nie versagt. Die Menschen sind selten misstrauisch, wenn man sie bei ihrem Namen nennt. Unglaublich, wenn man bedenkt, wie leicht es ist, den Namen einer Person herauszukriegen – wie übrigens auch alle anderen Daten über sie. Er erklärte, dass er noch eine Stunde Zeit totschlagen müsse, bevor er einen Termin habe. Ob sie wohl so freundlich wäre – wirklich reichlich unverfroren, die Frage –, mit ihm einen Kaffee zu trinken?
Gilda wurde ganz aufgeregt, aber sie sagte Ja. Ja, sie wäre so freundlich.
Nach ihrem ersten Treffen ging es mit ihrer Beziehung nur langsam voran, dafür aber sehr zufrieden stellend. Sie war einsam und verletzlich. Andrew, ein Experte in der Kunst der Verführung, spielte die Rolle des liebevollen Freundes. Erst nach und nach, als sie sich häufiger sahen, ließ er durchblicken, dass er sich verliebt habe.
In der Zwischenzeit arbeitete er an einer neuen Identität. Er wohnte bei einem früheren Kollegen, während er sich nach einem Haus umsah, da er seine Londoner Wohnung im Barbican Centre verkauft hatte. Er arbeitete als Grundstücksmakler vor allem an der süditalienischen Küste und in Capri. Das klang schicker als Spanien und ließ sich weniger leicht überprüfen.
Es gelang ihm, sich von der Bank fünftausend Pfund zu leihen. Er stieß seinen Fiesta ab, mietete sich ein besseres Auto und fing an, Gilda zu verwöhnen. Er kaufte sich einen schönen Anzug und betete, dass sich die Investition lohnte. Er lernte ihren Vater kennen und hasste ihn auf den ersten Blick.
Es gibt alle Arten von Selfmademen, und Charlie Berryman gehörte zu der Sorte, die es einem ständig unter die Nase rieben. Nach den ersten zehn Minuten wusste man mehr über seine bescheidenen Anfänge, als einem lieb war. Man kannte seine Verachtung für den Silberlöffelverein, die er im gleichen Maße nur noch für Schnorrer, Kriecher und Schmarotzer am unteren Ende der Fahnenstange übrighatte. Was ebenso für die so genannten Asylbewerber galt – pack sie mit all den Faulenzern und Weltverbesserern in ein Schiff, schlepp das Schiff auf die See hinaus und spreng es in die Luft.
Sein Gesicht war ebenso hässlich wie seine Ansichten und fast so hässlich wie seine Einrichtung. Andrew, dem bewusst war, wie viel von der Meinung dieser widerlichen Kreatur über ihn abhing, versuchte freundlich zu sein, ohne dass es so wirkte, als wolle er sich einschmeicheln. Er nickte, lächelte von Zeit zu Zeit und tauschte hin und wieder liebevolle Blicke mit Gilda. In diesem Moment fühlte er sich tatsächlich fast zu ihr hingezogen, auf jeden Fall empfand er Mitgefühl. Was für ein Leben, dachte er, mit diesem grauenhaften Kretin aufzuwachsen. Es ist schon erstaunlich, dass sie überhaupt so nett ist.
Als er die Zeit für gekommen hielt, das heißt als er nur noch
zweihundert Pfund übrig hatte – machte Andrew ihr einen Antrag. Gilda akzeptierte strahlend, ihr Glück war unübersehbar. Und zwar so sehr, dass Andrew sich richtig Mühe geben musste, sich emotional zu distanzieren. So viel Freude war ihm eher unangenehm.
Als er umgehend auf den Mount Pleasant zitiert wurde und zum Haus ging, hörte er durch ein offenes Fenster Berryman brüllen und Gilda weinen. Sie schrie: »Das tust du … du weißt, dass du das tust … jedes Mal …«
Andrew klingelte. Es dauerte fast zehn Minuten, bis die Türe geöffnet wurde. Berryman hob ruckartig den Kopf, ging zurück in die riesige, mit dicken Teppichen ausgelegte Halle und lehnte sich an einen Marmortisch, wobei er wie Napoleon eine Hand in sein Jackett schob. Hinter ihm säumten unzählige riesige Ölgemälde in Goldrahmen – Bürgermeister, Stadträte oder andere Persönlichkeiten – die Wände des Treppenhauses. Zweifellos sollte man glauben, es seien Berrymans Vorfahren. Wenn es nicht so ein entscheidender Augenblick in seinem Leben gewesen wäre, hätte Andrew dem Mann ins Gesicht gelacht.
»Mr. Berryman.«
»Ich höre, Sie wollen Gilda heiraten.«
»Ja. Ich verspreche Ihnen, dass ich versuchen …«
»Und ich kann Ihnen auch was versprechen, Bürschchen. Der Tag, an dem Sie sie heiraten, ist der letzte Tag, an dem sie von mir auch nur einen Penny kriegt. Tot oder lebendig. Und das gilt für Sie und alle anderen.« Seine Rede war beendet, er stand da und beobachtete Andrew genau.
Andrew erkannte, dass Berryman im Gegensatz zu seinen kämpferischen Worten, eigentlich nicht wütend war. Seine Augen funkelten boshaft, seine Lippen zuckten, als wollten sie sich zu einem Grinsen verziehen.
Andrew bemühte sich um eine ausdruckslose Miene, während seine Gedanken rasten wie eine Ratte im Käfig. War Berrymans Drohung wirklich ernst gemeint? Würde er daran festhalten, wenn Gilda sich ihm widersetzte? Oder bluffte er, um seine, Andrews, Motive zu testen?
Seine Erinnerung erwachte und plötzlich hörte er, was Tania über Gildas Freunde gesagt hatte: »Sie ging eine Zeit lang mit ihnen aus und dann lief jedes Mal etwas schief.« Das ist es, dachte Andrew. Das ist es, was schiefläuft.
Also, was tun? Er wollte nicht aufgeben, nicht in dieser Phase. Er hatte etwas in seine Zukunft investiert, und zwar ernsthaft und viel. Das konnte er nicht aufgeben, er konnte nicht zurück zu den armseligen auszehrenden Jobs in scheußlichen Büros bei mieser Bezahlung. Dann wären seine ganzen Träume und Pläne umsonst gewesen. Er würde das Schwein bluffen und die Karten spielen, wie sie kamen.
»Ich will nicht Ihr Geld, Mr. Berryman. Ich will Gilda. Ich liebe sie.«
Er hörte ein weiches, trauriges Schluchzen, ein leises Wimmern hinter einer Tür, die am Ende der Halle halb offen stand. Sie muss die ganze Zeit dort gestanden haben.
»Meine Tochter hat einen teuren Geschmack.«
»Ich werde für sie sorgen.« Andrew, der drauf und dran war, ausdrucksvoll fortzufahren, besann sich plötzlich. Hör auf, solange du vorn liegst, Junge. Solange du noch glaubwürdig klingst.
»Sie müssen für sie sorgen. Denn ich werde keinen beschissenen Finger krümmen.«
»Offen gesagt, Mr. Berryman«, sagte Andrew, »ist mir das scheißegal.«
Bei diesen Worten war Gilda über den Teppich und in seine Arme gestürmt. Dann drehte sie sich um und bedachte ihren Vater mit einem glühenden, hasserfüllten Blick.
Er zeigte seine Zähne und sagte: »Jede Menge Zeit.«
Gilda wollte den Hochzeitstermin sofort festsetzen. Der frühestmögliche beim Standesamt war in knapp einem Monat und zufällig genau an Andrews Geburtstag. Er ging wieder zu der Bank in Causton, um sich einen weiteren Kredit zu besorgen. Da er den alten noch mit keinem Penny zurückbezahlt hatte, wurde ihm der neue Kredit verweigert, was keine Überraschung war. Er erklärte, dass er den jetzigen Kredit für Hochzeitsausgaben brauchte und erwähnte den Namen der Braut. Zauberei! Die Bögen zum Ausfüllen materialisierten sich vor ihm, als seien sie magisch aus der Luft herbeibeschworen worden, ebenso wie eine Tasse Earl Grey und eine Schale Konfekt. Oder hätte er lieber einen Sherry? Andrew nahm den Sherry, stimmte zu, dass fünftausend Pfund heutzutage für eine Hochzeit gar nichts waren, und akzeptierte die doppelte Summe.
Danach stand er auf dem Bürgersteig in der Causton High Street und überlegte ernsthaft, ob er nicht abhauen sollte. Er hatte zehntausend Pfund und immer noch den Anzug. Innerhalb von Tagen, wenn nicht Stunden, würde das Geld aus seiner Brieftasche rieseln, um Caterer, Floristen, Druckereien und Autovermietungen reicher zu machen. Und das alles für nichts? Oder?
Andrew kaufte sich eine Ausgabe der Times und ging erst mal auf einen Cappuccino ins Soft Shoe Café, um ein bisschen nachzudenken. Sein ganzes Leben lang hatte er gespielt. Als Kind konnte er nicht mal Murmeln spielen, ohne auf den Ausgang zu wetten. Und jetzt saß er hier am miesesten Tisch der Stadt.
Seine Möglichkeiten waren begrenzt. Er konnte riskieren, die ganze grässliche Prozedur durchzustehen und darauf setzen, dass sich Berrymans Herz erweichen ließ, sobald ihm klar geworden war, dass Gilda auf jeden Fall heiraten würde, auch ohne einen einzigen eigenen Penny. Er konnte es durchstehen und akzeptieren, dass Berryman sich ganz lange nicht erweichen lassen würde oder womöglich nie. Es sei denn … hieß es nicht, dass Enkelkinder Risse dieser Art heilten?
Schon bei dem Gedanken daran erstarrte Andrew. Fast spie er den Kaffee wieder aus. Es würde keine Kinder geben. Er verabscheute Kinder. Und die letzte Möglichkeit: Er konnte einfach abhauen.
Aber noch während er den Gedanken weiter durchspielte, wusste Andrew, dass das nicht in Frage kam. Niemals in seinem ganzen Leben war er so viel Geld so nahe gewesen, und er wusste, die Chancen, dass ihm so etwas noch mal passieren könnte, waren gleich null. Also fügte er sich, bewunderte die mit silbernen Glöckchen und Schleifchen geprägten Einladungskarten, diskutierte die Vorzüge von weißen Reseda gegenüber Schleierkraut im Zusammenspiel mit rosa Rosenknospen und bemühte sich, wach zu bleiben, als Gilda immer wieder in diversen Outfits in Größe 48 aus diversen Umkleideräumen kam. Als er um sie angehalten hatte, trug sie noch Größe 46, aber seit dem Tag waren, wie sie scheu zugab, aufgrund ihrer reinen Freude irgendwie ein oder zwei Pfund dazugekommen. In den wenigen Stunden, die sie Zeit hatte, schauten sie sich Häuser an.
Mehr als einmal in dieser Wartezeit fragte er sich, was Gilda wohl in die Ehe mitbringen würde, das ihr gehörte, ob sie überhaupt etwas besaß. Ersparnisse, Schmuck, ein Aktienpaket? War es wirklich ihr eigener BMW? Aber Andrew war viel zu schlau, um auch nur die harmloseste Frage diesbezüglich zu stellen und betete inständig, während der Tag immer näher rückte.
Dann, ein paar Stunden vor der Hochzeit, kam eine Nachricht von Charles Berryman, dass er Andrew sehen wolle. Diesmal fand das Treffen in einer Anwaltskanzlei in Uxbridge statt. Andrew erschien – nicht allzu besorgt. In zwei Tagen heiratete er Geld, und er glaubte, dass ihn niemand aufhalten könne.
Berryman saß persönlich hinter dem Schreibtisch; der Anwalt lehnte an einem Wasserkühler. Andrew wurde nicht aufgefordert, sich zu setzen. Man erklärte ihm, dass man Erkundigungen über ihn eingezogen hatte und es Erklärungsbedarf in der Frage des Grundstücksbesitzes im Ausland oder wo auch immer gab. Was seine finanzielle oder sonstige Integrität anginge, so sei sein Ruf miserabel.
»Sie sind ein Spieler, der nur hinter dem Geld meiner Tochter her ist«, schloss Berryman. »Aber meine Tochter liebt Sie. Und anders als die anderen sind Sie offenbar entschlossen, diese Farce bis zum bitteren Ende durchzufechten, um ihre Schnauze in den Trog zu bekommen.«
»Das ist nicht fair!«, rief Andrew. »Ich werde sie heiraten, auch wenn …«
»Ersparen Sie mir die Scheiße. Wir wissen beide, was Sie sind.« Charlie winkte dem Anwalt, der Andrew einen Bogen Papier übergab. »Unterschreiben Sie das.«
»Was ist das?« Andrew machte keine Anstalten, das Dokument zu lesen.
»Eine voreheliche Vereinbarung«, erklärte der Anwalt. »Im Falle eines Scheiterns der Ehe oder einer Scheidung verzichten Sie auf alle Ansprüche.«
»Keinen müden Penny.«
»Na ja«, Andrews Herz klopfte schneller und er warf das Papier auf den Schreibtisch, »da Sie sie ja ohne jeden Penny rausgeschmissen haben, ist das wohl kaum von Bedeutung.«
»Gilda wird es an nichts fehlen, dafür werde ich sorgen. Unterschreiben Sie.«
Andrew zuckte die Achseln, die Coolness in Person. Aber seine Finger, die vor Aufregung und Erleichterung kaum den Stift halten konnten, verrieten ihn. Er unterschrieb.
Berryman nahm den Vertrag an sich. »Sie sind ein Haufen Scheiße, Latham. Und ich hoffe, dass Sie, bevor ich das riechen muss, wieder in der Gosse sind, wo Sie hingehören.«
Was Charlies Hoffnungen betraf, so starb er drei Jahre später an einem Schlaganfall als Folge einer Gehirnblutung. Aber
er lebte lange genug, um sich mit seiner Tochter auszusöhnen, die schließlich zugeben musste, dass er im Herzen immer nur ihr Bestes gewollt hatte.
Für Andrew war es ungünstig, dass der alte Mann so lange lebte. Als Gilda die voreheliche Vereinbarung bei Berrymans Papieren fand, übergab sie sie dem Familienanwalt mit der Anweisung, dass sie immer noch gelte. Ein Jahr nach der Hochzeit oder vielleicht noch etwas später hätte sie sie noch zerrissen. Aber dann sah auch sie, trotz Andrews unermüdlicher, erschöpfender Versuche, die Rolle des hingebungsvollen Ehemanns und Liebhabers zu spielen, langsam die Risse in der Fassade. Und sie ahnte dahinter Furcht, Gier und als Schlimmstes von allem eine immense Gleichgültigkeit ihr gegenüber.
Sie lebten, zumindest materiell gesehen, komfortabel, in einem schönen Bungalow im Rancherstil mit grünen Fensterläden und einer großen Veranda. Zehn Zimmer, umgeben von einem viertausend Quadratmeter großen attraktiven Garten und einem Swimmingpool. Das Haus, das Gilda »Bellissima« getauft hatte, war auf ihren Namen eingetragen. Sie verfügte auch über eine ansehnliche Apanage – genug, um Andrew zu seinem zweiundvierzigsten Geburtstag ein Auto zu schenken – einen gebrauchten gelben Punto, allerdings in ziemlich gutem Zustand. Das cremefarbene Coupé, das sie immer noch fuhr, gehörte, wie sich herausstellte, Berryman, und er weigerte sich, es neu zu versichern, damit Andrew es nicht fahren konnte.
Von Andrew wurde erwartet, dass er seinen Lebensunterhalt selbst verdiente. In seinem Alter und mit seinem Lebenslauf habe es – und dabei stach Berryman mit seinem knochigen Finger hart in den Solarplexus seines Schwiegersohns – wenig Sinn, Briefe zu schreiben und Bewerbungsgespräche zu führen.
George Fallon von Fallon & Brinkley betreute Berrymans Geschäfte, seit dieser in den frühen siebziger Jahren mit Schrott gehandelt hatte, und wollte sich nun zur Ruhe setzen. Charlie übertrug seine Finanzangelegenheiten Dennis Brinkley, und machte dann ein Übernahmeangebot für Fallons Geschäftsanteil. Als Mitglied im Lions Club und im Club der Rotarier konnte er davon ausgehen, dass sein Angebot bevorzugt behandelt wurde.
Es gab zwei Gründe für diesen Kauf und keiner war auch nur im Entferntesten altruistischer Natur. Zum einen war die Firma inzwischen auf etwa zehn Personen angewachsen und höchst erfolgreich, was den Kauf zu einer guten Investition machte. Und zum zweiten war es Gilda langsam äußerst unangenehm, einen Ehemann zu haben, der entweder den ganzen Tag zu Hause herumsaß oder darauf bestand, sie überallhin zu begleiten, selbst wenn sie nur eine Freundin besuchte.
»Außerdem«, so erzählte sie ihrem Vater, »reden die Leute. Ich habe neulich gehört, wie diese Bademeisterin Andy einen parasitären Schleimer genannt hat.« Berryman wusste nicht genau, was parasitär bedeutete, aber was ein Schleimer war, wusste er wohl und deshalb fand er, dass es die schlaue, kleine Schlampe wahrscheinlich genau auf den Punkt gebracht hatte.
Es dauerte ziemlich lange, bis Gilda völlig desillusioniert war. Endlich hatte sie jemanden gefunden, der sie um ihrer selbst willen liebte. Und auch als sie den Verdacht hatte, dass das nicht der Wahrheit entsprach, ertrug sie es nicht, diese Illusion aufzugeben. Sie hielt noch daran fest, als sie die Lügen ihres Mannes über seine Vergangenheit, seine heimliche Spielleidenschaft und anwachsenden Schulden entdeckte. Und auch dann noch, als sie den nie bestätigten Verdacht bezüglich anderer Frauen hatte. Aber jede Enthüllung zermürbte sie und nagte an ihrem einst so bezauberten Herzen, bis sie eines Tages erwachte und feststellte, dass sie keine Illusionen mehr hatte und die Liebe fort war. Und das Absterben war so langsam und schrittweise erfolgt, dass diese letzte Entdeckung nicht einmal mehr wehtat.
Zunächst fühlte sich die Freiheit sonderbar an, sauber und leer wie ein Loch, nachdem ein fauler Zahn gezogen war. Aber wie der menschliche Geist nun einmal ist, blieb das Loch nicht lange leer. Und in Gildas Fall füllte sich die Leere mit dem immer angenehmer werdenden Bewusstsein, dass sie nun einen anderen Menschen vollständig in ihrer Gewalt hatte. Ohne sie hatte Andrew, der nun Ende vierzig war, nichts. Kein Zuhause, kein Essen, kein Geld. Und auch keine Aussicht darauf, jemals irgendetwas davon zu bekommen. Seine Schwäche, seine Unfähigkeit, auch nur irgendetwas auf die Reihe zu kriegen, hatten ihn mittellos gemacht. Ohne sie war er völlig aufgeschmissen, wie die kleinen Schalentierchen, die bei Ebbe hilflos auf dem Rücken am Strand zurückbleiben. Ganz selten äußerte er einmal schwach eine Bitte – um eine neues Jackett oder ein paar Bücher. Noch seltener beklagte er sich leise, worauf ihm umgehend erklärt wurde, dass er jederzeit gehen könne, sollten ihm die Dinge, so wie sie waren, nicht gefallen. Nur dass er das nicht konnte, da er nicht wusste wohin.
Keine glücklichen Umstände. Gilda dachte manchmal, dass sie vielleicht nie wieder Glück erleben würde. Aber eigentlich hatte sie auch schon vergessen, wie sich Glück anfühlte. Eines aber wusste sie: wenn man schon kein Glück haben konnte, dann war Macht auf jeden Fall das Zweitbeste.
2
Der Termin, auf den Dennis Brinkley bereits hingewiesen hatte, war um zehn Uhr dreißig. Um zehn war Polly immer noch nicht auf. Sie war zweimal gerufen worden und zweimal hatte sie geantwortet, sie sei dabei sich anzuziehen. Schließlich ging Kate in ihr Zimmer und fand Polly immer noch im Bett. Sie tat nicht einmal so, als schliefe sie, sondern lag auf dem Rücken und starrte an die Decke.
»Du weißt ganz genau, dass wir um halb elf in Causton sein müssen.«
»Nein, wusste ich nicht.«
»Ich habe es dir gesagt, als ich dir den Tee gebracht habe.«
»Ach so?« Polly setzte sich auf und schüttelte ihre dunklen Locken. Kratzte sich am Kopf. Seufzte. »Warum muss ich überhaupt mitkommen?«
»Weil deine Tante dich in ihrem Testament bedacht hat.«
»Testament.« Das Wort war ein zorniges Schnauben. »Ich wette, ich kriege diese wertlose Brosche –«
»Hör zu!« Kate packte ihre Tochter am Arm und zog sie halb aus dem Bett. »Sprich nie wieder so über Carey oder ihre Sachen. Vor allem nicht vor deinem Vater.«
»Schon gut … Schon gut.«
»Du weißt, wie sehr er sie geliebt hat.« Kate, erschöpft vom Trubel des vergangenen Tages und einer schlaflosen Nacht, in der sie ihren Mann trösten musste, hatte Mühe, Tränen der Schwäche zurückzuhalten. »Ich will, dass du in zehn Minuten fix und fertig unten bist.«
Und tatsächlich kamen sie nur ein ganz klein wenig zu spät. Es war zehn Uhr fünfunddreißig, als sie den hellen eleganten Empfangsbereich betraten und von einer drallen Schönheit in schicker Kleidung eine Spur zu liebenswürdig willkommen geheißen wurden. Eine Inschrift auf einem hölzernen Namensschild in Form einer Toblerone wies sie als Gail Fuller aus. Daneben stand ein großer Strauß Rosen und Lilien in einer Kristallvase. Polly war beeindruckt. Sie hatte sich Dennis ganz allein in einem schäbigen kleinen Loch vorgestellt, umgeben von staubigen Aktenschränken und einem prähistorischen Radio.
Sie staunte umso mehr, als sie durch das Hauptbüro geführt wurden, das sich groß und offen über die ganze Etage erstreckte. Hier standen zahlreiche Schreibtische, jeder mit einem persönlichen Touch, sei es eine Fotografie, ein pfiffiges Spielzeug, eine Pflanze, ein Stofftier oder ein Cartoon. Auf jedem stand ein iMac, auf dessen Tastatur emsig geschrieben wurde. Ein Kopierer summte. In den beiden sich gegenüberliegenden Ecken waren zwei recht große, abgetrennte Büros hinter Glas. Gail Fuller öffnete die Tür, auf der Dennis’ Name stand und meldete sie an.
Sobald sie saßen, entschuldigte sich Polly artig bei Dennis. Sie erklärte, dass die Verspätung allein ihre Schuld sei und er ihr verzeihen möge. Das Ganze wurde mit heftigem Augen-klimpern vorgetragen, was Dennis, zu Kates heimlicher Zufriedenheit, anscheinend kaum wahrnahm.
»Das ist ja so aufregend«, trällerte Polly und schätzte, dass Dennis wohl älter sein müsse, als er aussah. Natürlich erinnerte sie sich an ihn. Als Kind hatte sie seine rotblonden, kurz geschnittenen Haare, sein sommersprossiges Antlitz und seinen kastanienbraunen Schnauzer richtig bewundert. Er hatte sie an das Eichhörnchen Nutkin in den Büchern von Beatrix Potter erinnert. Jetzt öffneten die braunen Eichhörnchenpfoten einen großen tiefroten Umschlag und holten das Testament heraus. Dennis glättete das schwere Pergamentpapier und klemmte es unter einen Schmetterlingsbriefbeschwerer. Trotz ihrer absolut minimalen Erwartungen konnte Polly nicht verhindern, dass sich in ihrem Hals ein Kloß bildete. Es war wie eine Szene in einem dieser altmodischen Krimis, die manchmal im Fernsehen kamen. Allerdings wäre da vorher ein Mord geschehen. Das würde das Ganze beleben. Dennis hatte angefangen zu sprechen.
»Wie du bereits weißt«, Dennis lächelte Mallory direkt an, »gehen Appleby House und der gesamte Besitz ohne Einschränkungen direkt an dich. Ich hoffe, die Vereinbarungen mit Pippins Direct gelten weiterhin.«
»Wir haben bereits miteinander gesprochen«, sagte Mallory.
»Sie wollen gerne weitermachen. Und ich werde es Ende der Woche schriftlich bestätigen.«
»Die Pacht von zehntausend Pfund ist bescheiden, aber es ist ein kleines Unternehmen, sie arbeiten nach ökologischen Richtlinien und überaus gewissenhaft. Deine Tante wäre sehr zufrieden mit deiner Entscheidung.«
Polly fragte sich, wie viel Gewinn dieses »kleine Unternehmen« tatsächlich einheimste. Für sie klang es, als habe sich die alte Dame bequatschen lassen, und jetzt sahnte die Firma ab. Vielleicht sollte sie ihren Vater überreden, genauer hinzuschauen.
»Es folgen einige kleinere Vermächtnisse«, fuhr Dennis fort, »die ich als Testamentsvollstrecker gerne erfülle.«
Er begann in einem monotonen Singsang die Vermächtnisse aufzuzählen. Polly schaltete ab, fing an, sich umzuschauen und beobachtete die Aktivitäten außerhalb des gläsernen Büros. Sie stellte sich vor, wie sie selbst in einem Jahr, im Herzen der City, in genau so einer Umgebung saß und überlegte, was sie auf ihren Schreibtisch stellen würde. Mit Sicherheit etwas Cooles. Keine klackernden silbernen Kugeln – das stand fest. Auch keine Fotos – von wem sollte sie ein Foto wollen? Und wenn überhaupt Grünzeug, dann mit Sicherheit nicht so eine Nullachtfünfzehn-Pflanze aus einem dieser Gartencenter.
Während sie davon träumte, wie ihre seltene exotische Pflanze aussehen könnte – waren Orchideen nicht eher spießig? Und brauchten sie nicht eine bestimmte Umgebung? –, ging die Tür des anderen Büros auf. Ein Mann kam heraus und schlenderte durch den Raum. Eher klein, dunkel, jünger als Dennis und besser aussehend. Sie kannte ihn von der Beerdigung, wo er unangemessen laut gelacht und zu viel getrunken hatte. Er hatte Papiere in der Hand und Polly beobachtete ihn, als er sie mit einem breiten Lächeln einem Mädchen am Fotokopierer gab. All seine Bewegungen waren energisch und lebhaft, und doch hatten sie etwas Gekünsteltes, als täusche er diese Vitalität nur vor, die er in Wirklichkeit nicht empfand.
Polly dachte distanziert und im Grunde desinteressiert über ihn nach. Im Augenblick konnte sie kein Mann reizen. Über Nacht war sie immun gegen diesen speziellen Virus geworden.
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der Testamentseröffnung zu (sicher war sie gleich an der Reihe) und hörte Dennis sagen: »Nach der Erfüllung der Vermächtnisse beläuft sich der Wert des Nachlasses deiner Tante inklusive ihrer Wertpapiere auf etwas mehr als dreihunderttausend Pfund.«
»Ich hatte ja keine Ahnung …«, stotterte Mallory. »Das ist … Danke.«
»Was Benny Frayle betrifft –«
»Sollte sie nicht auch hier sein?«, fragte Kate.
»Ich habe bereits mit Benny geredet, gleich nach Miss Lawsons Tod. Carey hat zwar häufig versucht, ihr ihre Zukunftsängste auszureden, aber du weißt, wie … äh …«
Abgrundtief dumm, schlug Polly stumm vor. Oder dämlich wie ein Kamel.
»… besorgt sie sein kann. Ich konnte sie beruhigen. Sie kann in ihrer Wohnung über den Ställen wohnen bleiben, so lange sie will. Sollte es notwendig werden, das Haus zu verkaufen …« Dennis ließ den Satz als Frage in der Luft hängen, die Augenbrauen zu einem kastanienbraunen Halbmond gezogen.
»Davon kann keine Rede sein.« Kate griff nach der Hand ihres Mannes. »Wir haben Pläne.«
»Ausgezeichnet. Doch sollte es je dazu kommen, müssen Mittel und Wege gefunden werden, um eine vergleichbare Wohnung zu erwerben, die auf ihren Namen läuft.«
Mallory sagte: »Ich verstehe.« Polly pfiff leise.
Kate funkelte Polly an.
»Ihre Pension ist, selbst wenn man den unbeständigen Markt bedenkt, sehr großzügig. Sie sollte in der Lage sein, von ihrer Rente einen angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Des Weiteren steht eine beträchtliche Summe in erstklassigen Aktien zur Verfügung. Im Falle ihres –« Dennis hielt inne und starrte einen Augenblick lang traurig in die Luft. Dann räusperte er sich und fuhr fort: »– sagen wir, Ablebens, fließt das Geld wieder dem Besitz zu.«
»Und nun zu Polly.« Er lächelte sie an und wartete einen Moment, bevor er weitersprach. Er sah aus, als habe er hinter seinem Rücken eine aufregende Überraschung versteckt. Wenn er nicht so nett wäre, könnte man ihn auch für verschlagen halten. Polly erwiderte sein Lächeln und spürte gegen ihren Willen wieder ein spannendes Kribbeln. Sie wusste, wie ihre Chancen standen, eine ernstzunehmende Summe zu erben, aber auch eine schäbige alte Kameenbrosche ließ sich sicher irgendwie zu Geld machen. Vielleicht stellte sich ja heraus, dass es ein unglaublich seltenes und berühmtes Stück war, wie diese Uhr in Only Fools and Horses.
»Vor etwas über fünf Jahren gab ich deiner Tante den Rat, ein Aktienpaket zu verkaufen, das nur mäßigen Gewinn abwarf, und den Erlös in Anteile einer Arzneimittelfirma zu investieren. Der Erfolg übertraf selbst meine kühnsten Erwartungen.« Dennis machte eine Pause. Niemand mochte fragen, wie kühn diese Erwartungen denn gewesen waren. Nicht einmal Polly.
»Deine Tante hat verfügt, dass diese Anteile mit dem Wert, den sie bei Börsenschluss am Tag ihres Todes haben, an ihre Großnichte gehen sollen, und zwar –«
Polly sog hörbar die Luft ein. Dann schlug sie entschuldigend die Hand vor den Mund. Sie atmete nicht aus.
»– an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag. Die Summe beläuft sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf etwas über sechzigtausend Pfund.«
Niemand sagte etwas. Dennis strahlte Polly freundlich an. Auch Mallory lächelte, überwältigt von der beispiellosen Großzügigkeit seiner Tante. Kate lächelte nicht. Obwohl sie sich innerlich tadelte, weil sie so schlecht über ihre Tochter dachte, wurde ihr das Herz schwer. Polly atmete mit einem lauten »Puuhh« aus, dann fing sie an zu lachen.
»Wahnsinn …« Sie warf triumphierend die Arme in die Luft, die Geste eines Gewinners, der nach der Krone greift.
»Das glaube ich nicht! Sechzig Riesen –«
»Gratuliere, meine Liebe«, sagte Dennis.
»Und da ich ja fast einundzwanzig bin –«
»Du bist vor einem Monat zwanzig geworden«, fauchte Kate.
Die anderen sahen sie an. Sogar Mallory konnte seine Enttäuschung über die absichtliche Zerstörung dieses aufregenden Augenblicks nicht verbergen. Er sagte: »Poll, das müssen wir feiern.«
»Auf dem Heimweg kaufen wir eine Flasche Champagner.« Polly hatte aufgehört zu lachen, aber ihre Stimme zitterte immer noch vor Glück. So, als könnte sie jeden Augenblick in ein hysterisches Kichern umschlagen. »Und heute Abend können wir richtig schick essen gehen.« Dann verstummte sie, vielleicht weil ihr bewusst wurde, dass ihre Freude für unsensibel gehalten werden könnte. Sie legte beide Hände in den Schoß und betrachtete sie nüchtern. Im Geiste zählte sie langsam bis fünf, dann schaute sie mit ernstem Gesicht auf.
»Es ist wirklich nett von Großtante Carey, mich so reichlich zu bedenken.«
Die plötzliche Kehrtwendung überzeugte selbst Mallory nicht und zog ein verlegenes Schweigen nach sich.
Dennis überbrückte geschickt die Pause. »Ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr Pläne habt«, murmelte er und sah abwechselnd Kate und Mallory an. »Für das Haus?«
»Oh, ja«, sagte Kate, und ihr Gesicht erhellte sich langsam wieder vor Freude. »Wir hatten schon immer diesen Traum –«
»Eigentlich ist es Kates Traum«, erklärte Mallory.
»– uns selbstständig zu machen. Wir wollen Bücher verlegen, wirklich gute Bücher.«
»Das haben wir schon seit einer Ewigkeit im Hinterkopf.«
»Wir dachten, es würde nie klappen.«
»Ein großer Schritt«, sagte Dennis. »Der gut geplant sein will. Und gute finanzielle Beratung braucht.«
»Nun, was das betrifft …«
Kate und Mallory schauten Dennis mit hoffnungsvollem Vertrauen an. Polly wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der Außenwelt zu. Sie hatte den wunderbaren Traum ihrer Mutter bis zum Erbrechen gehört. Ein echter Schwachsinn. Polly musste über wichtigere Dinge nachdenken. Zum Beispiel, wie nah, wie wunderbar nah die Befreiung aus dem Würgegriff der Schulden war. Allerdings konnte sie es sich auf keinen Fall leisten, noch zehn Monate zu warten, nicht bei den Wucherzinsen von fünfundzwanzig Prozent. Wie also konnte sie so eine idiotische Verfügung umgehen?
Am nächsten Morgen kehrte Mallory nach London zurück. Polly, die eigentlich mit ihm zurückfahren sollte, wollte aus unerklärlichen Gründen plötzlich bleiben und ihrer Mutter dabei helfen, »Sachen zu sortieren und aufzuräumen«.
Kate war enttäuscht. Sie hatte sich auf ein paar ruhige, angenehme, wenn auch zwangsläufig melancholische Tage mit Benny gefreut. Hatte sich vorgestellt, wie sie zusammen Careys Sachen durchgingen und sich daran erinnerten, wann sie ein bestimmtes Kleid zuletzt getragen, ein bestimmtes Buch gelesen hatte. Sie würden sich gegenseitig trösten und, zweifellos, ein bisschen weinen. Jetzt würde alles anders sein. Kate hatte schon lange festgestellt, dass sie ihre Tochter mehr liebte, wenn sie nicht da war. Jetzt kämpfte sie gegen den schrecklichen Gedanken, dass sie Polly womöglich nur liebte, wenn sie nicht da war.
Das Ärgerliche war, wie Kate sehr genau wusste, dass Pollys Gründe, in Appleby House zu bleiben, ziemlich sicher nichts mit Aufräumen zu tun hatten. Natürlich hatte sie nicht vor, einen Streit zu provozieren, indem sie das aussprach. Oder zu versuchen, den wahren Grund herauszufinden, was sowieso ein hoffnungsloses Unterfangen wäre. Aus Polly bekam man nicht mal ihre Meinung zum Wetter heraus, es sei denn, sie wollte sie kundtun.
Plötzlich fiel Kate die kurze Episode ein, die sie zwei Tage zuvor zwischen Polly und Ashley Parnell im Garten beobachtet hatte. Sogar aus der Entfernung hatte Kate die außergewöhnliche Intensität der Szene gespürt. Und später war Polly sehr still gewesen, hatte verträumt geschwiegen. Sie hoffte von ganzem Herzen, dass Polly, jung, lebendig, entschlossen und schön, nicht vorhatte, auch nur einen klitzekleinen Flirt mit dem armen Mann anzufangen.
Sie und Benny wollten zwei Stunden arbeiten und dann eine Kaffeepause machen. Kate beschloss, in der Küche zu bleiben und das Porzellan und die Gläser durchzugehen. Von beidem gab es eine Menge, und ziemlich viel davon war angeschlagen oder hatte einen Sprung. Polly erklärte sich einverstanden, die beiden Anrichten und die große Kommode im Esszimmer auszusortieren. Sie waren voll mit Servietten, bestickten Platzdeckchen, Tischläufern und Tischdecken.
Benny hatte angeboten, den Wäscheschrank in Angriff zu nehmen. Als sie über die nackten gebohnerten Dielen des Treppenabsatzes ging, fiel ihr Blick auf die geschlossene Tür zu Careys Schlafzimmer. Schnell wandte sie den Blick ab. Sie war erst ein einziges Mal nach Careys Tod darin gewesen, um das Bett abzuziehen, alle Pillen und andere Medikamente wegzuwerfen und oberflächlich sauber zu machen. Es hatte so wehgetan, die persönlichen Dinge ihrer Freundin in den Händen
zu halten. Die wunderschönen chinesischen Vasen und die Elefantensammlung. Die Fotografien der Familie und der Freunde in silbernen Rahmen – so viele, und in den Zimmern im Erdgeschoss waren noch mehr. Und der Roman. Die Flucht vor dem Zauberer, aus dem Benny am Abend vor Careys Tod vorgelesen hatte. Immer noch aufgeschlagen auf Seite einhundertsechsundsiebzig.
»Lass uns hier aufhören«, hatte Carey gesagt. »Jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle – das wunderbare Treffen der Aktionäre mit den verrückten alten Damen. Das heben wir uns für morgen auf.«
Bei der Erinnerung wurde Benny von Trauer und Einsamkeit überwältigt und fing an zu weinen. Sie rannte in das erstbeste Schlafzimmer und vergrub das Gesicht in der Schürze, um das Schluchzen zu dämpfen. Kate hatte auch ohne eine Heulsuse im Haus mehr als genug zu tun. Und Benny wollte auch Polly nicht aufregen. Sie war sich sicher, dass Careys Tod dem Mädchen mehr zu Herzen ging, als es zugab. Nicht jeder stellte seine Gefühle zur Schau.
Kate hatte eine große Schublade geöffnet, die nur Geschirrtücher enthielt. Strahlend weiß, perfekt gebügelt. Ganz unten lag ein einzelner Stapel, ordentlich mit einem Band zusammengebunden. So weich und leicht wie wunderhübsch verziertes Seidenpapier. Als Kate es vorsichtig herausholte, spürte sie, dass jemand an der Tür stand.
»Oh, Polly, sieh dir das an.«
»Hm«, machte Polly. »Gibt es schon Kaffee?«
»Nein, wir arbeiten doch erst seit einer halben Stunde.«
»Ich bin fertig.« Polly schlenderte zum Fenster und schaute in den gleißend blauen Himmel. »Was für ein herrlicher Tag.«
»Was willst du als Nächstes in Angriff nehmen?«
»Ich werde definitiv sehr oft hier sein.«
»Da sind zwei riesige Kisten mit Besteck –«
»Ich wollte eigentlich einen Spaziergang machen.
»Ach so.«
»Das klang ein bisschen eingeschnappt.« Und als Kate nicht antwortete: »Bis später.«
»Vielleicht solltest du –«
Doch sie war weg. Kate hatte Polly vorschlagen wollen, eine Jacke anzuziehen. Sie wusste, dass es sie nichts anging, wie Polly sich anzog. So lange Kate zurückdenken konnte, trug Polly, was sie wollte. Aber Forbes Abbot war nicht London. Kate hasste den Gedanken, dass man hinter Pollys Rücken über sie reden könnte. Oder lachen. Denken könnte, so wie die aussieht, verdient sie es nicht besser. Lächerlich altmodisch, doch die Leute glaubten so was immer noch. Und jeder wusste, was das bedeutete.
Polly trug heute ein eng anliegendes weißes, ärmelloses Top mit einem tiefen V-Ausschnitt, der die obere Hälfte ihrer Brüste entblößte, und einen seltsamen Rock aus bunten Streifen, der an einer Seite länger als an der anderen, aber trotzdem noch ziemlich kurz war. Er war zwar nicht direkt durchsichtig, verhüllte aber wenig. Um ihren Hals hing eine Geldbörse in Form eines kleinen Sterns aus silbernen Perlen an einem Lederband. Seltsamerweise änderte das Wissen, dass Polly die Meinung der Dorfbewohner völlig egal war, nichts an Kates Beschützerinstinkt.
Sie ging zu dem großen Schiebefenster an der Spüle. Beschämt, weil sie ihrer Tochter nachspionierte, aber gleichzeitig getrieben, beobachtete Kate, wie Polly durch das hohe Eisentor ging. Polly wandte sich nach rechts und war verschwunden. Dem Haus gegenüber hatte sie nicht einmal einen Blick gegönnt. Verärgert und schuldbewusst zugleich fragte sich Kate, ob sie in die Szene bei Careys Beerdigung vielleicht etwas hineinphantasiert hatte, was gar nicht da gewesen war. Sie wünschte es sich, und um diese Gedanken zu vertreiben, beschloss sie, doch eine Kaffeepause einzulegen. Sie ging in die Diele, um Benny zu rufen. Keine Antwort. Dann hörte sie
leises Schluchzen, gedämpft, wie durch mehrere Lagen Stoff, und lief schnell nach oben.
Polly schlenderte durch die Hauptstraße von Forbes Abbot, die im Vergleich zur, sagen wir mal, King’s Road, eher wie eine kleine Seitenstraße wirkte, doch durchaus ihre Reize hatte. In so einem kleinen Ort erweckt ein Fremder immer Aufmerksamkeit, und auch wenn viele wegen der Beerdigung wussten, wer Polly war, blieb sie doch immer noch eine verhältnismäßig unbekannte Größe. Darum wandten nur wenige den Kopf, als sie vorbeiging, und der eine oder andere wünschte ihr einen guten Morgen, aber es gab längst nicht so viel Aufmerksamkeit, Bewunderung oder Ablehnung, wie Polly erwartet hatte. Dann bemerkte sie, dass die Leute in Grüppchen zu zweit oder zu dritt beieinanderstanden und ernst, aber irgendwie auch aufgeregt miteinander redeten. Das störte Polly nicht allzu sehr. Sie vermutete, dass es sich um irgendeine banale lokale Angelegenheit handelte, unangemessen aufgebauscht von Menschen, die mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen wussten.
Wie beinahe alles, was Polly unternahm, hatte auch dieser vormittägliche Spaziergang einen Grund und verfolgte zwei Ziele. Zuallererst hoffte sie, zufällig den Mann zu treffen, den sie bei der Beerdigung kennengelernt hatte – und in den sie sich vielleicht nicht gerade verliebt hatte, den sie aber ausgesprochen anziehend fand. Ihn einzufangen dürfte kein Problem sein. Polly hatte noch nie einen Mann begehrt, der sie nicht begehrte. Und sie hatte Energie für zwei, sollte die Angelegenheit heikel werden.
Merkwürdig war nur, dass es ihr nicht gelungen war, sich sein Gesicht ins Gedächtnis zu rufen, obwohl sie seit gestern an nichts anderes gedacht hatte. Aber sie erinnerte sich an Ashleys Ausstrahlung, sein goldblondes Haar, die feinen schlanken Hände. Sie fragte sich, was genau mit ihm nicht stimmte. Zweifellos konnte Krankheit im Frühstadium sehr romantisch sein. Und auch später gelegentlich noch – man betrachte nur die Bilder in viktorianischen Romanen. Sehnsüchtige Kreaturen mit riesigen Augen, die auf luftigen Wolken himmelwärts gehoben wurden und, umgeben von weinenden, händeringenden Trauernden mit gebrochenen Herzen, sanft aus dieser Welt entschwanden. Nicht dass Polly irgendetwas mit der Krankheit an sich zu tun haben wollte. Pillen verabreichen, Spritzen geben oder den Patienten waschen kam definitiv nicht in Frage. Besonders die Sache mit dem Waschen.
Doch das Objekt ihrer Begierde schien nicht unterwegs zu sein. Polly ging an dem kleinen Café vorbei, dem Secret Garden, und spähte ohne große Hoffnung durchs Fenster. Irgendwie sinnlos, für ein Stück Kuchen und ein Tässchen Tee in ein Café zu gehen, wenn man es drei Minuten entfernt umsonst bekommen konnte. Sie setzte mehr Hoffnung auf den Dorfladen, der zugleich Postamt und Zeitungsladen war, aber dort war er auch nicht. Angestachelt von ihrer Enttäuschung und mit der Absicht, jemanden, zumindest ein bisschen, zu ärgern, fragte sie nach der Financial Times. Natürlich bekam man sie nur auf Bestellung. Polly seufzte und schüttelte den Kopf, als der Inhaber sich entschuldigte, kaufte eine kleine Flasche Mineralwasser, setzte ihren Spaziergang fort und blieb dann und wann stehen, um einen Schluck zu trinken.
Der zweite Grund für Pollys Spaziergang war wesentlich nüchterner. Sie wollte Dennis Brinkley besuchen. Es hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, irgendeine Art von Beziehung, geschäftlich oder privat, herzustellen, solange ihre Eltern dabei waren. Sinnlos, Dennis milde zu stimmen, ihm zu zeigen, wie sachkundig und begabt sie in finanziellen Dingen war. Mit anderen Worten: Wie absurd es war, sie zehn volle Monate warten zu lassen, ehe ihr das Geld, das ihr sowieso gehörte, ausgezahlt wurde. Nein, dafür musste sie mit ihm allein sein.
Bei diesen Überlegungen fiel ihr unweigerlich Billy Slaughter ein. Der schmierige, schleimige, aalglatte Billy mit dem schwarzen Herz, in dessen Adern Gold und Galle flossen. Polly flüchtete sich in Gedanken, wie so oft, in eine Haltung eiskalter Überlegenheit. Sie stellte sich vor, wie sie ihm das Geld vor die Füße warf. Wie sie zufrieden lachte bei seinem Versuch, sich an seinem dicken Bauch vorbeizubücken, um es aufzuheben. Was für Beschimpfungen sie ihm an den Kopf warf, die sie in endlosen verschwendeten Stunden wütenden Zorns immer wieder neu erdacht und zurechtgefeilt hatte. Und dann würde sie ihm den Rücken zukehren und langsam und überheblich davonstolzieren.
Polly erinnerte sich zwar nicht mehr genau, wo Dennis’ Haus stand, doch sie wusste noch, dass er in dem umgebauten alten Schulgebäude wohnte, und das musste leicht zu finden sein. Aber nach dem Umbau sah das Haus so fremd aus – eher wie ein Fort mit hohen Fensterschlitzen –, dass sie daran vorbeilief und schließlich jemanden fragen musste.
Beim Klingeln dachte Polly schon über ihre Strategie nach. Auf jeden Fall musste sie selbstbewusst wirken, aber vielleicht war es auch eine gute Idee, Dennis um Rat zu bitten, wie sie das Geld anlegen sollte? Natürlich würde sie nicht auf ihn hören, aber welcher Mann war nicht empfänglich für Schmeicheleien?
Sie hörte, wie es im Haus laut klingelte, aber niemand kam an die Tür. Ein leise pfeifendes Geräusch, das, wie Polly vermutete, von einem Staubsauger herrührte, irritierte sie. Machte Dennis womöglich selber sauber?
Sie spazierte um das Haus herum in die Garage. Bis auf ein paar ordentlich gestapelte Kisten und einige Gartengeräte war sie leer. An der hinteren Wand hingen einige Schlüssel an einem Brett. Polly war gerade dabei, die dazugehörigen sauber beschrifteten Schilder zu lesen und sich über die Vertrauensseligkeit der Landbevölkerung zu wundern, als der Staubsauger verstummte. Eine mit einem Eisengitter verstärkte Tür führte direkt ins Haus. Polly klopfte vorsichtig an. Als niemand reagierte, klopfte sie lauter, dann trat sie ein.
Eine Frau stand an einem Spülbecken und klapperte mit Geschirr. Eine fleischige Frau mit einem flachen Gesicht und Schweinsäuglein, von denen eins fest nach innen gerichtet war und so eine klare Aussicht auf den Nasenrücken hatte, während das andere die Fremde an der Tür beäugte.
»Oh«, quietschte Polly und zwinkerte überrascht, dann verschenkte sie eines ihrer frischesten und unschuldigsten Lächeln. »Hallo.«
»Schon mal was von Anklopfen gehört?«
»Ich habe geklopft, aber ich glaube –«
»Was wollen Sie?«
Also wirklich, dachte Polly. Wie spricht die denn mit mir? Eine Putzfrau. Sie war sich sicher, dass sie die Frau kannte, aber ihr fiel nicht ein, woher. Sie sagte mit fester Stimme: »Ich möchte zu Mr. Brinkley.«
»Weiß er, dass Sie kommen?«
»Natürlich.«
»Komisch, dass er dann zur Arbeit gegangen ist.«
»Äh … ja …« Polly schnippte mit den Fingern und verfluchte sich innerlich dafür, dass sie daran nicht gedacht hatte. In der Stadt ging kein Mensch am Samstag ins Büro. »Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Er hat gesagt, wir treffen uns in Causton.«
Das nach außen gerichtete Auge musterte Polly von oben bis unten und blieb schließlich auf ihrem tiefen, freizügigen Ausschnitt hängen. »Ist wohl geschäftlich, wie?«
»Genau. Mr. Brinkley ist mein Finanzberater.« Warum rede ich überhaupt mit dieser grässlichen Person? Ich muss ihr gar nichts erklären. Armer Dennis. Kaum zu glauben, dass er sich mit diesem schielenden ungehobelten Kloß, der durch sein Haus rollt, abgeben muss.
Die Frau verschränkte ihre feisten Unterarme, die in schaumglitzernden Gummihandschuhen steckten, vor der Brust. Sie sagte nichts mehr. Stand nur ganz ruhig da und starrte Polly an.
Polly macht schwungvoll auf dem Absatz kehrt und ging. Als sie am Tor war und sich umdrehte, um es zu schließen, stand die hässliche alte Vogelscheuche am Garagentor, zweifellos, um sich zu vergewissern, dass Polly auch sicher das Grundstück verließ. Polly war wütend. Eine Frechheit. Und zu Hause konnte sie ihren Ärger auch nicht loswerden. Sie hatte nicht die Absicht, ihre Mutter wissen zu lassen, dass sie vorhatte, Dennis weichzuklopfen.
Doch als sie auf Appleby House zuging, hatte sich Pollys Laune gebessert. Im Garten des gegenüberliegenden Hauses (der Garten dieses außerordentlich anziehenden Mannes) hörte sie Stimmen und verlangsamte ihren Schritt, bis sie am Gartentor praktisch zum Stillstand gekommen war. Die Parnells saßen an einem Tisch auf dem Rasen unter einem großen Sonnenschirm mit Blumenmuster beim Mittagessen. Mist, es war Judith, die mit Blick zur heißen, staubigen Straße saß. Polly setzte ein falsches, strahlendes Lächeln auf und winkte. Ein kurzes Nicken war die Antwort. Unbeeindruckt – sie hatte nichts anderes erwartet – rief sie: »Hi! Ist das nicht ein herrlicher Tag?«
Ashley wandte langsam den Kopf, um zu sehen, wer da war, und erkannte sie sofort. Polly lächelte wieder, diesmal warm und erwartungsvoll. Dann schlenderte sie langsam weiter.
»Hübsches Mädchen«, sagte Judith und packte den Stier bei den Hörnern. Sie klang unbeteiligt, leicht amüsiert, als redete sie über ein hübsches Kind. »Und schlau.« Ihre Großzügigkeit war grenzenlos. »Mallory hat erzählt, sie ist an der LSE.«
»Das stimmt. Sie hat mir bei der Beerdigung davon erzählt. Klingt ein bisschen nach einer Löwengrube.«
»Ich zweifle nicht daran, dass sie es schafft. Wenn man so jung ist wie sie, ist alles eine Herausforderung.«
Die Jahre, die zwischen dem Mädchen und ihr und Ashley lagen, gähnten sie plötzlich an. Polly war halb so alt wie sie beide. Ich sollte mehr Vertrauen haben, dachte Judith. Sie lächelte ihn an und zwang sich zu glauben, dass sie wirklich geliebt wurde.
Ashley sagte: »Du hast mir immer noch nicht erzählt, wie dein Treffen neulich am Abend war.«
»Treffen?« Stirnrunzelnd und leicht verwirrt wiederholte Judith das Wort, als hätte sie seine Bedeutung vergessen.
»Im Peacock Hotel. Neuer Kunde. Chirurgische Instrumente.«
»Ach das. Da gibt es eigentlich nichts zu erzählen.«
Nichts zu erzählen? Nur dass es die unangenehmste Erfahrung ihres ganzen Lebens war und die Erinnerung daran immer noch frisch und unangenehm und heiß war. Nur dass sie hinterher Stunden in der Badewanne verbracht und sich in parfümiertem Wasser geschrubbt hatte und sich trotzdem noch schmutzig gefühlt hatte, als sie neben Ashley ins Bett schlüpfte. Die Erinnerung würde unweigerlich verblassen, doch Judith wusste, dass sie das Erlebte niemals ganz vergessen würde. Wie schrubbte man das Innere seines Kopfes?
Er war keine unangenehme Erscheinung gewesen – ein gedrungener, älterer Mann mit einem steifen, kleinen Schnurrbart und einer ziemlich verschmierten Lesebrille. Sein Anzug, braune Nadelstreifen zu einem rosafarbenen Hemd, war zu eng gewesen. Er saß auf einer Bank vor einem Bierkrug, neben dem seine Brieftasche lag. Nachdem sie sich die Hände geschüttelt hatten, stand er auf und rückte den Tisch weg. Sie quetschte sich an ihm vorbei, und er zog den Tisch wieder heran, so dass Judith eingeklemmt in der Ecke saß. Sie öffnete ihren Aktenkoffer.
»Also, Mr. Paulson –«
»Polson. Mit O.« Er formte den Laut übertrieben mit seinem feuchten, roten Mund, steckte seinen kleinen Finger hinein und fuhr sich langsam über die Lippen, so als wollte er die Öffnung noch vergrößern.
»Erinnert Sie das an etwas?«
»Entschuldigung – Ich –«
»Kleiner Scherz von mir. Also, was haben Sie für mich?« Judith holte einen Ordner heraus und reichte ihm eine vierseitige Hochglanzbroschüre mit ihrem Angebot. Er warf einen Blick darauf und gab sie ihr zurück, wobei er unnötigerweise näher rutschte.
Er sagte: »Das Foto wird Ihnen nicht gerecht.«
»Wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Polson?« Judith gab ihrer Stimme einen sehr sicheren und energischen Klang. »Haben Sie zurzeit einen Buchhalter?«
»Habe ich.« Er starrte in ihren Ausschnitt.
»Darf ich fragen, warum Sie an eine Veränderung denken?«
»Ich denke nicht an eine Veränderung.«
»Dann verstehe ich nicht ganz, was ich für Sie tun kann.« Judiths Antwort war knapp. Sie hatte Ashley in keinem guten Zustand zurückgelassen und war zehn Meilen für dieses Treffen gefahren. Sie packte das Informationsmaterial wieder in den Aktenkoffer und ließ schnell das Schloss zuschnappen.
»Ich schon«, sagte Mr. Polson. Er öffnete seine Brieftasche und reichte sie ihr. »Gucken Sie mal wegen der Größe.«
Judith griff danach ohne nachzudenken. Sie sah eine Reihe fein säuberlich sortierter Kondome. Es mussten an die dreißig gewesen sein … vielleicht sogar vierzig. Keine besonders angenehme Erfahrung, aber kaum geeignet, sie völlig umzuhauen. Sie betrachtete sie lange genug, um ihre Gleichgültigkeit zu zeigen, dann gab sie ihm die Brieftasche zurück.
»Wie ich sehe, sind Sie ein Optimist, Mr. Polson.« Dann, als langsam die Wut in ihr aufstieg wegen dieser Beleidigung, fügte sie hinzu: »Sie sollten manchmal in den Spiegel schauen.«
Sein Mund verzerrte sich. Sofort tat es Judith leid, nicht nur, weil sie ihn absichtlich verletzt hatte. Sie war auch beklommen. Sein Gesicht verdunkelte sich, das Blut stieg ihm in den Kopf. Judith sah sich um.
Der Raum war groß, und um halb sieben Uhr abends noch kaum gefüllt. Am anderen Ende saßen ein halbes Dutzend Männer in dunklen Anzügen um einen Tisch voller Gläser. Sie hatten murmelnd die Köpfe zusammengesteckt und warfen sie gelegentlich mit einem rauen Lachen in den Nacken. Zwei jüngere Frauen schwatzten an der Bar mit dem Barkeeper. Und zwei oder drei vereinzelte Pärchen saßen an Tischen, ebenfalls in Gespräche vertieft.
Judith saß in der Falle. Polson blockierte die eine Seite, und auf der anderen Seite endete die Bank an einer Wand. Sie versuchte, vorsichtig den Tisch wegzuschieben, bis sie merkte, dass sein metallener Aktenkoffer im Weg lag und ihr diesen Ausweg versperrte. Polson rückte näher heran. Presste sein Bein gegen ihres. Blies ihr seinen fauligen Atem ins Gesicht. Ergoss einen Strom von Obszönitäten in ihr Ohr.
Sie lechzte danach, er wusste es genau, er konnte sehen, dass ihr Name für Offenheit stand, offen für jeden, und sie fand ihn hässlich? Da unten war er nicht hässlich, da unten waren sie alle gleich, sie konnten nach oben gehen, er hatte diesen Film, um sie in Fahrt zu bringen, fünf Stück, und diese Hure, angeblich dreizehn, was? Dreizehn? Wusste Bescheid, konnte es nicht abwarten, kletterte dem Kerl auf die Schultern, alle standen Schlange, sie tat so, als würde sie weinen, das konnte sie gut, so tun, als würde sie weinen, und der Kerl sagte, stell dir vor, es ist ein Lolly, ha, ha, ha. Dann legte er seine …
Hinterher konnte Judith nicht verstehen, warum sie einfach nur dasaß, unfähig, sich zu bewegen. Nicht aus Verlegenheit. Es war, als wäre der Raum zwischen ihnen und um sie herum aus festem, undurchdringlichem dickem Eis. Seine Hand lag die ganze Zeit auf ihrem Knie, dann rutschte sie auf die Innenseite ihres Schenkels. Der Daumen schien sich selbstständig zu machen, zeigte nach oben.
Endlich bemerkte Judith, dass jemand über die Kilometer von Teppich in ihre Richtung kam. Sie fing den Blick des Mannes auf, hielt ihn fest, damit er nicht vorbeiging, dann schaute sie verzweifelt zur Seite auf ihren Peiniger.
Polson sah, was passieren würde. Er stand auf, griff nach seinem Aktenkoffer und sagte laut: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Dann bis nächste Woche?«
Als er davonschlenderte, schloss Judith die Augen. Sie merkte, dass der andere Mann sich hinsetzte, konnte ihn aber nicht anschauen. Minutenlang saß sie so da. Langsam begannen sich ihre erstarrten Gesichtszüge zu lösen. Sie spürte, wie ihr Herz schlug und Tränen ihre Wangen hinunterliefen. Der Mann ging weg und kam mit einem doppelten Kognak zurück.
»Trinken Sie das.« Er nahm ihre Hände und legte sie um das Glas. »Kommen Sie schon, Mrs. Parnell.«
»Ich kann nicht.«
»Sie müssen. Einen Schluck nach dem anderen.« Judith trank, hustete. Trank noch einen Schluck. »Gut. Sie wissen, dass Sie zur Polizei gehen sollten?«
Allein der Gedanke! Der Gedanke daran, ihn zu beschreiben, wiederholen zu müssen, was er gesagt hatte, vielleicht unzählige Male. Judith wurde schlecht. Kognak, vermischt mit Galle, füllte ihren Mund.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.« Er stand auf.
»Ich hole ein Glas Wasser.«
»Ich muss gehen.«
»Nein – genau das müssen Sie nicht. Und Sie können auf keinen Fall Auto fahren.«
»Gut.«
Sie gab sofort nach, auch wenn ihr klar war, wie schwach das war. Wie erbärmlich. Doch die Erleichterung war – überwältigend. Sie konnte einfach sitzen bleiben, still und klein, und vor allem sicher. Irgendwann würde das Gefühl von Schwäche vergehen, würde Leben in die abgestorbenen Muskeln ihrer Beine zurückkehren, sie würde aufstehen und zur Tür gehen können. Wie klug und freundlich der Mann war. Dieser Fremde, den sie noch nie gesehen hatte, und der doch aus unerfindlichen Gründen ihren Namen kannte.