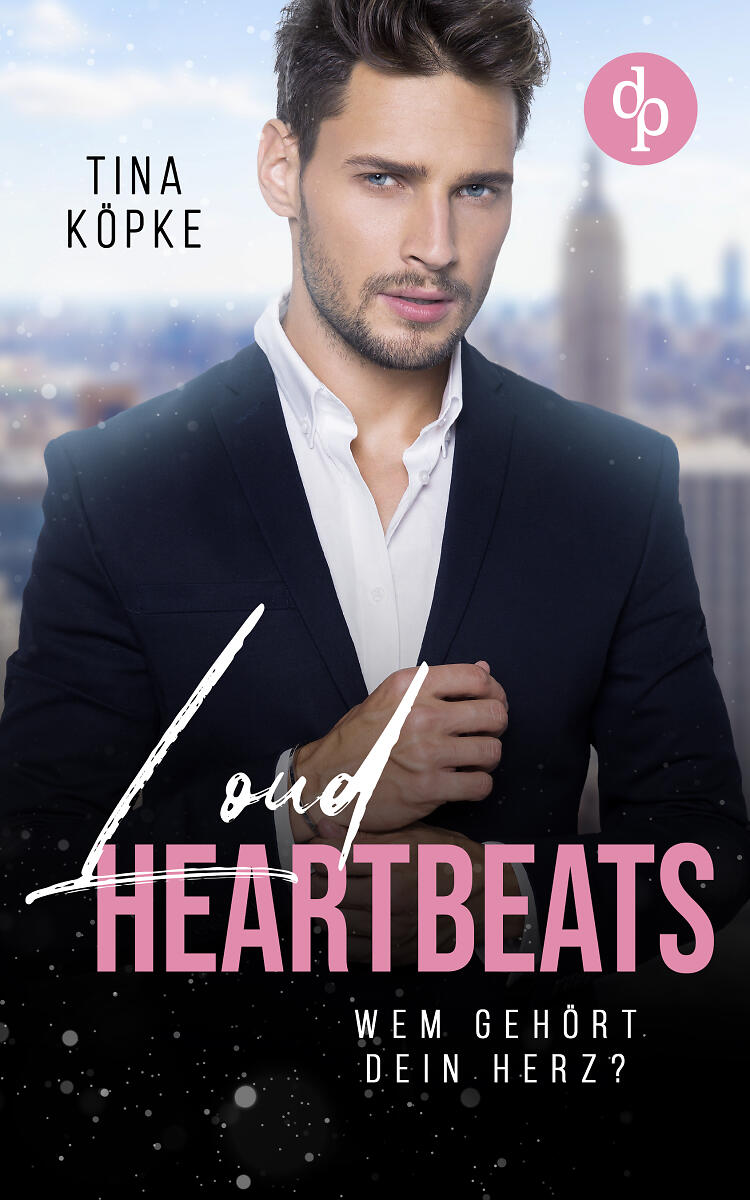Kapitel 1
»Erin, wir sollten Schluss machen.«
Ich verschluckte mich beinah an meinem Müsli. »Was hast du da gesagt?«
Chuck saß mir gegenüber an dem alten Esstisch, den wir vor zwei Jahren auf einem Flohmarkt gekauft hatten. Die Oberfläche war zerkratzt und ein paar Farbspritzer verteilten sich ungleichmäßig darauf. Ich hatte schon mehrfach versucht, ihn zu einem neuen zu überreden, aber er hatte immer wieder dagegengehalten, dass der Tisch für eine gewisse Atmosphäre in unserer Küche sorgte. Ihr sozusagen Charakter verlieh.
Die Küche war meiner Meinung nach genauso überfällig wie der Tisch, doch an dieser Front nahm ich den Kampf gar nicht erst auf. Neue Möbel waren für ihn seelenlose Ungetüme, die keine Geschichten erzählten. Deswegen trug er, wie jeden Morgen, diesen furchtbaren mitternachtsblauen Morgenmantel, der ihm bald von seinem Körper fiel, wenn er ihn nicht endlich gegen einen neueren tauschte. Aber wenn ich es damit versuchte, dann musste ich mir wieder anhören, wie er darin das erste Mal betrunken gewesen war oder in einer der Taschen zufällig einen Zehndollarschein gefunden hatte.
»Ich habe letzte Nacht darüber nachgedacht …«, setzte er in seiner monotonen, fast schon phlegmatischen Stimme an.
»Das ist jetzt nicht besonders lang«, gab ich zu bedenken. Worüber redeten wir hier eigentlich?
Chuck äußerte seine Gefühle selten laut und in der Regel konnte man ihm auch nicht ansehen, wenn sich etwas in ihm regte. Egal ob Freude oder Wut – er trug fast immer den gleichen Gesichtsausdruck. Vor ein paar Jahren – genau genommen sind es übermorgen schon sieben – fand ich das irgendwie inspirierend. Seine ruhige, in sich gekehrte Art hatte mich beeindruckt, was daran lag, dass meine Eltern zwei aufgeregte, hektische Menschen waren. So sehr ich sie liebte, mit zunehmendem Alter wurde das ziemlich anstrengend. Dagegen war Chuck eine Quelle der Stille und sein friedliches Naturell hatte dafür gesorgt, dass ich die Streitereien während unserer Beziehung an einer Hand abzählen konnte.
»Es hat aber gereicht, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass wir unseren Zenit erreicht haben.«
Unseren Zenit erreicht? Bitte was? Wir waren in unseren frühen Zwanzigern. Wie konnten wir schon irgendetwas anderes als Abschlüsse erreicht haben?
Er faltete die Tageszeitung zusammen, legte sie neben dem Teller mit Pancakes ab und griff nach der Kaffeetasse, deren Seite einen zarten Riss aufwies. Sie stammte noch aus Chucks Kindheit und war damit so was wie der Heilige Gral. Also absolut unantastbar. Zumindest ich durfte mich ihr nicht nähern, vermutlich weil er Angst hatte, sie würde bei meiner bloßen Berührung in Einzelteile zerspringen. Oder ich stolperte mal wieder über den dämlichen Läufer zwischen Küche und Wohnzimmer. Das geschah tatsächlich häufiger als gedacht.
»Wir entwickeln uns an dieser Stelle nicht mehr weiter und sollten deswegen getrennte Wege gehen.«
Ich hatte mich also doch nicht verhört, was dazu führte, dass die Geschwindigkeit meiner Gedanken von einem gemütlichen Sonntagsausflug auf der Landstraße zu einem Wettrennen auf dem Highway wechselte.
»Chuck«, flüsterte ich. »Das ist ziemlich …«
Was sollte ich sagen? Sicher, unsere Beziehung war nicht wahnsinnig aufregend und irgendwie hatten wir uns schon ein wenig im Alltag verloren. Aber uns gleich trennen? Nach fast sieben Jahren? Machte man da nicht lieber mal eine Pause?
Obwohl, nein. Das hatte bei Rachel und Ross nur zu Katastrophen geführt. Ich würde es nicht aushalten, mit Chuck darüber zu streiten, ob eine Pause eine Trennung bedeutete oder eben nur eine Auszeit, in der man zufällig mit anderen Leuten ins Bett ging.
»Warst du denn glücklich, Erin?« Er starrte mich so durchdringend an, dass ich mich zum ersten Mal wunderte, wie dieser gemütliche Braunton seiner Augen so kühl wirken konnte. Ich wollte mit irgendeinem Glückskeksspruch antworten – so was wie: Das Glück liegt in den kleinen Dingen des Lebens oder so –, aber mein Mund startete bereits einen Alleingang.
»Das ist doch Quatsch«, sagte ich und klang dabei nicht im Ansatz so aufgeregt, wie ich mich fühlte. Chucks ruhige Art hatte über die Zeit ganz schön auf mich abgefärbt. »Ich bin zufrieden mit unserem Leben.«
»Zufrieden und glücklich sein sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.«
Wenn er so weitermachte, würden wir am Ende des Frühstücks wirklich noch getrennte Wege gehen. »Chuck, wir haben uns zusammen eine Existenz aufgebaut. Wir sind fast sieben Jahre … sieben Jahre«, wiederholte ich mit Nachdruck, »eine Instanz. Chuck und Erin. Das kannst du doch nicht einfach so wegwerfen.«
»Ich will es für uns beide. Stillstand ist der Tod eines jeden Menschen.«
Wow. Hätte ich gewusst, dass er so über unsere Beziehung dachte, dann hätte ich … ich meine, dann würde ich … ja, was denn? Hätte ich versucht, zu verhindern, dass er mit mir über schlabbrigen Pancakes und pampigem Müsli Schluss machte?
Natürlich. Ich liebte Chuck, seit ich fünfzehn war.
Er war mein erster Freund. Mein erster Kuss. Mein erstes Mal. Mit ihm hatte ich auf dem Abschlussball getanzt. Wir hatten sogar eine Fernbeziehung überstanden, als ich zwei Jahre versuchsweise in New York Betriebswirtschaft studiert hatte. Das alles … das alles war doch etwas wert. Es bedeutete etwas. Das musste es einfach.
Stattdessen kam es mir vor, als sollte ich schon allein dafür dankbar sein, dass er den Schlussstrich unter unserer Beziehung nicht per Handynachricht zog.
»Was ist mit heute Abend? Mit der Silvesterparty?« Ich erkannte meine eigene Stimme kaum. Sie klang motorisch und eindeutig zu gelassen für die Umstände. Als hätten sich Mund und Gehirn voneinander getrennt, um den absoluten Super-GAU zu verhindern.
»Ich denke, es wäre unangebracht, wenn ich dich begleite.« Er zwang sich zu einem Lächeln. So viel Gefühlsregung an einem Morgen war ich von Chuck gar nicht gewöhnt. Und das machte mir am meisten Angst, weil das bedeutete, dass es ihm ernst war. »Ich werde für ein paar Tage zu meinen Eltern ziehen, dann kannst du dir eine Wohnung suchen.«
»Moment.« Ich hob die Hände und kniff die Augen zusammen. »Wieso soll ausgerechnet ich ausziehen?« Das kam überhaupt nicht infrage. Ich verdiente als Einzige hier richtiges Geld, um die Miete zu bezahlen. Er hingegen saß einen Großteil des Tages irgendwo herum und hoffte auf Inspiration für ein neues Kunstwerk. Wenn sie dann mal kam, machte er damit aber auch nicht genug, um sich als amerikanischen Banksy zu bezeichnen.
»Erin.« Er redete mit mir, als wäre ich ein kleines, bockiges Kind, an dessen Vernunft er appellieren musste. »Du weißt, wie sehr ich die Wohnung liebe. Von dem alten Flurläufer über diesen Esstisch bis hin zu Tante Gretas Gemälde von meinem Urgroßvater im Wohnzimmer. Ich meine«, er zuckte gleichgültig die Schultern und griff wieder nach der Zeitung, als Zeichen dafür, dass sich das Gespräch langsam dem Ende zuneigte. »Ich überlasse sie dir, wenn du willst. Aber liebst du diese Wohnung wirklich so sehr?«
Ich sah auf den Esstisch unter mir. Warum hatte er unbedingt immer darauf bestehen müssen, dass wir ihn behielten? Warum hätte er nicht mir zuliebe nachgeben können? Wir wären zu Ikea gefahren und hätten einen Neuen ausgesucht. Der hätte dann irgendwann unsere Geschichten erzählt. Wäre das nicht genug gewesen?
»Nein«, flüsterte ich und verfluchte den Esstisch und alles, was aus seinem Holz in der Zukunft noch gebaut werden würde. »Ich liebe die Wohnung nicht so sehr wie du.«
***
Jaina starrte mich perplex an. »Er hat eure Beziehung einfach so beendet? Beim Frühstück?« Sie spuckte die Worte förmlich auf den Parkettboden unter uns und machte damit, im Gegensatz zu Chuck, keinen Hehl daraus, wie sie zu der Sache stand.
Ich liebte meine beste Freundin dafür sehr.
»Ja«, sagte ich und nippte an dem Glas Champagner, das ein Kellner mir vor wenigen Minuten gereicht hatte. Zunächst hatte ich gedacht, es wäre eine bescheuerte Idee, ein paar Stunden nach dem Gespräch mit Chuck in den nächstbesten Zug nach Manhattan zu steigen und die Silvesterparty ohne ihn zu besuchen. Schließlich müsste ich doch über einem Eimer Ben & Jerrys hängen und romantische Komödien mit Sandra Bullock und Renee Zellweger schauen, nicht wahr?
»Scheiße, ich weiß schon, wieso ich ihn nie gemocht habe«, knurrte Jaina und trank einen Schluck von ihrem Whiskey. Zusammen mit dem gut geschnittenen, teuren Hosenanzug hätte sie so auch in jeden Gentleman’s Club gepasst. »Ich meine, hat er denn wenigstens versucht, die Sache zu retten?«
»Äh«, gab ich wenig kreativ von mir und schaute hilfesuchend zu Jainas Freundin Miriam, die mir einen mitleidigen Blick schenkte. Von uns dreien schien sie die Ruhige zu sein, auch wenn ihr dunkelgrünes Kleid mit den Ärmeln und dem schwungvollen Tellerrock etwas anderes vermuten ließ. Mit den roten Locken, die ihr ovales Gesicht umrahmten, sah sie alles andere als harmlos aus.
Jaina, mit ihrem blonden Bob, war hingegen eher die Powerfrau – wahlweise auch die Aufbrausende – und ich … Ich war irgendwo dazwischen.
Vielleicht die Friedfertige? Oder die hoffnungslos Romantische?
Wobei die Zeit mit Chuck nicht unbedingt darauf schließen ließ. Wir waren beide keine Romantikninjas gewesen und unter Umständen war auch das ein Grund, wieso ich ohne ihn in einer Bar, rund vierzig Kilometer von Zuhause entfernt, im zwanzigsten Stock stand und mich mit Champagner betrank.
»Sei froh, dass du ihn los bist«, lautete Jainas Urteil. Und das war, wie ich wusste, ab dieser Sekunde in Stein gemeißelt. »Wer weiß, wie das sonst ausgegangen wäre.«
»Ich hatte gedacht, er würde mir heute einen Antrag machen«, gab ich leise zu und verzog das Gesicht, als sich Jainas und Miriams Augen weiteten. Verlegen zupfte ich am Saum meines schwarzen Paillettenkleides. Auf einmal kam mir der kurze, enganliegende Stoff zu knapp vor.
»Wie schade«, sagte Miriam und fing sich damit einen strafenden Blick von Jaina ein. Diese schüttelte den Kopf, was dazu führte, dass eine ihrer kinnlangen blonden Strähnen an ihrer Unterlippe kleben blieb.
»Zwei Worte.« Sie schob sich die Haare aus dem Gesicht und hob demonstrativ den Zeigefinger. »Sei«, sie hob den Mittelfinger und formte das Peace-Zeichen, »froh.«
Ich wollte froh sein. Wirklich. Aber es war nicht so einfach, wie es sich anhörte.
Nach diesem seltsamen Gespräch am Morgen hatte Chuck kurze Zeit später mit einer gepackten Reisetasche unsere Wohnung verlassen. Zunächst hatte mich das Gefühl von Einsamkeit übermannt. Ich war nie so richtig allein gewesen. Erst hatte ich – logischerweise – bei meinen Eltern gewohnt, dann war ich nach dem Highschoolabschluss nach New York zum Studieren gegangen. Im Wohnheim hatte ich mir mit Jaina ein Zimmer geteilt. Nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte – die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn ich mit einem Abschluss sicherlich größere Jobchancen gehabt hätte –, war ich zurück nach Elizabeth in New Jersey, meine Heimat, und in eine Wohnung mit Chuck gezogen. Das war vor zwei Jahren gewesen.
Und nun hatte ich in dieser Wohnung gestanden, die ich weder mochte, geschweige denn liebte. Die Wände hatten sich bedrückend eng angefühlt und auf einmal war mir klargeworden, was eine Trennung tatsächlich bedeutete.
Leere. Einsamkeit. Das volle Selbstmitleidprogramm.
Ich musste allein klarkommen. Die Träume, dass Chuck und ich für immer zusammen sein würden, waren wie Seifenblasen geplatzt. Zurück zu meinen Eltern würde ich nur ziehen, wenn es wirklich, wirklich nötig wäre. Und an dem Punkt war ich nicht. Noch nicht.
Also brauchte ich eine neue Wohnung. Vermutlich sogar neue Freunde, denn unser Freundeskreis in Elizabeth war mehr Chucks Clique als meine. Es hatte sich irgendwie so ergeben und ich mich damit arrangiert. Jaina wohnte schließlich nicht so weit weg und dank der modernen Technik war es leicht gewesen, in Kontakt zu bleiben. Mir hatte nie etwas gefehlt. Zumindest hatte ich das angenommen.
Genau jetzt, wo ich helfende Hände an allen Ecken gut gebrauchen konnte, war Jainas und meine Fernfreundschaft ein Problem. Im Endeffekt wusste jeder, dass man bei einer Trennung nicht nur den Besitz aufteilte, sondern auch die sozialen Kontakte. Ein bisschen wie bei einem Sorgerechtsstreit. Und in diesem Fall würde ich eindeutig den Kürzeren ziehen.
Chuck bekam unsere Wohnung. Chuck bekam unsere Freunde.
Und ich … Ich musste herausfinden, was mir vom Rest blieb. Aktuell saß der Schock zu tief, um der Sache etwas Positives abgewinnen zu können, aber der Champagner und ich gaben uns reichlich Mühe, diese Probleme auf Zukunfts-Erin abzuschieben. Die würde sich rückblickend bestimmt bei mir dafür bedanken.
»Ich versuche, optimistisch zu bleiben«, lenkte ich ein. »Ich meine, Neuanfänge sind doch etwas Gutes, nicht wahr?«
Ich sah abwechselnd zu Jaina und Miriam. Sie konnten kaum unterschiedlicher sein. Während Jaina energisch nickte und ihr Glas leerte, als würde es einer Kampfansage ans Patriarchat gleichkommen, lächelte Miriam aufmunternd und regelrecht mütterlich. Ich kannte sie nicht so gut oder so lange wie Jaina, aber ich mochte ihre fürsorgliche Art, mit ihrer Umwelt umzugehen. Es konnte unmöglich einen empathischeren Menschen geben als sie.
»Du solltest richtig auf den Putz hauen«, sagte Jaina und reichte ihr Glas einer Kellnerin, die es mitnahm, um Nachschub zu holen. »Ich meine, du bist diese Schnarchnase endlich los und kannst deine Fesseln der Monogamie sprengen.«
Automatisch sah ich auf meine Handgelenke. Ich konnte keine Fesseln erkennen und fühlte mich auch nicht, als hätte ich jemals welche getragen, aber ich ahnte, worauf sie hinauswollte.
Jaina war kein Beziehungstyp. Wenn es nach ihr ging, dann waren das nur gesellschaftliche Konstrukte, um Frauen kleinzuhalten. Oder irgendwie so was in der Art. Ich schaltete für gewöhnlich ab, wenn sie ihre Monologe darüber hielt, denn ehrlich gesagt: Ich war gerne jemandes andere Hälfte. Es war schön, in die Arme genommen und bedingungslos geliebt zu werden. Chuck hatte sich nie dafür interessiert, ob ich Make-up trug oder mir einen Tag zu lang nicht die Haare gewaschen hatte. Oberflächlichkeit konnte ich ihm wirklich nicht nachsagen, auch wenn er sich wiederum mit seinem Erscheinungsbild etwas mehr Mühe hätte geben können.
War ich ein schlechter Mensch, weil ich mir das gewünscht hatte?
Ich erinnerte mich noch gut daran, wie er ausgesehen hatte, bevor er zum selbsternannten Künstler geworden war.
Breite Schultern, dunkles Haar, markantes Kinn. Er war Kapitän des Hockeyteams gewesen. Inklusive Aussicht auf ein richtig gutes Stipendium für ein ausgezeichnetes College.
Aber dann war er den letzten Sommer vor dem Highschoolabschluss in einem Künstlercamp gelandet, nachdem seine Kunstnote drohte, ihm alles zu versauen.
Er hatte seinen Aufenthalt dort als die absolute Erleuchtung beschrieben, und weil ich ihn so geliebt hatte, hatte ich dabei zugesehen, wie er die ganzen Sachen, die ihn bis dahin ausmachten, schleifen ließ.
Kein Hockeyteam, kein Stipendium. Dafür aber erstaunlicherweise ein paar kleinere Auszeichnungen für seine Kunstwerke und die eine oder andere lukrative Ausstellung. Nur ließ er sich mit jedem Lebensjahr etwas mehr gehen. Das war Chuck.
»Weißt du schon, was du jetzt machen möchtest?«, fragte Miriam mit ihrer weichen Stimme. Sie hatte haselnussbraune Augen, die warmherzig im Licht der Deckenbeleuchtung schimmerten.
Ich trank einen großen Schluck Champagner. Die kribbelnden Bläschen tanzten aufgeregt auf meiner Zunge und lösten ein kleines Hochgefühl in mir aus. »Ich suche mir besser erst mal eine Wohnung.«
»Ist der Wohnungsmarkt in Elizabeth entspannt?«
Ich seufzte schwermütig. »Keine Ahnung. Wir hatten unsere nach zwei Wochen gefunden, aber bei dem Zustand, in der sie war« und immer noch ist, »wundert es mich nicht. Ich hätte gerne etwas Moderneres, doch das könnte preislich schwierig werden.«
Jaina rieb sich nachdenklich das Kinn. »Arbeitest du nicht für deinen Dad?«
Ich schmunzelte bei der Vorstellung, was sie wohl dachte, was ich als Sekretärin meines Vaters verdiente. »Ja, aber es ist nur eine kleine Baufirma. Da bekomme ich nicht viel. Es reicht gerade so, um die Wohnung zu bezahlen, in der Chuck und ich leben.« Oder besser gesagt, gemeinsam gelebt hatten.
Daran würde ich mich erst noch gewöhnen müssen.
»Hm«, gab Jaina von sich. Ihr Blick scannte mich von oben bis unten gründlich ab. »Was hältst du von der Idee, hierher zu ziehen?«
»Nach New York?« Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus. »Du meinst dieses New York? Metropole, schlechte Wohnungslage, schweineteuer?«
Jaina nickte und verzog dabei keine Miene. »Ja.«
Es war ihr Ernst. Vernebelte ihr das eine Glas Whiskey bereits den Kopf? »Wenn ich mir gerade so eine neue Bleibe in Elizabeth leisten kann, wie soll ich dann eine in New York bezahlen?«
»Indem du keine ganze Wohnung mietest, sondern nur ein Zimmer. Zum Beispiel bei mir.«
Ein Flattern in der Brust ergriff mich. Reflexartig straffte ich die Schultern und starrte sie ungläubig an. »Du meinst, wir sollten zusammenziehen? Als Mitbewohnerinnen?«
Das klang zu gut, um wahr zu sein.
»So lautet mein Vorschlag.« Sie lächelte schmal. »Paul zieht endlich in seine eigenen vier Wände, sein Zimmer wird also nächste Woche frei und … Okay, ich könnte mir die Bude auch so leisten, aber ich würde lieber mit jemandem zusammenwohnen, der nicht dauernd seine Unterhosen neben dem Wäschekorb liegen lässt, wenn er duschen geht.«
Miriam lachte leise und ertränkte wohl weitere Gedanken in einem bunten Fruchtcocktail.
»Das klingt großartig.« Ich konnte mein Glück kaum fassen, denn das löste alle meine Probleme auf einen Schlag: Ich musste in dieser blöden Situation nicht an Einsamkeit sterben und mir gleichzeitig keine Gedanken über mögliche Geldprobleme wegen zu hohen Mietpreisen machen. Außerdem war die Wohnung ein Traum und ohne Jaina als Mitbewohnerin hätte ich keinen Tag am College überlebt. Sie wirkte vielleicht oft mürrisch und mies gelaunt, aber es gab niemand anderen, mit dem ich lieber zusammenwohnen wollte.
Doch dann beschlich mich ein Gedanke, der mir die Euphorie so schnell wieder nahm, wie sie gekommen war.
»Mist. Ich kann nicht. Ich meine, was ist mit meinem Job? Ich kann nicht jeden Tag von Queens nach Elizabeth pendeln … das sind bestimmt zweieinhalb Stunden Zugfahrt und ich muss dort oft Überstunden machen.« Es klang sicherlich verwöhnt, aber die Vorstellung, am späten Abend und in aller Herrgottsfrüh im Zug zu sitzen, nachdem ich neun, manchmal zehn Stunden im Büro gehockt hatte, ließ mich frösteln.
»Dann such dir einen neuen Job«, schlug Jaina vor.
»In New York gibt es so viele Firmen, die benötigen bestimmt immer mal eine Assistentin oder Sekretärin«, ermunterte Miriam mich.
Sie hatten beide leicht reden. Miriam arbeitete in der Bäckerei und Konditorei ihrer Eltern, die zufälligerweise auch noch im gleichen Haus lag wie Jainas Wohnung. Und Jaina hatte sich einen Namen als Bloggerin gemacht und war ihre eigene Chefin.
Meine Freundinnen hatten sich nie wirklich auf dem Arbeitsmarkt bewähren müssen. Und der war in Elizabeth schon nicht allzu berauschend gewesen, wenn man nur einen guten Highschoolabschluss und ein halbfertiges BWL-Studium besaß.
»Ich weiß nicht«, fasste ich meine Sorgen knapp zusammen. »Die Stelle bei meinem Dad ist … sicher.«
»Süße, das dachtest du von deiner Beziehung mit Chuck auch.«
»Jaina«, ermahnte Miriam sie mit zusammengekniffenen Augen. Ich konnte kaum erwarten, dass sie mal wirklich Mutter wurde. Sie hatte Talent für diese eine Sorte Blick, den Moms mit der Geburt ihres Kindes quasi überreicht bekamen.
»Was denn? Sie hat lang genug auf die sichere Nummer gesetzt. Nichts im Leben ist sicher, das macht es ja so spannend.«
Dagegen fehlten Miriam offenbar die Gegenargumente und vielleicht lag es am Champagner, aber irgendwie hatte Jaina recht. Abgesehen von meinem Studienabbruch war ich so lange die sichere Tour gefahren, dass ich erst heute Früh am eigenen Leib zu spüren bekommen hatte, dass nichts wirklich für immer sein musste. Dass dieser Weg plötzlich an einem Abgrund endete und wenn man nicht aufpasste, stürzte man hinein.
Hier und jetzt bot sich mir eine möglicherweise einmalige Gelegenheit.
Ich liebte New York. Ich liebte Jaina als Mitbewohnerin.
Und bei dem Gedanken, einen fremden Abschnitt einzuläuten, bebte mein ganzer Körper vor Aufregung.
Das war ein neues Gefühl, und auf die Gefahr hin, es morgen Früh wieder zu bereuen, stimmte ich kurzerhand zu, meinen Job bei Dad zu kündigen und bei Jaina einzuziehen.
***
Zehn Minuten. In zehn Minuten würde dieses Jahr endlich enden. Ich würde alles hinter mir lassen, meinen eigenen Strich unter der Rechnung ziehen und durchatmen.
Nach ein paar Gläsern Champagner und Pflaumenschnaps war ich nicht mehr ganz so sicher auf meinen High Heels – ich hätte es besser wissen müssen, aber sie passten perfekt zu dem schwarzen Paillettenkleid mit den dünnen Spagettiträgern –, dafür wenigstens umso motivierter. Gerade jetzt konnte mich der verdammte Chuck mal kreuzweise. Wenn er dazu in der Lage war, sieben Jahre einfach so wegzuwerfen, dann sollte ich das ebenso hinkriegen.
Ich trank auf jedes Jahr ein Glas und davon stieg mir wiederum jedes zunehmend zu Kopf und hellte zumindest temporär meine Laune auf. Um mir ein wenig die Beine zu vertreten, hatte ich kurz die Toilette aufgesucht und mich danach für einen kleinen Rundgang entschieden, schließlich kam ich nicht jeden Tag an einen Ort wie diesen.
Die Bar trug irgendeinen spanischen Schickimickinamen und lag an der 6th Avenue. Die Innenarchitekten hatten dunkles Holz, schwarze Wände und Kristallkronleuchter ausgewählt.
Eine lange, edle Bartheke aus Mahagoni flankierte die eine Seite des Gastraumes, teuer aussehende Gemälde mit undeutbaren modernen Farbklecksen die andere. Selbst die Pianomusik war so anregend wie ein Paar getragene Sportsocken. Ich verstand das Konzept des Lokals nicht so wirklich, aber mein achtes Glas Champagner sorgte dafür, dass es mir am Ende egal war.
Ich war ein anspruchsloses Mädchen, das mit einem Billardtisch oder einer Dartscheibe sehr leicht zufrieden zu stellen war. Es war zwar cool, hier zu sein, anstatt allein auf der Couch herumzuhängen und das Feuerwerk im Fernsehen zu betrachten, aber ohne Jainas Einladung wäre ich wohl nie in diesen Laden reingekommen.
Ein wenig belohnt wurde ich mit dem Ausblick, den man aus dieser Höhe bekam. Die dritte Wandseite der Bar bestand komplett aus Fensterglas und es irritierte mich, dass kaum jemand hier stand und hinaussah. Ich konnte in die gegenüberliegenden, hellerleuchteten Restaurants, Bars und Büros schauen. Überall wurden Partys gefeiert, Taxis verstopften die Straßen von Manhattan und ganze Horden von Menschen waren auf den Gehwegen unterwegs, um irgendwo einen guten Platz zum Feiern zu finden. New York vibrierte vor Leben.
Ich ließ meinen Blick wandern und bemerkte unweit von mir einen jungen Mann, der von so vielen anderen Gästen umzingelt war, dass ich gar nicht gewusst hätte, mit wem ich zuerst reden sollte. Aber er schaffte es, sich irgendwie allen zu widmen und dabei eine Gelassenheit auszustrahlen, um die ich ihn beneidete. Er lachte, die Menschen um ihn lachten. Egal wie groß oder klein, alt oder jung – es wirkte, als sähen sie zu dem Fremden auf. Als tummelten sie sich in seinem Sonnenlicht.
Unsere Blicke trafen sich flüchtig. Obwohl uns ein paar Schritte voneinander trennten, fielen mir seine Augen auf, die mich an blaue Eisberge erinnerten. Klar, wach, eindringlich. Er nickte mir mit einem schmalen Lächeln kurz zu. Meine Wangen wurden heiß und ich sah rasch zur anderen Seite der Fensterfront. Als ich die Gruppe erneut lachen hörte, grinste ich in mich hinein.
Solche Momente erlebte man in Elizabeth nicht und deswegen liebte ich New York. Es gab keinen Ort, den ich lieber mochte, und schlagartig fragte ich mich, wieso ich die Stadt damals überhaupt verlassen hatte.
Chuck. Es war wegen Chuck. Ich war nach der Schule im Grunde nur studieren gegangen, um aus Elizabeth rauszukommen. Er hingegen wollte nie woanders hin, und nachdem BWL für mich kein Thema mehr gewesen war, war ich wie selbstverständlich zu ihm zurückgegangen.
Die sichere Tour eben.
Die Heimat, der Freund, der Job bei Dad. Ich hatte unterschwellig immer gespürt, dass etwas in meinem Leben fehlte, aber ich war daran gescheitert, mit dem Finger darauf zu deuten. Es war mir alles so richtig vorgekommen.
Die besten Entscheidungen, damit jeder glücklich war.
Jeder außer mir … und irgendwann auch Chuck.
»Erin, da bist du ja.« Ich drehte mich um und sah in Jainas Gesicht. Ihre Wangen schimmerten rosig von dem Whiskey in ihrem Glas, und ihre glatten Haare hatten sich ein wenig ineinander verheddert. »Ich habe Miriam eben etwas vorgeschlagen.«
Ich lächelte träge. »So?«
»Sie hat sich Vorsätze überlegt«, erklärte Miriam und verdrehte dabei schmunzelnd die Augen. Im Gegensatz zu uns hielt sie kein Glas mehr in der Hand, stützte dafür aber Jaina, die ungewohnt hibbelig war. Ich hatte vergessen, dass sie auf Alkohol reagierte wie ein Kind, dem man zu viele Süßigkeiten gegeben hatte.
»Ganz genau! Denn auch wenn das Konzept der Jahre und Monate und Tage und … Na ihr wisst schon, was ich meine.
Es ist eigentlich total blöd und ähnlich wie der Valentinstag ein Ding der Wandkalenderindustrie, aber ich finde, wir sollten die Situation ausnutzen, und das kommende zu unserem Jahr machen.«
Jainas betrunkene Ansprache entlockte mir ein nicht weniger angetrunkenes Lachen. Ratlos sah ich zu Miriam, die sich selber angesichts des Zustandes unserer Freundin das Grinsen nur schwer verkneifen konnte.
»Und das schaffen wir, indem wir Vorsätze machen?«, fragte ich anstandshalber.
»Exakt«, stieß Jaina etwas zu laut aus. »Du zum Beispiel, meine liebe Erin, solltest endlich mal leben! Denn bisher hast du dich verhalten wie … wie ein …«
»Schmetterling in einem Kokon?«, schlug Miriam vor. Ich warf ihr einen anerkennenden Blick zu.
»Ja! Es wird Zeit, dass du dich entpuppst und der Welt zeigst, was für hübsche bunte Flügel du hast. Trau dich endlich mal, Hindernisse zu überwinden, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen. Flieg drüber hinweg.«
»Okay«, war alles, was ich hervorbrachte, denn es war unmöglich zu sagen, wie viele von Jainas Worten ernst zu nehmen waren. Oder woran sie sich morgen überhaupt noch erinnerte.
»Und du!« Jaina drehte sich zu Miriam und tippte mit dem Zeigefinger auf ihre Nasenspitze. Miriam verengte die Augen zu einem leichten Schielen, was mich endgültig niederstreckte. Ich lachte zu laut und zog damit die Aufmerksamkeit der anderen Barbesucher auf uns.
»Du, Miriam Elizabeth Hemmingway, wirst endlich kämpfen für das, was du willst.«
»Ich kämpfe doch«, wandte sie zu ihrer Verteidigung ein und hob abwehrend die Hände. Selbst dabei sah sie noch beneidenswert gut aus. Einfach alles an ihr wirkte so … makellos. Als hätte sich ein Künstler hingesetzt und überlegt, wie die irische Mona Lisa aussehen könnte.
Alabasterhaut, die frei von jeder Hautunreinheit zu sein schien; dazu dickes, rotes Haar, das in weichen Wellen über ihre Schultern fiel. Volle Lippen, die bei einem Lächeln jedermann wundern ließ, wieso um alles in der Welt diese Frau noch Single war. Es war mir unbegreiflich, und wenn selbst sie niemanden fand, dann sollte ich wohl mein Erspartes darauf setzen, dass ich als schräge Hundelady endete.
»Pah.« Jaina schüttelte den Kopf. »Du ergibst dich deinem Schicksal. Du hast das Zeug, die nächste große Jessica Préalpato zu sein. Du könntest die beste Konditorin der Welt werden, wenn du nur die Arschbacken zusammenkneifen und kämpfen würdest.«
Miriam öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, ließ es dann aber doch sein. Jaina schien da einen Nerv getroffen zu haben, auch wenn ich noch nicht sicher war, worum es bei der Sache genau ging.
»Und du?«, fragte ich Jaina, um Miriam ein wenig aus dem Ziel unserer Freundin zu holen. »Was nimmst du dir vor?«
Obwohl damit zu rechnen war, dass der Kelch nicht an ihr vorbeigehen würde, wirkte sie ertappt. »Keine Ahnung«, erwiderte sie monoton. All die Euphorie über unsere Vorsätze war verschwunden. »Ich bin eigentlich schon ziemlich gut, so, wie ich bin.«
Miriam und ich starrten sie an – und brachen dieses Mal gemeinsam in schallendes Gelächter aus. Ich lachte so heftig, dass meine untrainierten Bauchmuskeln anfingen, wehzutun, und mir so heiß wurde, dass ich am liebsten in den Eiskübel mit den Champagnerflaschen gesprungen wäre. »Du bist … nicht perfekt«, presste ich keuchend hervor.
Jaina wirkte ein wenig eingeschnappt. »Natürlich nicht. Niemand ist perfekt. Aber ich bin sehr glücklich und im Reinen mit mir selbst, im Gegensatz zu euch beiden.« Sie deutete dabei abwechselnd auf Miriam und mich.
»Du solltest offener sein«, schlug Miriam vor, die sich schneller wieder in den Griff bekam als ich. Das Glück der Nüchternen.
»Ich bin offen«, konterte Jaina aus tiefster Überzeugung.
»Nun …« Miriam rang sichtbar mit sich. »Du bist schon etwas abwehrend gegenüber neuen Menschen.«
»Bin ich gar nicht.« Jaina stemmte die Hände in die Taille. »Ich schließe deutlich mehr neue Kontakte als ihr zwei zusammen … und das jeden Tag.«
»Aber nur, wenn es um deine Arbeit geht. Du netzwerkst, ja. Privat bist du dagegen … ein Stein.«
»Hey«, protestierte sie. Ich konnte nicht anders, als wieder loszukichern. Allmählich trug mich der Champagner ein wenig in die selige Albernheit. Dabei fiel mein Blick auf die Uhr und ich bemerkte, wie die Leute um uns herum zunehmend unruhiger wurden.
»Hört auf, zu streiten«, fuhr ich ihnen dazwischen. Ich deutete zur Bar, über der ein Flachbildfernseher hing. Der Countdown zählte bereits eifrig herunter. Wir hatten noch eine halbe Minute.
»Okay, meinetwegen«, lenkte Jaina großmütig ein. »Ich werde offener sein … oder zumindest versuchen, herauszufinden, was damit gemeint ist. Einverstanden?«
Wir nickten. Ich umschloss das Champagnerglas fester und sah mit Herzklopfen auf die sinkenden Sekunden.
So soll es sein.
Jaina würde offener gegenüber ihren Mitmenschen sein.
Miriam würde für das, was sie wollte, mehr kämpfen.
Und ich? Ich sollte mehr leben. Aber wie genau? Der Umzug nach New York, das Kündigen meiner alten Stelle, die Trennung von Chuck – reichte das nicht schon? War es das, was Jaina unter leben verstand? Oder fand sie, ich sollte etwas Verrücktes tun? Bungee springen zum Beispiel?
Oh Gott. Hoffentlich meinte sie nicht so was. Ich würde es niemals über mich bringen, aus einem Flugzeug zu springen. Oder war es mit dem Gummiseil von der Brücke hüpfen, in der Hoffnung, man knallte vor lauter Schwung nicht gegen irgendeine Mauer oder eine fiese Felsformation?
»Jaina!«, rief ich über den aufquellenden Lärm der herunterzählenden Gäste hinweg. Sie warf mir einen glasigen Blick über die Schulter zu. »Was meinst du damit, ich soll leben und Hindernisse … überwinden?«
Sie zog die Nase kraus und sah mich an, als stellte ich die dümmste Frage der Welt.
»Mach was, das du sonst nie tun würdest.«
Nein, nein, nein. Ich wollte wirklich nicht irgendwo runterspringen und dabei beten müssen, dass ich nicht als Matsch unten ankam.
»Aber was wäre das?«
Sie lachte und zuckte die Schultern. Anscheinend hatte sie ihren kurzen Groll gegen ihren eigenen Vorsatz vergessen. »Was weiß ich … so was wie …«
Ihr Blick schweifte an mir vorbei. Ich folgte ihm und erblickte den Typen, der vor wenigen Minuten noch von einer ganzen Schar Gäste umzingelt worden war. Jetzt stand er allein vor der Fensterfront und beobachtete mit einem zufriedenen Ausdruck im Gesicht den Countdown. Er sah wirklich unverschämt gut aus in seinem dunkelgrauen, legeren Anzug mit dem offenen Jackett, dem weißen Hemd und der einen Hand in der Hosentasche.
»Küss ihn.«
Ich starrte Jaina ungläubig an. »Was?«
»Du hast mich schon verstanden. Küss ihn um Mitternacht.«
»Aber …« Meine Gedanken überschlugen sich. Ich schaute wieder zu dem Fremden, dann zu Jaina. »Und wenn er eine Freundin hat? Oder das gar nicht will?«
»Wer weiß – du wirst es nur herausfinden, wenn du es versuchst. Das bedeutet es, zu leben. Geh ein Risiko ein.«
Fünfzehn …
Und damit war für Jaina das Gespräch beendet. Die Sekunden strichen dahin, aber in meinem Kopf fühlten sie sich träge und zäh an.
Das konnte unmöglich ihr Ernst sein. Ich konnte doch nicht einen wildfremden Mann küssen. Das war schon ziemlich übergriffig, oder nicht? Außerdem hatte Chuck erst vor wenigen Stunden mit mir Schluss gemacht.
Ich stand noch unter Schock, befand mich in Trauer.
Okay, so dramatisch war es nicht, aber trotzdem. Wie würde das aussehen, wenn ich …
Wen wollte ich eigentlich beeindrucken? Chuck war nicht hier. Meine Eltern waren nicht hier. Nur Jaina und Miriam kannten mich und ich war mir zu dreihundert Prozent sicher, dass sie mich dafür nicht verurteilen würden.
Zwölf …
Ich schluckte. Ein Kuss. Das war tatsächlich doch gar nicht dramatisch. Er sah gut aus, das machte die Sache durchaus leichter.
Zehn …
Ich ging zu ihm. Meine Beine zitterten ein wenig, und wenn ich das Glas noch fester hielt, drohte es, zu zerbrechen. Das wäre doch ein Auftritt …
Acht …
Ich blieb vor dem Fremden stehen. Seine untere Gesichtshälfte wurde von einem gepflegten, braunen Bart verdeckt. Seine Augen, die mir den Atem raubten, betrachteten mich neugierig.
Sechs …
»Hey«, begrüßte ich ihn mit wackelnder Stimme und hoffte, er würde mich über den Lärm hinweg verstehen. »Haben Sie … eine Freundin?«
Seine Mundwinkel zuckten. »Wie bitte?«
Vier …
»Haben Sie eine Freundin? Oder ein Date?«, wiederholte ich energischer.
Er sah kurz von mir weg, als würde er damit rechnen, dass jede Sekunde die versteckte Kamera hinter der Bar hervorsprang. »Nein, habe ich nicht.«
Zwei …
»Dann werde ich Sie gleich küssen. Bitte verklagen Sie mich deswegen nicht.«
Eins …
Um uns herum explodierte die Welt. Feuerwerk schoss aus allen Ecken hoch in den sternenklaren Nachthimmel und jemand ließ an der Bar die Sektkorken knallen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, schloss die Entfernung zwischen dem Fremden und mir und küsste ihn mit erstarrtem Herzschlag. Nach einem kurzen Zögern legte er den Arm um meine Taille und erwiderte den Kuss auf eine Weise, die meine Beine in Wackelpudding verwandelte. Etwas in mir flammte auf und ich vergaß, dass wir uns in einem Raum voller Menschen befanden. Ich drückte mich eng an ihn und gab mich ganz dem Moment hin.
Seine Lippen schmeckten nach Honig. Honig und Leben.
Kapitel 2
New York City war für mich der Ort, an dem Träume Wirklichkeit werden konnten. Meiner Meinung nach gab es keine andere Stadt auf der Welt, in der alles möglich war – egal ob man ein Mann oder eine Frau, weiß oder schwarz, jung oder alt, hetero- oder homosexuell war. Und das lag an den Menschen, die hier lebten. Mit harter Arbeit, Einfallsreichtum und Ehrlichkeit konnte man hier den berühmten amerikanischen Traum wahr werden lassen. Man wurde mit offenen Armen empfangen und an jeder Ecke boten sich zweite, dritte oder sogar vierte Chancen auf einem Silbertablett an.
Wenn man neu durchstarten wollte, dann war man hier genau richtig.
Eine Woche nach Silvester stieg ich mit meiner kleinen Reisetasche in ein Taxi und gönnte mir die teuerste Fahrt meines Lebens von Elizabeth nach Queens. Die Reise dauerte über eine Stunde, was genug Zeit war, damit mich meine Mom anrufen und abermals auf Knien anflehen konnte, es mir anders zu überlegen.
»Erin, du hast viel zu schnell aufgegeben«, sagte sie mit ihrer typischen Art einer Vorstadthausfrau, die noch gelernt hatte, meinem Dad – dem Hauptverdiener der Familie – das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Ich liebte sie, aber ich wollte nie werden wie sie. »Chuck ist ein guter Mann und vielleicht … Ich meine, womöglich hättest du …«
Ich unterbrach ihr Stammeln mit einem Seufzer. »Da gab es nichts, was ich hätte tun können.« Wir fuhren auf die George-Washington-Brücke, die Manhattan mit New Jersey verband. Die Oberfläche des Hudson Rivers schimmerte wie ein Meer aus Diamanten im kalten Licht der Sonne. Allein der Anblick füllte mein Herz mit neuer Zuversicht. »Und ich denke, dass Chuck möglicherweise recht hatte.«
Damit war die Katze aus dem Sack.
Eine Woche nach unserer plötzlichen Trennung war ich zu der Erkenntnis gekommen, dass er nicht ganz falsch gelegen hatte. Wir hatten uns festgefahren. Das bedeutete nicht, dass er mir nicht fehlte. Ich hatte nach Silvester drei Tage kaum das Bett verlassen, und das lag nicht daran, dass ich vom Champagner einen mörderischen Kater bekommen hatte.
Es waren die Erinnerungen an die sieben Jahre, die mir jeglichen Sinn fürs Leben raubten. Ich war so elendig einsam gewesen. Das Bett hatte sich ungewohnt leer angefühlt, die Wohnung still und verlassen. Niemand war mehr da. Nur ich, die furchtbare Einrichtung und die Erinnerungen, die wie rastlose Geister zwischen den Wänden umherwanderten.
Ich hatte in den Tagen viele Dokumentationen und Shows geguckt, in denen Menschen von vorne anfingen. Sie hatten ihre Jobs verloren, schlimme Beziehungen hinter sich gebracht oder eine schwere Krankheit überlebt. Aus allen negativen Erfahrungen waren sie gestärkt hervorgegangen und sie fingen daraufhin an, ihr Leben umzukrempeln.
Inspiriert von den Geschichten legte ich damit los, meinen Kleiderschrank auszusortieren. Ich hatte schon länger vorgehabt, mal so richtig auszumisten, aber wie es mit den meisten Vorhaben in dieser Richtung war, hatte ich es nur aufgeschoben. Mir fielen immer etliche Ausreden ein, mich nicht an einem Sonntag hinzusetzen und Hosen auszumustern, in die ich nicht mehr passte. Chuck mit seiner Vorliebe, sich an alte Dinge zu klammern wie ein Baby an die Brust seiner Mutter, war da auch keine große Hilfe gewesen.
Nur dieses Mal bekam ich wirklich meinen Hintern hoch und es war milde gesagt eine absolute Erleuchtung.
Als Teenager war ich nie ein mädchenhaftes Mädchen. Mom hatte versucht, mir als Kind Rüschenkleider mit schwarzen Lackschühchen schmackhaft zu machen. Sie war kläglich daran gescheitert, nachdem ich mehrere Male in Pfützen gesprungen war und mir beim Spielen Löcher in die Röcke gerissen hatte.
Klamotten mussten für mich immer schon praktisch und bequem sein, damit ich in ihnen auf Bäume klettern und Hütten im Wald bauen konnte. So sah meine liebste Freizeitbeschäftigung aus und das ging am besten in Latzhosen und Turnschuhen.
Heutzutage trug ich so was nach wie vor gern, aber ich hatte mich ein bisschen der Mode angepasst. Zumindest hatte ich das geglaubt, denn mein Kleiderschrank redete eine ganz andere Sprache.
Ich besaß so viele Jogginghosen und ausgeleierte Shirts, dass ich mich unweigerlich fragte, was ich auf der Arbeit angezogen hatte. Nicht, dass ich diesen Sachen plötzlich abgeneigt wäre, aber herauszufinden, dass meine Garderobe zu neunzig Prozent aus ihnen bestand, schockierte mich. Wo waren die hübschen engen Jeans hin, die ich an der Highschool so geliebt hatte? Und meine offenen Riemchensandalen aus dem ersten Sommer am Campus in New York?
Das alles war ersetzt worden durch alte Shirts, die zum Teil Chuck gehörten. Leider konnte ich nicht einmal behaupten, ich hätte sie nur zum Schlafen getragen.
Ketchupflecken, Fettflecke und anderer, undefinierbarer Schmutz, den die Waschmaschine nicht hatte entfernen können, zeugten von zu vielen Gammelabenden, an denen ich mir gar nicht erst die Mühe gemacht hatte, mich herauszuputzen.
Und grundsätzlich war das nicht schlimm.
Es war schön, dass Chuck völlig egal gewesen war, wie ich aussah. Aber es war gleichermaßen traurig für mich, dass ich mich so hatte gehen lassen. Das, was in dem Schrank hing, war nicht ich. Das war nicht der Mensch, der ich mal hatte werden wollen. Und das hatte mir die Augen geöffnet.
»Liebes, ich weiß, eine Beziehung ist hart, aber man muss für sie kämpfen, wenn sich eine Krise am Himmel auftut. Stürme ziehen wieder vorbei.«
Ich lächelte matt über Moms Weisheiten, die dazu geführt hatten, dass sie und Dad auf viele glückliche Ehejahre zurückblickten. Bestimmt hatte sie sogar recht, doch manche Stürme waren einfach zu groß, um sie auszusitzen.
Mom ließ mich erst auflegen, als der Taxifahrer von der Interstate 278 auf die Robert F. Kennedy Bridge fuhr und wir damit den East River überquerten, der zwischen Randalls Island und Queens lag. Jaina wohnte in einem vierstöckigen Backsteinhaus in der Crescent Street. Da wir uns immer auswärts getroffen hatten, kannte ich die Wohnung nur von Fotos, und ich war gespannt, was mich erwarten würde. Meine beste Freundin war vor einem Jahr mit ihrem älteren Bruder Paul hier eingezogen, der sich zu der Zeit als Fotograf hauptberuflich selbstständig gemacht hatte. Sie wiederum hatte bereits zu unserer Collegezeit angefangen, sich ein Business als Bloggerin aufzubauen. Wenn man sie so sah, glaubte man nicht, dass sie damit ihr Geld verdiente. Jainas ehrliche und authentische Art hatten ihr aber schnell so einige treue Leser und Follower eingebracht, die dazu führten, dass Firmen mit ihr zusammenarbeiten wollten. Dadurch konnte sie sich dieses Drei-Zimmer-Appartement scheinbar locker leisten.
Das Taxi hielt direkt vor der Eingangstür. Für einen Moment zögerte ich. Ich bemerkte aus dem Augenwinkel, wie unruhig der Fahrer wurde, aber mein Hintern fühlte sich an, als klebte er am Sitz fest. Wenn ich jetzt die Tür öffnete und den Fuß auf den Bordstein stellte, dann gab es für mich kein Zurück mehr.
Okay, das klang etwas melodramatisch.
Ich könnte jederzeit nach Elizabeth zurückkehren und meinen alten Job bei Dad in der Firma machen. Rein metaphorisch gesehen, war ich aber auf mich allein gestellt, wenn ich mich dazu entschied, mit Jaina zusammenzuziehen. Es gab keinen Chuck mehr, an dem ich mein Leben orientieren musste. Keine Mom und kein Dad, die mir sagten, was die richtige Entscheidung war. Es würde an mir liegen.
Aussteigen und nach vorne zu schauen, anstatt gedanklich in einer sieben Jahre alten Blase festzuhängen, war der erste Schritt.
Der erste Schritt zu meinem neuen, glücklichen Ich mit dem perfekten Leben und dem verdienten Happy End. Genau das war mein Ziel.
Ich bezahlte den Fahrer, der einen erleichterten Laut ausstieß, und öffnete die Tür. Als ich festen Boden unter meinen Füßen spürte, griff ich nach meiner Tasche und stieg aus. Die Sonne war inzwischen hinter schweren grauen Wolken verschwunden, die aussahen, als würde es jede Sekunde anfangen zu schneien. Ich atmete die Kälte ein, die meine Lungen fast unangenehm füllte, und schaute mich um. Im Erdgeschoss befand sich Hemmingway Bakery, die Bäckerei und Konditorei von Miriams Eltern. Auf diese Weise hatten sich sie und Jaina kennengelernt.
Im Frühling war es hier bestimmt schöner. Der bisher schneelose Winter ließ die Gegend etwas blass und trist wirken, aber die kahlen Bäume und die mageren Sträucher würden, sobald es wärmer wurde, mehr Farbe in das Viertel bringen. Das Haus selbst sah gepflegt aus. Die roten Backsteine hoben sich vor dem grauen Himmel ab und Feuerleitern führten von Wohnung zu Wohnung bis runter zur Straße. In manchen Fenstern hingen Klimaanlagen, und ich betete, dass Jaina auch eine besaß. Im Sommer konnte es in New York unerträglich warm werden.
Ich ging drei Stufen hoch zu einer doppelflügeligen Eingangstür. Daneben befand sich ein Klingelbrett, auf dem ich den Namen Campbell suchte. Bevor ich den passenden Knopf drückte, wurde mir klar, dass dort auch bald meiner stehen würde. Philipps.
Erin Philipps, die in der Crescent Street in Astoria, Queens, wohnte.
In New York City, wo einfach alles möglich war.
Das Gebäude besaß glücklicherweise einen Fahrstuhl. Der machte sogar einen vertrauenserweckenden Eindruck, davon abgesehen, dass er furchtbare Musik in einer immer gleichbleibenden Schleife abspielte.
Während die Zahlen auf dem Display sehr langsam hochzählten, öffnete ich meinen neugekauften schwarzen Wintermantel und lockerte den cremefarbenen Kaschmirschal, den ich mir vom letzten Gehaltsscheck mit einer neuen Garderobe gegönnt hatte. Er war unheimlich weich, warm und viel zu teuer, aber Jaina hatte gesagt, ich sollte endlich leben, also hatte ich das Geld unvernünftigerweise auf den Kopf gehauen. Der Rest war für die Taxifahrt hierher draufgegangen.
Als die Fahrstuhltüren aufglitten, war ich gerade dabei, mir die Mütze runterzuziehen, als ich in jemanden hineinrannte.
Mein erster Tag im neuen Leben und ich tackelte wie ein Quarterback den nächstbesten Menschen fast zu Boden. Warum überraschte mich das nicht?
Mein Gegenüber stolperte rückwärts, wir angelten nach der Hand des jeweils anderen und am Ende konnte ich uns nicht beide halten und wir flogen hin. Ich fiel zum Glück auf ihn und damit weich, aber er stieß ein Geräusch aus, dass sofort Sorge und Mitleid in mir hervorrief.
»Mist«, fluchte ich und stützte mich mit den Händen links und rechts neben seinem Gesicht ab, um seinen Blick zu suchen. Erst jetzt bemerkte ich, dass das nicht irgendein Fremder war, sondern Paul – Jainas Bruder. »Shit. Hast du dir wehgetan?«
Er blinzelte überrascht und schüttelte zu meiner Erleichterung den Kopf. Braune Locken fegten über seine Stirn. »Alles gut, aber deine Haare kitzeln in meiner Nase.«
Er strich meine Strähnen aus seinem Gesicht.
»Ach herrje.« Ich setzte mich auf, nur um festzustellen, dass ich damit auf Paul saß und sich die Situation dadurch von unangenehm-schmerzhaft in unangenehm-peinlich verwandelte. Rasch stieg ich von ihm runter und reichte ihm eine Hand, die er ergriff. »Es tut mir furchtbar leid. Ich habe dich nicht gesehen.«
Er lachte und zog seine dunkelgrüne Outdoorjacke zurecht. »Dabei dachte ich, einsachtzig ist groß genug, um nicht von den Frauen über den Haufen gerannt zu werden.«
»Ich glaube, dass Problem bist nicht du, sondern ich«, gestand ich mit einem entschuldigenden Lächeln. Es war beinahe mehr Glück als Verstand, dass es Paul erwischt hatte und nicht irgendeinen zukünftigen Nachbarn. Jainas Bruder kannte ich bereits aus Collegezeiten ganz gut. Er würde mich wohl nicht verklagen, sollte bei unserem Sturz irgendetwas zu Bruch gegangen sein.
»Sieh dir das Chaos an«, sagte ich und deutete auf den Inhalt seiner Kiste, der sich auf dem dunkelblauen Flurteppich verteilte.
Ich entdeckte leichtes, nicht allzu teuer wirkendes Kameraequipment, einen Kulturbeutel, ein paar Klamotten und einen großen Teddybären. Instinktiv beugte ich mich runter und griff nach Letzterem. »Ist das deiner?«, fragte ich schmunzelnd.
»Nein, Mr Bubbles gehört Jaina.« Ich könnte darauf wetten, dass meine Freundin alles dafür tat, um die Existenz dieses Kuscheltieres vor der Welt geheim zu halten. »Sie wollte, dass ich ihn mitnehme.« Er zuckte die Schultern und schenkte mir ein unschuldiges Großer-Bruder-Lächeln. »Ich schätze, sie hat Angst, dass ich in der neuen Wohnung vereinsame.«
»Bestimmt«, erwiderte ich voller Behaglichkeit im Herzen. Jainas und Pauls Beziehung zueinander war beneidenswert. »Komm, lass uns deine Sachen einsammeln.«
Wir gingen in die Hocke und in wenigen Minuten hatten wir alles, was er bei sich getragen hatte, zurück in die Kiste geräumt. Ich griff nach einer kleinen Plastikdose, in der Speicherkarten klapperten, als Paul etwas sagte, womit ich nicht gerechnet hatte.
»Es ist übrigens toll, dass du wieder in New York bist.«
Ich schob mir ein paar lose Haarsträhnen hinters Ohr, die bei der Zusammenräumaktion abermals in mein Gesicht gefallen waren und nun drohten, in meinen Wimpern hängenzubleiben »Oh, echt?«
Er nickte. »Jaina hat dich sehr vermisst.«
»Ich sie auch. Mit ihr zusammenzuwohnen, ist einfach nie langweilig.« Ich stieß ein knappes Lachen aus, als mir klar wurde, wem ich das erzählte. »Aber das weißt du ja selber am besten.«
»Allerdings.« Er rieb sich mit der freien Hand am Hals. »Es tut mir natürlich für dich und deinen Freund leid.«
»Ja, es kam sehr … unerwartet.« Ich umschloss den Henkel meiner Reisetasche fester. Auf einmal kam es mir vor, als hätte sich das Gewicht der darin befindlichen Sachen verdreifacht. »Aber ich denke, es ist besser so. Ich wünsche Chuck, dass er findet, wonach er sucht.«
»Du nimmst das erstaunlich gut auf.« In seiner Stimme lag weder Argwohn noch Skepsis. Er wirkte eher beeindruckt, und zwar auf eine positive Art, wobei das auch Einbildung sein konnte. So gut kannte ich ihn nicht, um seine unausgesprochenen Gefühlsregungen punktgenau zu deuten.
»Mir bleibt nichts anderes übrig«, schlussfolgerte ich mit einem tapferen Lächeln. So cool ich nach außen blieb, umso schwerer fiel es mir trotz aller Einsicht, in mir drinnen die Fassung zu wahren.
Es waren immerhin sieben Jahre gewesen. Sieben verdammte Jahre. Das hinterließ eine große Wunde, die jederzeit wieder bluten konnte. Aktuell tat sie nur weh und ich hatte nicht das Bedürfnis, sie durch Erinnerungen und Gespräche über Chuck aufzureißen. Das fanden nur Masochisten toll.
»Er muss ein ziemlicher Idiot sein, wenn er mit dir Schluss gemacht hat.« Paul drückte den Knopf zum Fahrstuhl, während mir seine Worte und ihre Bedeutung noch einmal durch den Kopf gingen. Die Aufzugtüren glitten hinter mir auf. Ich machte einen Schritt zur Seite und ließ Paul vorbei. Er blieb mit seiner Kiste im Arm auf den Schienen stehen, sodass die Türen im Rahmen verweilten. »Falls du mal Lust hast und meine Schwester dich doch langweilt, könnten wir irgendwann einen Kaffee trinken gehen.«
Oh. Das kam unerwartet.
»Gerne.« Was hätte ich sonst sagen sollen? »Irgendwann klingt … gut.«
»Super. Ich denke, wir dürften uns nun öfter über den Weg laufen.« Aus dem hinteren Teil des Flures erklang ein hohes, ungeduldiges Bellen, was Paul als auch mir ein Lachen entlockte und die ganze Situation auflockerte. »Geh jetzt besser. Bubbles wartet schon.«
Ich nickte, hob die Hand zum Abschied und drehte mich weg. Hinter mir vernahm ich das typische Geräusch von sich schließenden Fahrstuhltüren. Erleichtert schnappte ich nach Luft. Sicher irrte ich mich, aber mit Paul – und zwar nur mit Paul – einen Kaffee zu trinken, fühlte sich ein bisschen wie ein Date an. Mir fiel es vielleicht schwer, allein zu sein, doch mit dem Bruder meiner besten Freundin auszugehen, schien mir nicht allzu clever. Davon abgesehen, dass ich bis heute nie den Eindruck hatte, er wollte mit mir ausgehen – und zwar nur mit mir.
Kopfschüttelnd lief ich den Flur hinunter. Meine Fantasie spielte mir einen Streich. Generell war mein Gehirn die letzten Tage nicht unbedingt mein bester Freund gewesen, aber wir hatten keine andere Wahl. Wir hingen aneinander fest und mussten irgendwie miteinander klarkommen.
Plötzlich hielt ich mitten auf dem Flur etwas Großes, Goldblondes mit kalter Nase und leichtem Mundgeruch im Arm.
Bubbles. Ich war vor der Haustür in die Hocke gegangen, um mir von Jainas Golden-Retriever-Dame einen feuchten Begrüßungskuss abzuholen.
Bubbles war einer meiner absoluten Lieblingshunde. Sie musste ungefähr ein Jahr alt sein, und ich hatte sie das letzte Mal gesehen, als Jaina und ich uns mit ihr vor ein paar Monaten im Central Park getroffen hatten. Damals war Bubbles noch ein Welpe gewesen und größentechnisch nicht mit dem Hund zu vergleichen, der jetzt auf den Hinterbeinen stand, seine Pfoten auf meine Schultern legte und mir am liebsten komplett auf den Schoß gekrochen wäre. Ihr menschenliebendes Wesen hatte sich nicht verändert.
»Bubbles, runter«, befahl Jaina mit strenger Stimme. Sie wartete in einer kurzen, dunkelblauen Jeanslatzhose im Türrahmen und sah die Hündin aus zusammengekniffenen Augen an. Bubbles folgte dem Befehl etwas zögerlich, aber lief, bevor es noch mehr Ärger gab, schwanzwedelnd zu ihrem Frauchen.
Ich lachte. »Verrückt, wie groß sie geworden ist«, stellte ich fest und begrüßte meine Freundin mit einer innigen Umarmung. Danach trat sie zur Seite und ließ mich in die Wohnung.
»Ja, das stimmt. Sie ist gewachsen wie Unkraut und hat darüber hinaus irgendwie immer noch nicht verstanden, dass sie längst keine fünfzehn Kilo mehr wiegt.«
Was, wie ich fand, auch schon ein ziemliches Kampfgewicht war.
»Das habe ich gemerkt.« Grinsend zog ich meinen Mantel aus und legte ihn über meine Armbeuge. Bubbles war bereits in das Herzstück der Wohnung gelaufen, wo ein Napf mit Wasser auf sie wartete.
»Wow«, stieß ich aus und ließ meinen Blick über den offenen Eingangsbereich wandern. Die Wohnung sah live noch viel atemberaubender aus. Der Flur war kaum als solcher zu bezeichnen, aber dadurch, dass er direkt in das Wohnzimmer mit der Küche überging, wirkte der ganze Raum hell und weitläufig. Jaina und Paul hatten sich dazu entschieden, das rote Backsteinmauerwerk größtenteils hinter weißen Tapeten zu verstecken. Demzufolge reflektierte selbst im Winter das hereinfallende Licht von den Wänden und schenkte der Wohnung somit zumindest optisch etwas an Größe.
Die Möbel waren eine Mischung aus Flohmarktfund und Pottery Barn, die im Grunde auch nichts anderes taten, als teure neue Einrichtung nach altem Stil zu bauen. Und doch passten die Couch, der kleine Tisch – es war mehr eine abgewetzte Reisetruhe, die als Tisch fungierte –, die Stehlampe mit dem übergroßen Lampenschirm und der cremefarbene Teppich mit marokkanischem Muster unheimlich gut zusammen. Meine Abneigung gegen Secondhandmöbel verschwand augenblicklich. Begeistert saugte ich die Eindrücke der hellen Einrichtung mit den dunklen Holzakzenten wie ein Schwamm auf.
Bevor ich mehr sehen konnte, zog mich Jaina in die entgegengesetzte Richtung. »Komm, ich zeige dir dein Zimmer.«
Der Raum, der mir gehören sollte, passte optisch zum Wohnzimmer. Weiße Wände, ein frisch gebohnerter Boden. Mein neues Reich.
»Es sind nur knapp vierzehn Quadratmeter, aber …«
»Es ist perfekt«, fiel ich ihr ins Wort. Ich wandte meinen Blick von dem Zimmer ab und sah meine Freundin an. »Wirklich. Daraus kann man viel machen. Daraus kann ich viel machen.«
Jaina grinste. »Na dann – leg los.«
Okay, mein Enthusiasmus wurde dadurch etwas ausgebremst, dass ich praktisch keine Einrichtung besaß. Außer einem Einbauschrank und dem Bett, das Paul netterweise dagelassen hatte, stand in dem Raum absolut nichts und ich selbst hatte auch alle Möbel in der Wohnung – nunmehr Chucks Wohnung – zurückgelassen.
Was rückblickend nicht allzu schlau war. Zumindest wäre ein Tisch nicht schlecht gewesen. Oder eine Lampe, denn aktuell baumelte nur eine trostlose Glühbirne von der Decke. Und ich brauchte dringend Vorhänge. Zurzeit konnte mir der Nachbar von gegenüber ins Zimmer schauen, und ich war nicht darauf aus, kostenlose Peepshows zu geben.
Nachdem ich mich ausgezogen und Bubbles noch einmal ausgiebig den wuscheligen Bauch gekrault hatte, ließ ich mich auf das Sofa fallen. Was ich bei meiner Ankunft nicht gesehen hatte, war der hübsche, aber falsche Kamin gegenüber der Couch, und den darüber angebrachten Flachbildfernseher an der Wand. Diese Wohnung war wirklich traumhaft. Kein Wunder, dass Jaina trotz der hohen Miete nicht gezögert hatte, hier einzuziehen.
Zumal die Kosten im Vergleich zu anderen Bezirken in New York fast schon geschenkt waren. Aber auch nur fast.
»Okay, ich brauche Möbel«, stellte ich fest und setzte mich aufrecht in den Schneidersitz. Bubbles legte den Kopf flehend auf das Sofakissen. Fragend schaute ich zu Jaina, die mir mit einem stillen Nicken zu verstehen gab, dass sie auf die Couch durfte. Ich klopfte auf den Stoff und schon hing die Hündin halb auf mir und ließ sich den Nacken kraulen.
»Sie hat dich viel zu schnell um den Finger gewickelt«, bemerkte Jaina und reichte mir eine Tasse mit frisch gekochtem Kaffee.
Ich senkte den Blick und schaute lieber in Bubbles’ braune Augen als in Jainas Gesicht, das mir hochgradige Schwäche gegenüber süßen Hunden attestierte. Es war sowieso sinnlos, es zu leugnen. »Hättest du dir eine Schlange geholt, wäre ich deutlich willensstärker.«
»Hätte ich mir eine Schlange geholt, würde die hier alleine wohnen, was unfassbar teuer und unfassbar blöd für uns alle wäre.«
Da hatte sie recht. Sowohl Jaina als auch ich hatten echt Angst vor Schlangen. Darüber würde es also keinen Streit geben.
»Aber zurück zu der Möbelfrage.« Jaina setzte sich in einen Sessel, der schräg neben der Couch stand. »Wie groß ist dein Budget?«
»So klein, dass es dem Wort Budget wohl eher nicht gerecht wird.«
»Dachte ich mir.« Sie brummte nachdenklich. »Du könntest auf dem Flohmarkt welche kaufen. Morgen findet in der Nähe einer statt. Die Sachen sind nicht schlecht, aber manchmal muss was dran gemacht werden. Ansonsten gibt es auch noch die Sozialkaufhäuser.«
Ich schüttelte energisch den Kopf. »Nein, Flohmarkt ist okay. Sozialkaufhaus kommt nicht in Frage.«
»Nur … du hast praktisch kein Geld und keinen Job.«
»Trotzdem. Ich will nicht Leuten etwas wegnehmen, die es dringend gebrauchen könnten.«
Jaina zuckte die Schultern. »Okay, dann geht es morgen Früh auf den Flohmarkt. Weißt du denn schon, was du alles brauchst?«
»Nicht so richtig. Ein paar Dinge wie ein Lampenschirm, Vorhänge … so was halt.« Ich biss mir auf die Unterlippe und sah hilfesuchend zu Bubbles, deren Kopf auf meinen Oberschenkel lag und die drohte, jeden Augenblick ins Reich der Träume zu verschwinden. »Was hatte Paul denn im Zimmer?«
»Einen Arbeitsplatz mit PC, einen Sessel, auf dem er seine Klamotten immer abgeworfen hat, und ein paar Regale, in denen er seine Bücher, Fotozeitschriften und Kameras aufbewahrte. Er war die meiste Zeit sowieso unterwegs und hat sich nur zum Arbeiten und Schlafen in sein Zimmer zurückgezogen.«
»Verstehe.«
»Die Frage ist also, was du mit deinen vier Wänden anstellen willst.«
»Was wiederum die Frage aufbringt, was ich generell anstellen will.«
Jaina nickte. »Gut möglich, ja. Da du dich aber nicht selbstständig machen möchtest, wird es vor allem als Schlafzimmer dienen. Ich habe gesehen, dass du auch nicht viel aus der alten Wohnung mitgenommen hast.«
»Nein, das meiste sind Klamotten, den einen oder anderen Film … so was halt.«
»Wie wäre es dann, wenn wir drei Regale an der Wand anbringen, dir einen hübschen Sessel mit Fußhocker besorgen und eine Stehlampe? Oh, und ein paar pflegeleichte Zimmerpflanzen.«
Bei jedem ihrer Worte füllte sich der Raum in meinen Gedanken mit den erwähnten Stücken. Mir gefiel das Bild sehr, das sich daraus ergab. »Klingt gut. Aber du musst morgen mitkommen. Du hast ein unglaubliches Händchen für so was.«
Sie zog die Beine an und kuschelte sich tiefer in ihren Platz. »Ich verdiene damit quasi mein Geld. New Yorker Lifestyle ist nicht nur Lokalpolitik und das neueste Restaurant, sondern auch Ästhetik. Die Menschen lieben es, sich online anzusehen, wie Wohnungen eingerichtet sind.«
»Tja, das ist ein Grund mehr, wieso du damit Karriere machst und mir auf Instagram außer dir nur noch meine halbe Familie folgt.«
Worüber ich nicht traurig war. Ich bewunderte Jaina für ihr Business, aber die Onlinewelt war einfach nicht die meine. Mir graute schon davor, womöglich auf Dating-Apps zurückgreifen zu müssen, um jemanden kennenzulernen.
Ein Geräusch im Hausflur ließ Bubbles aufschrecken. Noch bevor wir wussten, was los war, sprang sie von der Couch, rannte zur Tür und blieb erwartungsvoll stehen. Ich sah fragend zu Jaina, die wiederum nur auf ihre schmale Armbanduhr schaute und nickte. Dann öffnete sich die Wohnungstür und Miriam trat in einer engen Jeans, Ankle Boots und einem dunkelgrünen Sweater ein.
»Ah, hey Erin«, begrüßte sie mich gut gelaunt. Ihre Aufmerksamkeit lag nicht lange auf mir. Bubbles nahm sie sofort für sich ein und es dauerte ein paar Minuten, bis sie Miriam wieder freigab.
Ich warf Jaina derweil einen fragenden Blick zu. »Miriam bringt einmal am Tag was aus der Bäckerei hoch. Da Paul und ich nicht immer da waren, hat sie einen Schlüssel.«
Das fand ich erstaunlich unkonventionell. Wäre es nicht seltsam, wenn einer der beiden mal Besuch gehabt hätte und Miriam plötzlich auftauchte? Obwohl … dafür besaß ja jeder sein eigenes Zimmer.
»Ich habe Torte und frisches Brot dabei«, erklärte Miriam, die sofort in die Küche lief, dicht gefolgt von Bubbles. »Dad hat dein Lieblingsbrot gebacken«, sagte sie an Jaina gewandt.
»Uh«, stieß sie aus und erhob sich. »Ist es noch warm?«
Miriam warf ihr ein Lächeln über die Schulter zu. »Wärmer kann es kaum sein, daher ist es auch nicht geschnitten. Und da ich nicht wusste, wann Erin kommt, habe ich Erdbeertorte mitgebracht. Ich hoffe, das schmeckt dir?«
Nun war ich diejenige, die am liebsten freudestrahlend aufgesprungen wäre. Aber ich blieb sitzen, um nicht noch mehr Hektik in die Runde zu bringen. Jaina tänzelte bereits zusammen mit Bubbles um die Lieferung herum.
»Wenn ich auf diese Frage jemals mit nein antworte, müsst ihr mich erschießen«, sagte ich mit einem Lächeln und beobachtete das bunte Treiben.
Die offene Küche bestand aus einer Theke mit Unter- und Hängeschränken sowie einer schmalen Insel, die als Essplatz und Raumtrenner diente. Es gab einen großen Kühlschrank, einen Herd mit Dunstabzugshaube, sogar eine Mikrowelle und einen Geschirrspüler. Damit gab es eine bessere Ausstattung als in meiner alten Wohnung.
Nachdem Miriam Jaina und Bubbles vom Brot verscheucht hatte, servierte sie uns die Tortenstücke. Aus Platzgründen musste die Hündin dieses Mal mit dem Boden vorliebnehmen, denn Miriam setzte sich neben mich aufs Sofa. Ausgestattet mit Kaffee und Torte, wandte sie sich mir zu.
»Wie gefällt es dir hier?«, fragte sie mit diesem freundlichen Ausdruck in den Augen, der offenes Interesse widerspiegelte.
»Ganz gut. Die Wohnung ist wahnsinnig schön«, gab ich zu und kostete den Kuchen. Optisch sah er wie jede andere Torte aus. Drei Reihen mächtige Sahne wechselten sich mit drei Reihen Biskuitboden ab. Erst im Mund entfaltete sich der geschmackliche Zauber, denn die Schichten wurden von einem feinen Erdbeeraufstrich voneinander getrennt.
Ich hätte mich am liebsten in dem Tortenstück gewälzt, so lecker war es.
»Wir wollen morgen zum Flohmarkt«, erzählte Jaina. »Erin braucht dringend ein paar günstige Möbel.«
Miriams Lächeln wurde zu einem Strahlen. »Kann ich mitkommen?«
Ich sah zu Jaina. Sie nickte. »Klar. Sechs Augen sehen mehr als vier.«
Wir verabredeten uns für die frühen Morgenstunden – nur da gab es angeblich die wirklichen Schätze, darin waren sich beide einig. Ich dagegen konnte noch nicht so richtig glauben, dass ich dort etwas fand, dass mir gefallen würde. Meine Flohmarkterfahrungen mit Chuck hatten mich dahingehend irgendwie traumatisiert, doch ich wollte zuversichtlich bleiben. Jaina hatte in der Vergangenheit offenbar einige tolle Stücke ergattert.
»Hast du eigentlich schon Vorstellungsgespräche?«, fragte Jaina zwischen einem Bissen Torte und einem Schluck aus einer Kaffeetasse, auf der ein Foto von Bubbles abgedruckt war.
Ich schüttelte den Kopf und spürte einen Anflug von Unsicherheit in mir. »Direkt nach Neujahr sind die meisten Firmen noch gar nicht richtig besetzt.«
»Auch wieder wahr«, stimmte Jaina zu. »Aber ich halte mal die Augen offen. In New York gibt es eigentlich immer etwas zu tun.«
»Bestimmt«, murmelte ich und zerpflückte dabei gedankenverloren mein Stück Torte. Ich wollte definitiv arbeiten. Beschäftigung war genau das, was ich jetzt brauchte, nur wollte ich auch anständig bezahlt werden. Jaina hatte recht – in der Stadt gab es Unmengen an Jobs, aber nur ein Bruchteil bot faire Konditionen. Wenigstens eine Krankenversicherung und Mindestlohn waren mir wichtig, und damit siebte sich leider schon ein ziemlich großer Teil der offenen Stellen aus.
Es brauchte eben nicht nur in der Liebe eine Portion Glück.