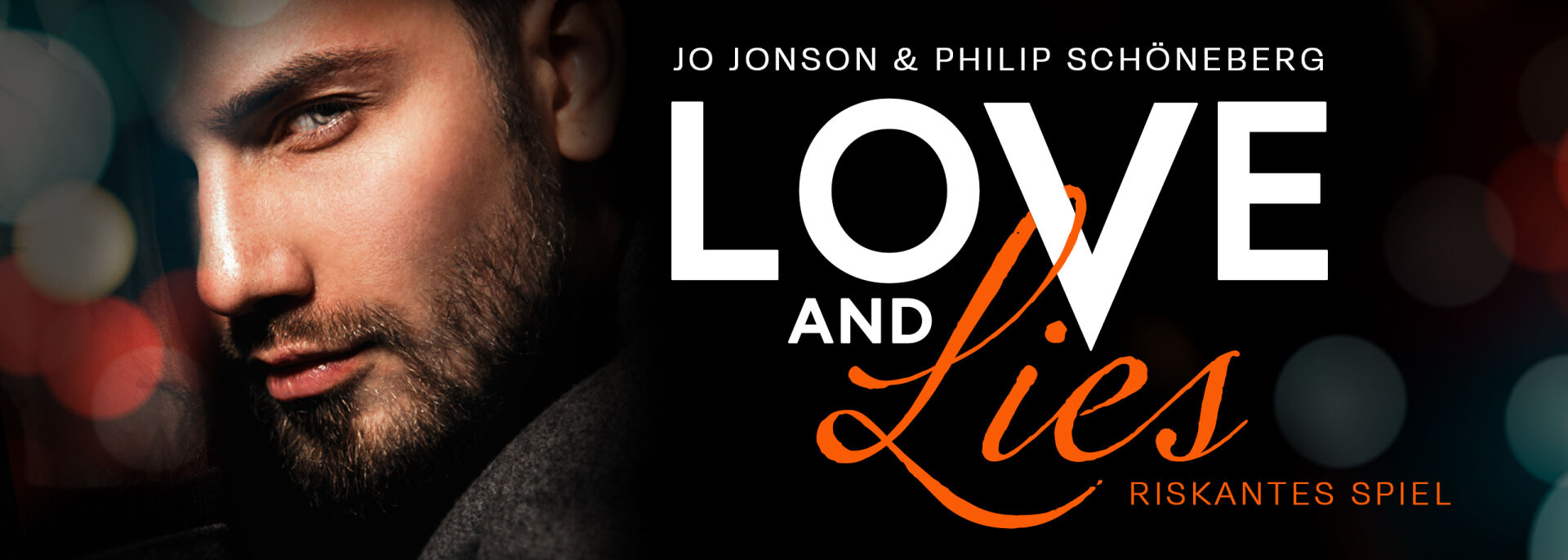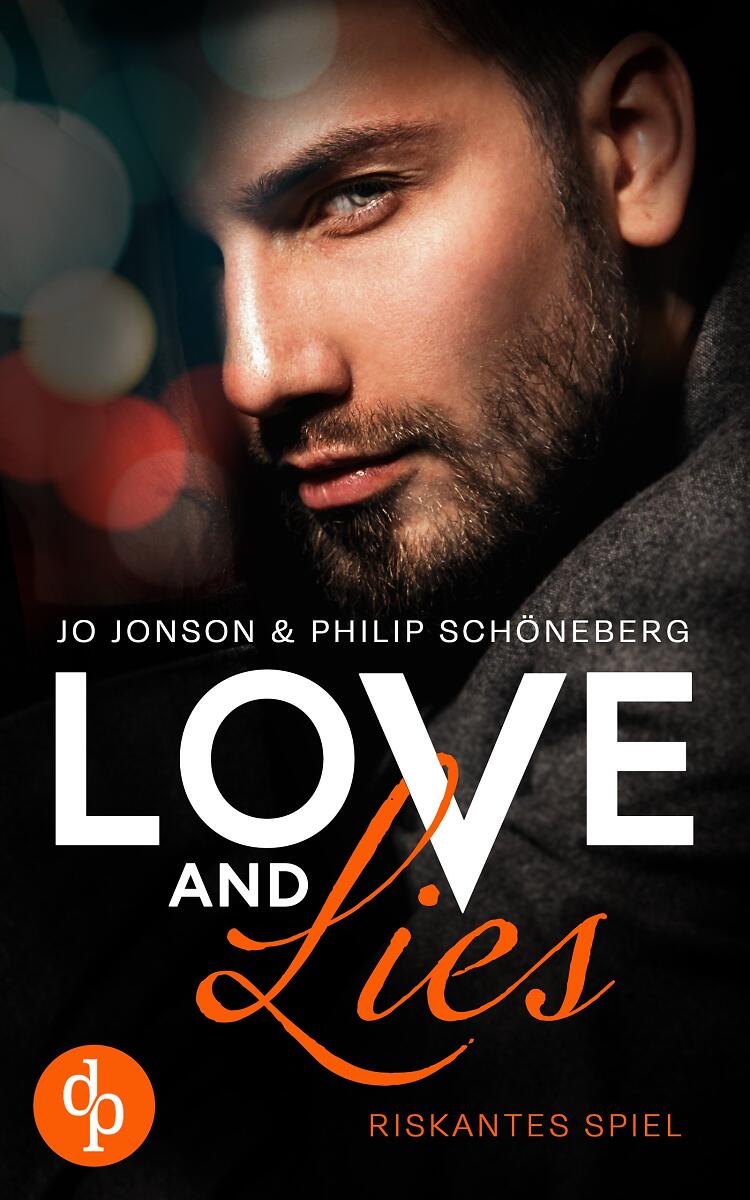Kapitel 1
Klatschmohn in der Gegend von Argenteuil
~ Claude Monet ~
Gedankenverloren sah Samantha aus dem Fenster auf die Straße, die sich unter dem prasselnden Regenguss langsam in einen reißenden Fluss verwandelte. Sie spülte die Teller mechanisch, wie alles, was sie in dem Haus tat, das sie in ihrem Kopf als gläsernes Gefängnis bezeichnete. Es war eines dieser modernen Häuser mit einer Fassade aus Glas und exklusiven Möbeln, die auf dem teuren Boden um den ersten Preis einer Schönheitskonkurrenz wetteiferten, die erst noch erfunden werden musste. Es war ein dreistöckiges wunderschönes Gebäude mit einem Spitzdach aus dunkelgrauem Schiefer und besaß einen Salon für Robert und seine Geschäftsfreunde, den sie nur betreten durfte, wenn sie ihnen Häppchen und Aperitifs servierte. Direkt daneben befand sich eine Bibliothek mit Büchern, von denen sie kein einziges interessierte. Nicht dass sie nicht gern gelesen hätte, doch ihre Groschenromane – wie ihr Mann sie nannte – fanden genauso gut in ihrer Kommode im Schlafzimmer Platz. Das Wohnzimmer beherrschte beinahe das gesamte Untergeschoss und bot keinerlei Gemütlichkeit bis auf die kleine Ecke weitab der verglasten Wände, die sie sich in einem langen Disput mit ihrem Mann erkämpft hatte. Ein hölzerner Schaukelstuhl vor dem Kamin, von dem aus sie das Treiben draußen beobachten konnte, ohne selbst gesehen zu werden. So war es ihr am liebsten.
Es gab noch viele weitere perfekt eingerichtete Räume im Haus, die niemand jemals betrat außer ihr Hausmädchen Nancy. Ohnehin war Samantha die meiste Zeit in der Küche. Zuerst, weil Robert es verlangt hatte. „Eine anständige Ehefrau soll in der Lage sein, ein anständiges Essen zu kochen.“
Irgendwann hatte ihr das Herumexperimentieren mit den verschiedenen Zutaten und Gewürzen Spaß gemacht und ihrem Leben einen Sinn gegeben, den sie lange Zeit vermisst hatte.
Robert war ein vermögender Banker, schon damals, als sie als naive Unschuld von achtzehn Jahren seine Frau geworden war. Samantha kam aus einem zerrütteten Elternhaus. Sie konnte nicht sagen, ob es an der Armut gelegen hatte, dass es auch an der Liebe mangelte. Bereits als kleines Mädchen schwor sie sich, so niemals enden zu wollen. Und so wählte sie sich schon immer Freundinnen aus besseren Kreisen, die sie hauptsächlich in diversen Kunstkursen kennenlernte. Ihre kultivierten Umgangsformen, die sie sich mühevoll selbst antrainierte, sowie ihre Schönheit öffneten Samantha Tür und Tor. So zog sie nachts mit ihren Freundinnen durch die gehobenen Szenelokale der angesagtesten Viertel New Yorks. In einem dieser Lokale lernte sie Robert kennen, der sofort von ihr angetan war. Sie tauschten Telefonnummern aus und nur zu gern hatte sie sich in die Romanze mit dem schönen, reichen Prinzen fallen gelassen. Er umschmeichelte sie mit Rosen, holte sie in seinem teuren Auto von der High School ab, und sie war so geblendet von seinem Reichtum, seinem guten Aussehen und seiner Art, die so anders war als die der unreifen Jungs an ihrer Schule, dass sie seinem Werben nachgab.
Heute war sie eine reiche verheiratete Frau. Hier in den Hamptons, wo Long Island viel mehr als nur ein Eistee war, gehörte es sich nicht, dass die Frauen einer anderen Karriere nachgingen, als der, ihrem Mann eine gute Ehefrau zu sein. Samantha durfte sich kaufen, was sie wollte, konnte ihre Zeit in den Country Clubs der Schönen und Reichen verbringen.
Schließlich war sie selbst nicht weniger als das. Ihr langes blondes Haar, das ihr bis über die Hüfte reichte, war seidenweich und sprach von teurer Pflege. Ihre Haut war weiß und makellos, was weniger ihrem Bankkonto als guten Genen ihrer Familie mütterlicherseits zu verdanken war. Sie hatte große rauchgraue Augen, mit denen es ihr ein Leichtes gewesen war, einen gutaussehenden reichen Mann wie Robert dazu zu bringen, sie zu heiraten. Nur dass es ihr damals nicht ums Geld gegangen war. Sie hatte wirklich geglaubt, sich in diesen Mann verliebt zu haben.
Heute konnte sie es nicht mehr sagen. Heute war sie klüger. Heute wusste sie, dass sie nur ein hübsches Spielzeug für ihn war. Eines von vielen, wenngleich sie das Privileg bekommen hatte, den Namen Carstairs tragen zu dürfen. Sie erwartete längst keine Blumen mehr, die bekamen nur die Frauen, die er auf seinem Schreibtisch vögelte, wenn er ihr sagte, er müsse mal wieder Überstunden machen. Ein Blick in sein Telefon hatte genügt, es herauszufinden. Er hielt sie nach wie vor für ahnungslos. Seit sie es wusste, hatte sie damit aufgehört, abends auf ihn zu warten. Stattdessen hatte sie sich ebenfalls neue Anreize gesucht und diese in der Kunst gefunden.
Robert würde Augen machen, wenn er wüsste, wie weit sie dabei bereits gegangen war. Es bereitete Samantha im wahrsten Sinne des Wortes ein diebisches Vergnügen, sich vorzustellen, wie er eines Tages die doppelte Wand in ihrem Kleiderschrank entdeckte, die sie nur zu dem Zweck eingebaut hatte, ihre gesammelten Kunstwerke dahinter zu verbergen. Wer hätte schon gerade bei einer tugendsamen Frau aus gutem Hause nach jahrelang gesuchtem Diebesgut geforscht?
Sie trocknete sich die Hände ab und glättete den Zeitungsausschnitt, der auf der Spüle lag und den sie seit Wochen mit sich herumtrug. Das Bild über dem Artikel zeigte ein verwaschenes Ölgemälde von Monet. Darauf zu sehen war ein Mohnfeld und dahinter ein kleines Haus, das sie als so heimisch empfand, dass sie zu gern durch das Bild gestiegen wäre, um durch den strahlenden Mohn zu laufen.
Es erinnerte sie an das Haus ihrer Großmutter. Sie dachte nicht gern an sie zurück, da die Erinnerungen schmerzten. Gleichzeitig bargen sie eine Freude und Liebe, die Samantha so nie wieder empfunden hatte. Auch Grannys Haus war im Sommer stets von einem prachtvoll blühenden Mohnfeld umgeben gewesen. Samantha hatte es genossen, frei von den Streitereien ihrer Eltern, dort ihre Ferien verbringen zu können. Sie war stundenlang durch das Mohnfeld gewandert und stets hatte Granny sie danach mit offenen Armen und einem Lächeln erwartet. Diese Art des Sich-Zuhause-Fühlens hatte sie sich auch von ihrer Ehe versprochen. Heute war sie klüger. Aber vielleicht war das Bild in der Lage, ihr etwas von diesem Gefühl in das kalte Glashaus zu bringen. Deswegen musste sie es haben und war bereit, alles dafür aufs Spiel zu setzen, was sie ausmachte. Ein Einbruch ins Met war kein Sonntagsspaziergang. Das wusste sie umso besser, da sie sich seit Wochen darauf vorbereitete. Es gab noch eintausend Unwägbarkeiten, die sie nicht vorhersagen konnte. Sie hatte versucht, das Gemälde zu vergessen, doch es hatte sich in ihre Träume geschlichen und war fast ein Teil ihrer selbst geworden.
Sie faltete lächelnd den Artikel zusammen und steckte ihn sich in die Tasche ihrer teuren Seidenbluse, ehe sie sich daran machte, das Haus zu verlassen. Sie würde sich das Bild in der Galerie ansehen und herausfinden, ob es den Aufwand wert war, es zu ihrem eigenen zu machen.
Regen prasselte auf die Windschutzscheibe des schwarzen Ford Crown Victoria, den Derrick seit Anfang seiner Karriere als Detective beim NYPD fuhr. Den Commissioner hatte er gebeten, ihm einen der neuen Dodge Charger zu überlassen.
„Man kann es sich nun mal nicht aussuchen“, hatte dieser nur trocken erwidert.
Ein Charger hätte wenigstens eine vernünftige Heizung gehabt, regelmäßig musste er die beschlagenen Scheiben freiwischen. Drei Stunden in klirrender Kälte in einem halb defekten Ford wartete er nun bereits vor dem Metropolitan Museum of Art auf eine unbekannte Person, die vielleicht auftauchte. Niemand im NYPD wusste, ob der Unbekannte wirklich kommen würde. Aber die Raubzüge, die die Ostküste der USA plagten, wurden in den letzten Monaten immer mehr. Und dies war die bedeutendste Ausstellung des Jahres. Die Chancen standen nicht schlecht.
Es gab durchaus angenehmere Möglichkeiten, einen Freitagabend zu verbringen. Direkt hinter ihm war ein italienisches Restaurant, Giovanni Venticinque. Viel zu teuer für seine Gehaltsklasse, allerdings perfekt für die umliegenden Bewohner der E 83rd Street, zwischen Fifth und Madison Avenue.
Derrick spielte an einem abgenutzten Stück Plastik herum, das von der Mittelkonsole abgefallen war. Zehntausend Gäste würden dieser Ausstellung in drei Tagen beiwohnen. Darunter vielleicht ein Kunsträuber. Eine komplette Einsatzgruppe des NYPD war abgestellt worden, um die Sicherheit der ausgestellten Gemälde zu gewährleisten. Der Commissioner wusste genauso gut wie Derrick, dass jeder Treffer hier ein Glücksgriff wäre.
„NYPD, hier Detective Graves, bitte um Ablösung an der 83rd, ich will mir den Laden mal von innen ansehen“, sprach er in das Funkgerät, als er das Warten leid war.
In der Sekunde, in der er die Autotür aufschwang, war er schon komplett durchnässt. Die langen dunkelblonden Haare hatten sich zu einem golden schimmernden Schwarz verfärbt und hingen in sein Gesicht. Er strich sie sich aus dem Sichtfeld und lief mit schnellen Schritten auf den Haupteingang des Met zu. Sein dunkelblauer Trenchcoat konnte ihm vor dem Regenguss kaum Schutz bieten.
Ausgerechnet er hatte den Beobachtungspunkt bekommen, der am weitesten vom Eingang entfernt war. Aus der Perspektive seines Autos war die sonst so belebte Upper East Side beinahe menschenleer, aber je näher er der Fifth Avenue kam, desto deutlicher war die Traube von Menschen sichtbar, die sich vor den Treppen zum Eingang gebildet hatte.
Zu seinem Glück war die Schlange unter einer Art Pavillon vor dem Regen geschützt. Seine Dienstmarke durfte er an der Tür nicht vorzeigen, das war Teil der Mission. Niemand im NYPD wusste, wie gut sich der Räuber vorbereitete, aber eine Erfolgsquote von einhundert Prozent war definitiv Grund genug, mit größtmöglicher Sorgfalt vorzugehen.
Obwohl sich die Schlange relativ zügig voranbewegte, nahm sich Derrick die Zeit, alle Personen in der Umgebung unter die Lupe zu nehmen. Verdächtig kam ihm allerdings nichts vor. Ein Herr sah ständig auf sein Smartphone, etwas nervös, aber wer tat das in New York City nicht? Ein anderer sah häufig zum Dach hinauf, wieder ein anderer schaute ständig über die Schulter. Eine Gruppe Herren hatte größere Rucksäcke dabei. Einer, fast noch ein Junge, schien sich pedantisch die Lederhandschuhe zu reinigen. Als ob er keine Spuren hinterlassen wollte. Oder als ob er einfach an einem gewöhnlichen Putzfimmel litt. Jeder konnte ein Verdächtiger sein.
„Name?“, fragte das Wachpersonal am Eingang barsch.
„Graves. Ich habe eine Einla…“
„Okay, Sie können weiter“, wurde er unfreundlich unterbrochen.
In weit ausfallenden Schritten bewegte sich Derrick bis zum hinteren Ende der Eingangshalle. Vor ihm hing ein Schild. Es verwies auf Kandinsky, Kirchner, Nolde und Chagall zur Linken, der Flügel für expressionistische Kunst. Renoir, Monet, Van Gogh zur Rechten, Impressionismus. Geradeaus ein Ensemble verschiedener Künstler der klassischen Epochen. Sein Blick wanderte nach oben, zur gläsernen Dachkuppel, von der Regentropfen langsam hinabliefen.
„Wo bist du?“, murmelte er.
Sie näherte sich dem Museum in dem nachlässigen Studentinnen-Look, der zwei Stunden akribische Vorbereitungszeit benötigt hatte. Sie hatte kaum Make-up aufgelegt, doch ihre Augen mittels buntem Lidschatten groß und unbedarft gezaubert. Der hohe unordentliche Zopf schenkte ihr noch einmal fünf Jahre, auch wenn der Regen sie ihr fast schon lasziv an der Haut kleben ließ. Die zerfetzten Jeans und der Oversize-Pullover taten ihr Übriges. Die neu gekauften Converse hatte sie so lange mit einer Küchenschere bearbeitet, dass sie gerade noch gepflegt genug aussahen, um im Met Einlass zu finden. Über ihrer Schulter hing lässig ein schwarzer Rucksack, der übersät war mit bunten Buttons sowie einem Aufnäher der Tierschutzorganisation „Sea Shepherd“, den sie in Rekordzeit in ihrem Auto angenäht hatte.
Kritisch besah sie ihr Spiegelbild in einer der überdimensionalen Fensterscheiben der Fifth Avenue und dachte zufrieden, dass sie gut und gerne als Anfang zwanzig durchging. Zur Krönung setzte sie noch eine große Brille mit schwarzem Rahmen auf. Diese hatte sie in einer Drogerie um die Ecke gekauft, zusammen mit den Requisiten, bestehend aus Block und Stift, mit denen sie sich nun bewaffnete, ehe sie mit einem einstudiert begeisterten Lächeln die Stufen des Metropolitan Museum of Art hinauflief.
Eine der Frauen im teuren Businesskostüm am Kartenschalter musterte sie beinahe abwertend, so als ob sie bezweifelte, dass sie das nötige Kleingeld für die Eintrittskarte besaß. Sie kramte so lange in ihren Taschen nach dem Geld, wie es die Dame am Schalter zweifelsohne erwartete, und förderte schließlich grinsend einen Zwanzig-Dollar-Schein zutage.
Als die Dame mit gespitzten Lippen die Eintrittskarte über den Tresen schob und sich schon dem nächsten Besucher zuwenden wollte, schob Emily Singer – wie sie sich als Studentin nannte – demonstrativ ihren Studentenausweis über den Tresen. „Sie schulden mir noch fünf Dollar, Miss. Ich bin für meine Bachelor-Arbeit hier, wissen Sie?“
Natürlich hatte sie das nötige Kleingeld und war nicht auf Sparmaßnahmen angewiesen, doch sie war eine geborene Perfektionistin und so zog sie ihre Rolle gnadenlos durch. Außerdem bereitete es ihr ein diebisches Vergnügen zu sehen, wie die Dame am Schalter kritisch ihren perfekt selbstgefälschten Ausweis prüfte und ihn ihr resigniert mit einer Fünf-Dollar-Note zurückgab.
„Vielen Dank.“ Grinsend wandte sie sich ab und machte sich vergnügt auf eine Entdeckungstour durch das Museum. Zuerst kramte sie in ihrem Rucksack nach dem Museumsplan, wobei sie absichtlich ihr Haarspray herausfallen ließ, welches lautstark auf die Fliesen knallte. Die Leute drehten sich kopfschüttelnd zu ihr um. Sie tat peinlich berührt und packte es hektisch wieder ein. Wer versuchte, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen, erregte viel Aufmerksamkeit.
Liv – wie sie sich insgeheim in ihrem zweiten Leben nannte, wenn sie nicht gerade gezwungen war, andere Identitäten anzunehmen – war die geborene Täuscherin. Genauso wie sie bei Robert die glückliche Ehefrau spielte, schlüpfte sie nun mühelos in die Rolle der schusseligen Studentin Emily.
Sie schlenderte in gespielter Planlosigkeit durch die Räume, blieb hier und da vor einem Gemälde stehen und machte sich eifrig Notizen. Natürlich wusste sie genau, wo ihr Zielobjekt hing, aber sie war nicht so dumm, es als erstes anzusteuern. Sie musste den richtigen Zeitpunkt abwarten. Es durfte nur ein Zwischenstopp von maximal zehn Minuten sein, ehe sich die Studentin Emily wieder Dingen zuwandte, die sie mehr interessierten als ein Gemälde von roten Blumen.
Während sie lässig durch die Räume schritt, prägte sich ihr messerscharfer Verstand alles ein. Die Notausgänge, die Lage der Fenster, die Höhe der Decken, mögliche Nischen als Versteck, sollte es hart auf hart kommen. Woran sie nicht glaubte, denn sie war noch nie erwischt worden. Sie tat es seit drei Jahren. Und sie war gut.
Sie bog in den Flügel der Arts of Africa ab und stellte sich staunend vor eine der großen Maskenskulpturen, bei deren Betrachtung man fast schon die Trommeln im Hinterland Afrikas hören konnte. Während sie eine Skizze davon anfertigte, nahm sie aus den Augenwinkeln die Leute im Raum ins Visier. Eine Reisegruppe ließ sich gerade die Skulptur neben ihr erklären – eine afrikanische Frau mit einem Neugeborenen zwischen den Schenkeln, die in der typischen Gebärhaltung der Bantu neues Leben auf die Welt brachte.
Als ein einzelner Mann den Raum betrat, stellte sie sich automatisch zu der Reisegruppe und tat so, als höre sie zu, während ihre Sinne gespannt waren wie die Sehnen eines Bogens.
Der Neuankömmling roch förmlich nach Cop. Für Liv hatte sich mit seinem Eintreten die komplette Atmosphäre des Raumes verändert. Er hatte nicht das typische Aussehen eines Cops – aus den Augenwinkeln meinte sie, lange nasse Haare zu sehen. Ihr war die Gefahr der Situation durchaus bewusst. Wenn er gut war, konnte er sie ebenso erspüren wie sie ihn.
Ergriff sie sofort die Flucht, würde sie sich verraten, und so harrte sie noch zehn Minuten aus, ehe sie mit der Reisegruppe zusammen den Raum verließ. Sie wandte sich noch einmal um. Als sie sah, dass er ihr nicht folgte, machte sie sich zu ihrem eigentlichen Ziel auf den Weg.
Sie betrat die Welt des Impressionismus und nahm die anderen Gemälde nur am Rande ihres Sichtfeldes wahr wie Felder, an denen man auf der Autobahn vorbeirast. Das Zielobjekt hing in einer anheimelnden Ecke, welche einem Wohnzimmer nachempfunden war. Es thronte an einer olivfarbenen Wand über einer alten viktorianischen Couch, neben der eine ebenso alte Stehlampe stand und sanftes Licht auf die roten Blüten auf dem Gemälde warf.
Selbstvergessen trat Liv näher heran und sah auf das Häuschen hinter dem Mohnfeld. Die Sehnsucht, die sie bei diesem Anblick ergriff, riss sie beinahe von den Füßen. Sie musste es besitzen, um es immer wieder ansehen zu können, wenn sie sich wurzellos und verloren fühlte.
Kapitel 2
Die Begegnung
~ Gustave Courbet ~
Derrick stand einen Moment in der Halle der Arts of Africa, holte tief Luft und sah sich noch einmal um. Das Mädchen gehörte sicher nicht zur Gruppe, die nun von einem Guide zur nächsten Skulptur geführt wurde. Er war ihr anscheinend direkt aufgefallen, für den Bruchteil einer Sekunde trafen sich ihre Blicke. Er hob den Arm und brachte die Hand vor seinen Mund. In das kleine Mikrofon, das in seinem Ärmel befestigt war, flüsterte er: „Verdächtige Personen gefunden. Ein Mann, Haupthalle, und ein Mädchen, Halle für Impressionismus. Beide erstaunlich aufmerksam, reagieren merkwürdig auf Beobachtung. Achtet auf einen jüngeren Herrn, etwa 1,75 Meter groß, trägt ein blau-kariertes Hemd und eine schwarze Brille. Ich schaue nach dem Mädchen.“
Mit langen Schritten machte er sich auf den Weg, den Saal für impressionistische Kunst zu betreten. Im großen Portal zwischen den Sälen vibrierte sein Handy. Seine Hand wanderte in die Jackentasche, und er zog es hervor. Auf dem Sperrbildschirm blinkte eine Nachricht von „Hernandez“ auf. Der Commissioner. Der Nachricht ließ sich entnehmen, dass dieser anscheinend große Probleme mit dem Gedanken hatte, dass ein seit Jahren gesuchter Kunstdieb, für die Polizei bislang absolut ungreifbar, weiblich sein könnte. Derricks erste Vermutung wäre es auch nicht gewesen, aber bei ihr hatte er ein seltsames Gefühl.
„Nähere mich Zielperson“, murmelte er schnell in sein Funkmikrofon und näherte sich dem Mädchen, das sich gerade einen Monet ansah. Aus der Nähe konnte er einen Collegeblock erkennen, auf dem anscheinend Notizen über diverse Kunstgegenstände der Galerie niedergeschrieben waren. Eine Studentin vielleicht?
„Sie studieren Kunst?“, bemerkte er, sich neben sie stellend, ohne sie auch nur eine Sekunde anzusehen. Ein kurzes Zucken durchfuhr ihren Körper, sie wandte sich erschreckt zu ihm, wobei beinahe ihre Brille herunterfiel.
„Oh. Ja, genau, an der Columbia. Eigentlich bin ich wegen der afrikanischen Ausstellung hier. Ein Projekt über die Völker Afrikas. Aber das Bild hier ist auch ganz hübsch.“
Sie sah zu Monets Klatschmohn in der Gegend von Argenteuil und rückte ihre Brille zurecht. Einen Moment lang betrachtete sie wortlos das Gemälde. Derricks Blick folgte dem ihren und musterte es eingehend. Er wollte gerade etwas sagen, um die Stille zu brechen, als sie loslachte. „Entschuldigen Sie, ich habe nicht wirklich Erfahrung mit diesen malerischen Sachen.“
Er drehte sich zu ihr. Im Augenwinkel erkannte er die Reisegruppe aus der afrikanischen Halle, die sich nun bis hierhin vorkämpfte. „Es gefällt Ihnen? Ein Monet. Eines seiner berühmtesten Werke, soweit ich weiß.“
Das Mädchen fixierte ihn kurz, aber intensiv, bevor sie sich ruckartig von ihm abwandte. „Ja, es gefällt mir. Es ist still und lebendig zugleich, meinen Sie nicht?“
Einen Moment lang überlegte er, welche Rolle er nun am besten spielen sollte, entschied sich dann allerdings doch für eine sehr vertraute. Als Kunstkritiker könnte er sowieso nicht durchgehen. „Ich bin da vermutlich nicht die Person, die Sie fragen sollten. In Sachen Kunst bin ich absolut ungebildet“, antwortete er lächelnd nach einer etwas zu langen Wartezeit.
Neugierig drehte sie sich zu ihm. „Und was tun Sie dann hier, wenn Kunst nicht Ihr Gebiet ist?“
„Eine Einladung zum bedeutendsten Event der Stadt kann man schwer ablehnen, oder? Man trifft ’ne Menge interessanter Menschen hier.“
Ihre Schultern fielen in dem Moment ein wenig in sich zusammen, ihr Blick nur noch auf den Boden gerichtet. „Sie vielleicht. Eine Studentin beachtet hier niemand“, antwortete sie etwas bedrückt.
Derrick lachte laut los, was nicht nur einen verwirrten Blick der jungen Studentin verursachte, sondern auch das Interesse einiger Personen im Raum weckte. „Sie haben ’ne Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen, vorhin. Die Spraydose“, entgegnete er, auf den schwarzen Rucksack auf ihrem Rücken deutend.
Die Studentin kicherte ebenfalls. „O Gott, ist mir das peinlich! Nun, ich bin nicht so oft in so edlen Etablissements. Ich schätze, das merkt man mir an.“ Sie hielt einen Moment inne. „Und Sie sind ein ziemlich wichtiger Mann, wenn Sie eine Einladung vom Met erhalten.“
Derrick ertappte sich dabei, wie er leicht rot wurde, so was hatte er nun wirklich selten gehört. Er starrte einen Moment auf den Monet. „Wichtig nicht, nein, um Gottes willen! Ich kann mir ja kaum ein Essen in einem der Restaurants hier auf der Fifth leisten. Fiel mir eben auf. Ich kenne bloß die ein oder andere Person hier im Museum.“
Sie waren nun etwa auf einer Wellenlänge, die Miene der Studentin besserte sich merklich.
„Ich ziehe eh eine wirklich gute Pommesbude vor. Das kennen Sie sicher noch. Sie waren ja auch mal Student. Auch wenn Sie mit dieser Frisur eher wie ein Musiker aussehen.“
Er wischte sich die nassen Haare aus dem Gesicht. „Ich habe nie studiert.“
Sichtlich aufgelockert lachte sie los und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht, die aus dem Zopf gerutscht war. „Das war ein Fehler, die Partys sind der Hammer! Aber wenn Sie nicht studiert haben, was haben Sie dann getan?“
„Ach, eigentlich unspektakulär. Ein Bürojob, bei der Bank of America. In ’nem Bürowürfel. Aber hey, immerhin habe ich eine tolle Aussicht.“ Seufzend tippte er mit dem Finger auf seiner Hose herum und zuckte mit den Schultern. Ihre ohnehin schon groß wirkenden Augen wurden noch um ein Vielfaches größer. „Wow, danach sehen Sie wirklich nicht aus!“
„Wonach sehe ich denn aus?“, fragte er frech und fixierte ihre Augen.
Sie wandte sich von ihm ab, schlenderte etwas den Gang hinab. Links und rechts von ihnen hingen diverse Werke Monets, weiter hinten begann ein Abschnitt zu Renoir. Vor den letzten zu Monet gehörenden Werken blieb sie stehen. „Nach einem Rockstar, das sagte ich Ihnen doch. Die Mädchen in meinem Kurs wären verrückt nach Ihnen, wissen Sie?“
Sie zwinkerte ihm zu und bekam ein freches Grinsen als Antwort. „Dann habe ich es also bisher nur bei den Falschen versucht?“
„Jetzt machen Sie sich nicht lächerlich“, antwortete sie, das Bild musternd.
„Wie bitte?“
Das Mädchen drehte sich um und stemmte strahlend die Hände in die Seiten. „Ich kenne Männer wie Sie. Tun, als wären sie einsame Wölfe, um sich an arme, unschuldige Mädchen heranzumachen!“ Ihre Augen blitzten humorvoll auf.
„Mein großes Geheimnis ist gelüftet“, prustete er los, ehe sein Handy vibrierte. Er griff flink in die Tasche seines Trenchcoats und holte es hervor.
„Die werte Gattin?“, fragte sie und nickte in dessen Richtung.
„Die gibt es leider noch nicht. Es ist …“, setzte er an, die Nachricht lesend. Etwas leiser, ernster fuhr er fort. „… die Arbeit.“
„Diese Bank nimmt Sie ganz schön in Anspruch, was?“, erkundigte sie sich, leise, ohne die mädchenhafte Stimme, die sie zuvor gepflegt hatte. Eine Zeit lang schwiegen sie. Das Stimmenmeer der Halle hatte sie beide eingeschlossen, eine Weile lang, und niemand traute sich, diesen Käfig zu durchbrechen.
Bis Derrick das Schweigen brach. „Werden Sie morgen hier sein?“
Die Studentin, die gerade erst diesem merkwürdigen Zustand entkam, blinzelte verwirrt. „Morgen?“
„Die Ausstellung. Ist ja morgen auch noch da.“
Sie kratzte sich an der Schulter und lachte. „Oh, sicher … eigentlich hatte ich es nicht vor, es sei denn, Sie geben mir einen Grund.“
Ein breites Grinsen zierte nun sein Gesicht. „Ist es Grund genug, dass ich morgen wieder hier bin?“
„Banker sind eigentlich nicht so meins, aber wer weiß? Vielleicht überraschen Sie mich ja!“
„Wer spricht denn von Romantik? Um halb neun in der Haupthalle?“ Er drehte sich um und ging los, vernahm noch eindeutig ein hinterhergerufenes „Wir werden sehen“.
Dann wurde er von der Menge verschluckt. Schritt für Schritt begab er sich in Richtung der Herrentoilette, sein Handy in der Hand. Er schaltete es ein, auf die Worte des Commissioners konzentriert. „Sie ist es nicht.“
Derrick wusste, dass er jedes Wort mitgehört hatte. Vielleicht hatte er recht. Vermutlich. Er kam in einem der vielen Gänge zum Stehen. Die digitale Tastatur öffnete sich auf dem Touchscreen, und er tippte die knappe Antwort ein. Nach Drücken des Sendebuttons erschien seine Nachricht im Chatverlauf.
„Sieht so aus.“