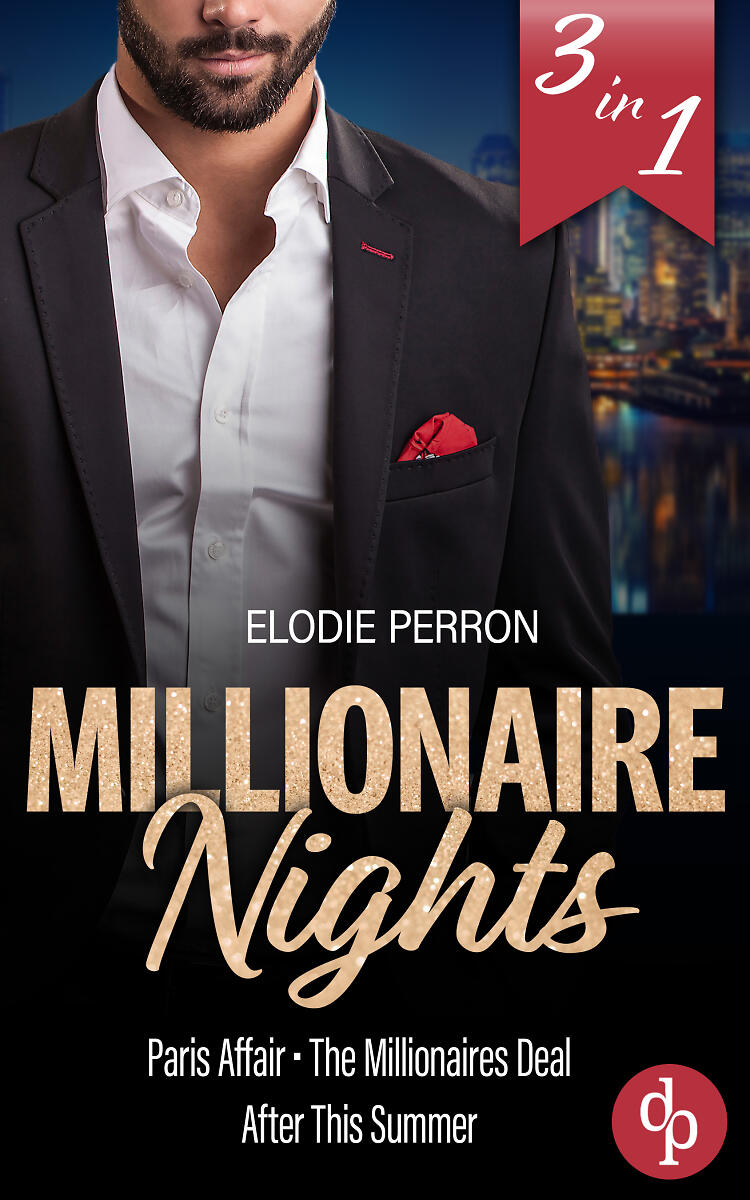Der Mann auf der anderen Straßenseite
Januar 2016
»Das war’s dann also«, sagt Roger. Da sein Tonfall offenlässt, ob er fragt oder feststellt, nicke ich nur und versuche zu verhindern, dass mir die Tränen in die Augen schießen. Eine Scheidung ist niemals einfach und unsere liegt gerade mal zehn Minuten zurück. Die Anwälte haben sich schon verabschiedet, aber wir stehen noch neben Rogers grauem Volvo auf dem Parkplatz des Central Family Court und sind bemüht, unserer Ehe ein würdevolles Ende zu geben. So war es immer zwischen uns – reif, erwachsen und ohne Leidenschaft. Das Letztere zumindest von meiner Seite.
»Holt Liz dich ab?«, frage ich.
»Nein. Sie arbeitet. Was ist mit dir? Triffst du dich mit Kathleen?«
»Um Himmels willen!« Jetzt muss ich trotz allem lachen. Meine einst so leichtlebige Schulfreundin ist zu einer schwer verheirateten Frau und gewissenhaften Mutter von Zwillingen geworden. Sie möchte ich heute ganz bestimmt nicht sehen. Nach meiner Beichte, dass meine Ehe am Ende sei, hatte sie mir die Hölle heißgemacht. Erzählte mir etwas von Verantwortung für den Anderen und einem Versprechen, das man gegeben hatte. Und dass ich Roger seine Affäre verzeihen sollte.
Ich habe dazu geschwiegen und mir gedacht: ›Aber es ist keine Liebe.‹
»Das ist vielleicht ein etwas schräger Vorschlag«, Rogers Stimme klingt zaghaft, so, als erwarte er von vornherein eine Abfuhr, »aber wollen wir zusammen essen gehen? Diesem beschissenen Tag wenigstens Rigatoni agli scampi abtrotzen?«
»Ich mag schräg«, erwidere ich. »Und ich mag Pasta.«
Eine halbe Stunde später sitzen wir uns im Chez Alphonse gegenüber. Es ist ›unser‹ Tisch, in der Nische hinter dem Tresen. Wir waren oft hier – so oft, dass wir uns einbilden, dem Besitzer etwas zu bedeuten. Auf jeden Fall kennt er unsere Namen und Lieblingsgerichte. Wir haben drei Hochzeitstage hier gefeiert, den vierten verbrachten wir schon getrennt voneinander. Vielleicht ist mir das Restaurant auch deshalb mit einem Mal so fremd. Der rustikale Holztisch, die rotkarierte Decke, die Kerze mit ihren malerischen Wachstropfen – ich verbinde nichts mehr damit. Und auch nicht mit Rogers freundlichem, gutmütigem Gesicht, das mir gleich zweimal in schwierigen Zeiten meines Lebens Sicherheit und Zuverlässigkeit versprochen hatte. Nur ein wenig Wehmut über das Scheitern des Lebensprojektes Ehe klingt in mir. Roger wird nach diesem Essen zu Liz fahren, der Frau, mit der er mich ein halbes Jahr lang betrogen hat und die ihn glücklich machen wird. Sie werden füreinander da sein, sich lieben und ehren bis ans Ende ihrer Tage. Meine Unfähigkeit, ihm das zu geben, was er verdient hätte, führte ihn letztlich zu dem Menschen, der ihn komplettiert.
Ja, ich habe viel Zeit damit verbracht, mir das Scheitern unserer Beziehung schönzureden.
Wir essen, ohne etwas zu sagen, doch die Art und Weise, wie Roger schweigt, zeigt mir, dass ihm etwas auf dem Herzen liegt. »Nun komm schon«, fordere ich ihn auf. »Was ist los?«
Er kann mir kaum in die Augen sehen, schaut von seinem Teller zur Gabel in seiner Hand, auf die Weinflasche und an die Wand. »Liz ist schwanger«, presst er schließlich zwischen zwei Bissen heraus. »Im dritten Monat.«
Ich rechne rasch zurück. Im Oktober holte er seine letzten Sachen. Ich verließ danach drei Tage lang nicht die Wohnung und er zeugte ein Kind. Roger war von uns beiden schon immer der Pragmatischere gewesen. Als Arzt musste er das wahrscheinlich auch.
»Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet wunderbare Eltern sein.«
»Es macht dir nichts aus?«
»Wieso sollte es?«
»Na ja, bei uns hat es nicht geklappt. Wir haben nie probiert –«
»Unsere Trennung lag weder an deinen Spermien noch an meinen Eizellen«, unterbreche ich ihn. Die Schärfe in meinen Worten rührt daher, weil er recht hat. Wäre ich wirklich und wahrhaftig davon überzeugt gewesen, dass unsere Bindung für die Ewigkeit sei, dann hätte ich einfach die Pille absetzen und schwanger werden können.
Das Kratzen der Gabelzinken auf unseren Tellern, als wir die letzten Rigatoni aufspießen, dröhnt wie ein Gewitter durch unser Schweigen. Erst als wir vor der Tür des Restaurants stehen, wendet sich Roger erneut an mich: »Du weißt, weshalb unsere Ehe gescheitert ist, nicht wahr?«
Sofort fahre ich alle Stacheln aus. Das habe ich noch nie an ihm gemocht – diese oberlehrerhafte Art, derer er sich mitunter befleißigt und bei der man nach jeder Antwort eine Zensurenvergabe erwartet.
»Dass du ein Verhältnis mit der Anästhesistin angefangen hast, könnte dazu beigetragen haben, meinst du nicht?«
Mit einem kurzen Kopfschütteln verwirft er meinen Einwand. »Weil während der ganzen Zeit dieser Mann auf der anderen Straßenseite stand. Wir waren nie allein in unserer Ehe, Celeste. Nicht einen einzigen Tag.«
Sein Auto mit ihm darin verschwindet zwischen all den Wagen auf der Straße. Gedankenverloren mache ich mich auf den Weg durch das Menschengewirr in der High Street Kensington. Ein Straßenmusikant versucht sich an Alone again und ich werfe zwei Pfund in seinen Sammelbecher. Nicht, weil er so gut singt, denn das tut er nicht, aber seine Songauswahl trifft meine Situation bemerkenswert genau. Obwohl ich schon längst zu Hause sein müsste, gehe ich in die Gärten, setze mich auf eine der Bänke am Round Pond und beobachte die Enten beim Putzen ihres Gefieders. Touristen laufen im Stop-and-go-Tempo am Kensington Palace vorbei, Jogger sprinten in ihren windschnittigen Plastikhüllen die Wege entlang, geschäftige Frauen und Männer hasten über den Kies, ihre Blicke auf den Boden gerichtet. Jeder dieser Menschen scheint im Hier und Jetzt zu sein, aber meine Erinnerungen schicken mich Jahre und Kilometer hinfort. Nach Farouse, zu Yoann. Er ist ›Der Mann auf der anderen Straßenseite‹, zumindest nannte Roger ihn so. Ich weiß nicht, wie ich ihn bezeichnen würde. Vielleicht als den Mann, der mein Herz in zu kleine Stücke gebrochen hat, um es jemals wieder zusammenzusetzen. Als ich die Augen schließe, verschwinden die Straßengeräusche und die kalten Londoner Januarböen. Fast kann ich den Wind Südfrankreichs auf meinem Gesicht spüren, warme Erde und salziges Meer riechen. Heute lächele ich bei dem Gedanken daran, aber vor acht Jahren war mir nach Heulen und Protestieren zumute. Ich war mit zwanzig ziemlich unausstehlich. Wahrscheinlich bin ich es immer noch.
Wie man New York verschwinden lässt
Mai 2008
»Pass auf, hörst du?«
»Natürlich pass ich auf. Warte, bis ich oben bin und dann kommst du nach.« Ich streife meine High Heels ab und setze meinen Fuß auf die unterste Sprosse des Rosenspaliers. Das Metall drückt sich kalt gegen meine nackte Fußsohle. Mit beiden Händen greife ich die Stangen zwischen den üppigen Blüten der Kletterrosen und danke insgeheim dem Gärtner, der eine Sorte ohne Dornen gepflanzt hat. Jetzt die nächste Sprosse. Und noch eine. Zum Glück ist mein Rock so kurz, dass er mich beim Klettern nicht stört. Und beim Tanzen sieht es heiß aus, wenn ich mich ein wenig nach vorne beuge.
Ich werfe einen Blick zurück, löse eine Hand und winke Kathleen wie ein tollkühner Pirat, der in die Wanten steigt. Sie schlägt sich die Hand vor den Mund, aber ich höre ihr furchtsames Quieken trotzdem.
Dicht an die Backsteinmauer gepresst, klettere ich dann vorbei an Rektor Palins Fenster im ersten Stock, aus dem bläuliches Fernseherlicht flimmert. Das mokant grinsende Gesicht von Simon Cowell füllt die Mattscheibe in Großaufnahme. Unglaublich! Palin sieht das Finale von Britain’s got Talent. Sollte mir der Typ jemals wieder mit seiner Litanei über die Wichtigkeit humanistischer Bildung kommen, werde ich mein neugewonnenes Wissen gegen ihn verwenden. Langsam klettere ich weiter und nähere mich meinem Fenster, das ich einen Spalt weit offengelassen habe, damit Kathleen und ich nach unserem samstäglichen Ausflug heimlich in unsere Schule zurückkehren können.
Die Royal School of Westminster, die wir besuchen und deren Name das Beeindruckendste an ihr ist, schließt ihre Tore nämlich auch am Wochenende um zehn Uhr abends. Und wer am nächsten Morgen nicht auf seinem Zimmer ist, bekommt Ärger, den wir uns gerade überhaupt nicht leisten können. Ich stehe sowieso schon auf der Böse-Mädchen-Liste, weil ich vor ein paar Wochen mein Auto im angetrunkenen Zustand gegen eine Garage gefahren habe, was in einer Gehirnerschütterung und einem einjährigen Führerscheinentzug geendet hat. Kathleen fliegt unter dem Radar, aber ihre Noten sind noch schlechter als meine.
Dabei soll unsere Schule Leute wie uns – mit reicher Familie, aus diversen Gründen eher uninteressiert an einer akademischen Laufbahn und deshalb auf dem Weg dorthin erfolglos – innerhalb von drei Jahren fit machen, damit wir vom ›rich white trash‹ zur Elite des Landes aufschließen können. Oder um wenigstens ein Studium zu beginnen. Ohne mir schmeicheln zu wollen, kann ich behaupten, mich dieser Indoktrination bisher erfolgreich widersetzt zu haben. Als Waffen stehen mir mein undurchdringliches Desinteresse und Vaters Reichtum zur Verfügung, denn das Internat lebt vom Schulgeld und den Spenden vermögender Menschen wie ihm. Also warum um Himmels willen sollte ich mich anstrengen?
»Ich komme jetzt auch«, flüsterruft Kathleen von unten. Das Spalier wackelt bedenklich und ich kralle meine Finger so fest um die Metallstangen, dass meine Knöchel weiß werden.
»Nein! Bleib, wo du bist. Das Ding hält gerade mal mich.«
»Was?«
»Bleib unten, Kath!« Aber schon folgt sie mir. Das Metall bebt unter meinen Füßen, die Verankerung löst sich wie in Zeitlupe aus dem roten Gemäuer und das Spalier, an dem Kathleen und ich uns schreiend festklammern, sinkt gen Boden.
Das war es jetzt also: Zwanzig Jahre Leben und nichts, worauf ich stolz sein könnte. Für einen winzigen, fröhlichen Moment kommt mir der Gedanke, dass ich vielleicht meine Mutter wiedersehen werde.
»Celeste!«
»Mama?«
»Ich bin’s.« Energisches Rütteln an meiner Schulter. »Wach auf, Mann! Du machst mir Angst!«
Ich öffne die Augen. Kathleen beugt sich über mich, ihr bleiches Gesicht leuchtet in der Dunkelheit wie der Mond und ihre langen Haare kitzeln mich.
»Bist du verletzt?«
Keine Ahnung. Mit beiden Händen taste ich meinen Oberkörper ab, atme tief ein. Die Rippen scheinen in Ordnung zu sein.
Als ich mich jedoch beim Aufsetzen abstütze, schießt ein scharfer Schmerz durch mein rechtes Handgelenk. Kathleen greift mir unter die Arme und zieht mich auf die Beine: »Komm, wir müssen weg, bevor Palin uns hier findet.«
»Zu spät, die Damen.« Die sonore Stimme unseres Rektors zittert vor Zorn, als er uns gegenübertritt. Mit einer Taschenlampe taucht er unser Elend in grellweißes Licht. Er trägt einen blau-weiß-gestreiften Bademantel mit einem Ankeremblem auf der linken Brustseite, dazu ein paar marineblaue Hausschuhe. Dieser Anblick, zusammen mit dem Schock über meinen gerade überstandenen Absturz, rufen bei mir die schlechteste aller möglichen Reaktionen hervor: Ich fange schallend an zu lachen. Kathleen lacht nicht. Palin auch nicht. Und ich bin so richtig am Arsch!
Mit einem Verband an meinem verstauchten Handgelenk und handtellergroßen blauen Flecken am ganzen Körper verlasse ich zwei Tage später die Krankenstube, von der aus ich umgehend in Palins Büro zitiert werde. Er sitzt in seinem üppigen braunen Ohrensessel, die Fingerspitzen aneinandergelegt, vor ihm auf seinem Schreibtisch ein Laptop. Als ich eintrete – mein Humpeln ist hoffentlich genauso mitleiderregend, wie es falsch ist – mustert er mich von oben bis unten.
»Miss Marshall. Nehmen Sie Platz.« Mit einer weit ausholenden Geste deutet er auf den Besucherstuhl, der aus Holz und schrecklich unbequem ist. Kaum, dass ich mich niedergelassen habe, dreht er den Laptop herum und ich erkenne, dass ich diesmal wohl mehr als die übliche ›Sie müssen sich endlich anstrengen, wenn Sie in dieser Gesellschaft etwas erreichen und ihr von Nutzen sein wollen‹–Predigt zu erwarten habe. Auf dem Monitor sehe ich meinen Vater. Sein sonst so liebes Gesicht zeigt sich abweisend und kühl. Die Lichter des Times Squares strahlen durch das Fenster hinter ihm. Es muss in New York ziemlich früh am Tage sein.
»Celeste.«
Mist, er hat seinen strengen Tonfall aufgelegt. Das bedeutet nichts Gutes.
»Paps.« Ich bemühe mich um ein fröhliches Lächeln und hebe meinen verbundenen Arm: »Ich freue mich so, dich zu sehen. Mir geht es wieder gut, die Hand ist nur verstaucht. Brauchst dir keine Sorgen machen.«
»Ich sorge mich nicht deshalb, sondern wegen deiner Einstellung.«
Palin gibt ein zustimmendes Grunzen von sich, was ihm einen bitterbösen Blick von mir einträgt. Das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir geht ihn nicht das Geringste an.
»Ich habe lange mit Dekan Palin gesprochen.«
Genaugenommen ist er gar kein Dekan, sondern nur ein Rektor. Aber ich begreife, dass Vater ihm Honig um den nicht vorhandenen Bart schmieren muss, und verkneife mir eine Richtigstellung.
»Wir sind beide der Meinung, dass es dir nicht an Intelligenz mangelt.«
Als ob ich das nicht selbst wüsste. Zufrieden verschränke ich meine Arme vor der Brust und lehne mich zurück. Jetzt werden noch die üblichen Ermahnungen folgen, danach biete ich zerknirschte Reue dar und in drei Wochen fliege ich in den Sommerferien zu Vater nach New York, wo er momentan ein paar Millionäre bespaßt, deren Vermögen er als selbstständiger Fondsmanager und Börsenmakler verwaltet und vermehrt.
»Du scheinst nur keinerlei Interesse an irgendetwas zu haben. Keine Intentionen, wie dein zukünftiges Leben aussehen soll.«
»Bitte? Du weißt doch, dass ich eine Galerie führen möchte.«
Der vollständige Plan ist, dass Vater mir nach Abschluss der Schule eine solche Galerie kauft und ich dort Gemälde junger, aufstrebender Maler ausstelle. Die Vorstellung gefällt mir – ich stehe mit französischem Pony, im schwarzen, enganliegenden Pullover, in dem meine Brüste größer wirken, als sie es sind, vor abstrakten Bildern und formuliere Sätze wie: »Was uns dieser Künstler sagen will, ist, dass es eine Welt, so wie wir sie zu kennen glauben, nicht gibt, nie gegeben hat und niemals geben wird. Wir sind nur Phantasmagorien der Imagination eines Wahnsinnigen.«
Zugegeben, ich habe nicht viel Ahnung von Gemälden, aber dafür könnte ich einen Creative Director einstellen. Für mich bliebe dann mehr Zeit, um Small Talk mit meinen First-Class-Kunden zu halten und Champagner zu trinken.
Vater seufzt. »Eine Galerie, ich weiß. Vor einem halben Jahr sollte ich dir noch einen Fernsehsender kaufen.«
Auch eine schöne Möglichkeit. Ich, wiederum mit französischem Pony und im schwarzen, enganliegenden Pullover, in dem meine Brüste größer wirken, als sie es sind, halte einem korrupten, aalglatten Politiker mein Mikrofon vor die Nase und bringe ihn mit meinen messerscharfen Fragen dazu, sich selbst zu belasten.
»Das sind doch großartige Pläne, Paps. Ich weiß gar nicht, was du hast.«
»Es sind Kinderträume, Celeste. Du musst endlich auf eigenen Beinen stehen und in der Realität ankommen. Und damit meine ich nicht, dich aus der Schule zu stehlen, zu trinken und wie Spiderwoman die Wände hochzuklettern.«
Palin nickt und wirkt dabei wie ein Mafioso, für den Vater die Drecksarbeit übernimmt.
»Nun, um dieses Ziel zu erreichen, wäre es vielleicht hilfreich, wenn die Schüler hier …«, ich werfe Palin einen langen, vielsagenden Blick zu, »nicht wie Kinder behandelt werden würden. Schließzeit am Wochenende um zehn Uhr abends?«
»Nein, Celeste, nein. Das ist nicht der Punkt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Du sollst während der Ferien in Ruhe über dein Verhalten nachdenken und deshalb wirst du mich nicht in New York besuchen –«
»Was?« Ich springe von meinem Stuhl auf und beinahe in den Laptop hinein.
»Du verbringst den Sommer in deinem Haus in Südfrankreich.«
Einen Moment dauert es, bis ich mich erinnere. Vor einem halben Jahr hatte Vater mir zu meinem Geburtstag eine Schenkungsurkunde für ein Haus irgendwo in der französischen Pampa überreicht. Dazu noch drei Fotos, die ein langweiliges, schlichtes Gebäude inmitten eines kleinen Gartens zeigten.
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Dort ist es ruhig und friedlich. Du wirst für die Schule lernen und darüber nachdenken, was du aus deinem Leben machen kannst.«
»Aber Paps«, vor Enttäuschung fange ich fast an zu heulen, »das kann ich doch auch im Central Park oder in Macy’s. Bitte! Ich wollte dich doch so gerne sehen!«
Ich sehe ihm an, wie schwer es ihm fällt, mich vor den Kopf zu stoßen, aber die Hoffnung, die in mir aufflammt, erlischt mit seinen nächsten Worten.
»Meine Entscheidung steht. Du fliegst nach Toulouse, dort holt Yoann dich ab und bringt dich nach Farouse.«
»Wer?«
»Yoann Pinot. Er arbeitet für mich und wird sich während der Ferien um dich kümmern.«
»Auf mich aufpassen, meinst du.«
»Um dich kümmern.«
Bevor ich noch etwas erwidern kann, klingelt sein Smartphone. Er wirft einen raschen Blick auf das Display. »Tut mir leid, das hier ist wichtig. Wir sprechen uns morgen Abend wieder.«
Und einfach so beendet er die Skype-Verbindung. Kein New York! Kein Paps! Das kann doch nicht wahr sein!
»Ihr Vater und ich«, bricht Palins Stimme durch meine Verzweiflung, »wir glauben, dass ein wenig emotionale und geistige Einkehr genau das Richtige für Sie sein wird, Miss Marshall.«
Ich blicke auf und starre ihm direkt ins Gesicht. Es würde ihm nicht gefallen, wenn er wüsste, was meiner Meinung nach für ihn genau das Richtige wäre. Es beinhaltet meinen Fuß und seinen Hintern.
»Es freut mich, dass Ihr Bein so schnell geheilt ist«, wirft mir Palin auf meinem Weg zur Tür hinterher. Ich drehe mich um. »Was?«
»Ihr Bein. Als sie vor ein paar Minuten mein Büro betraten, hinkten Sie noch. Jetzt scheint alles wieder in Ordnung zu sein.«
Ohne ein Wort verlasse ich das Zimmer. Ich bin eine Zauberkünstlerin. Ich kann New York verschwinden lassen.