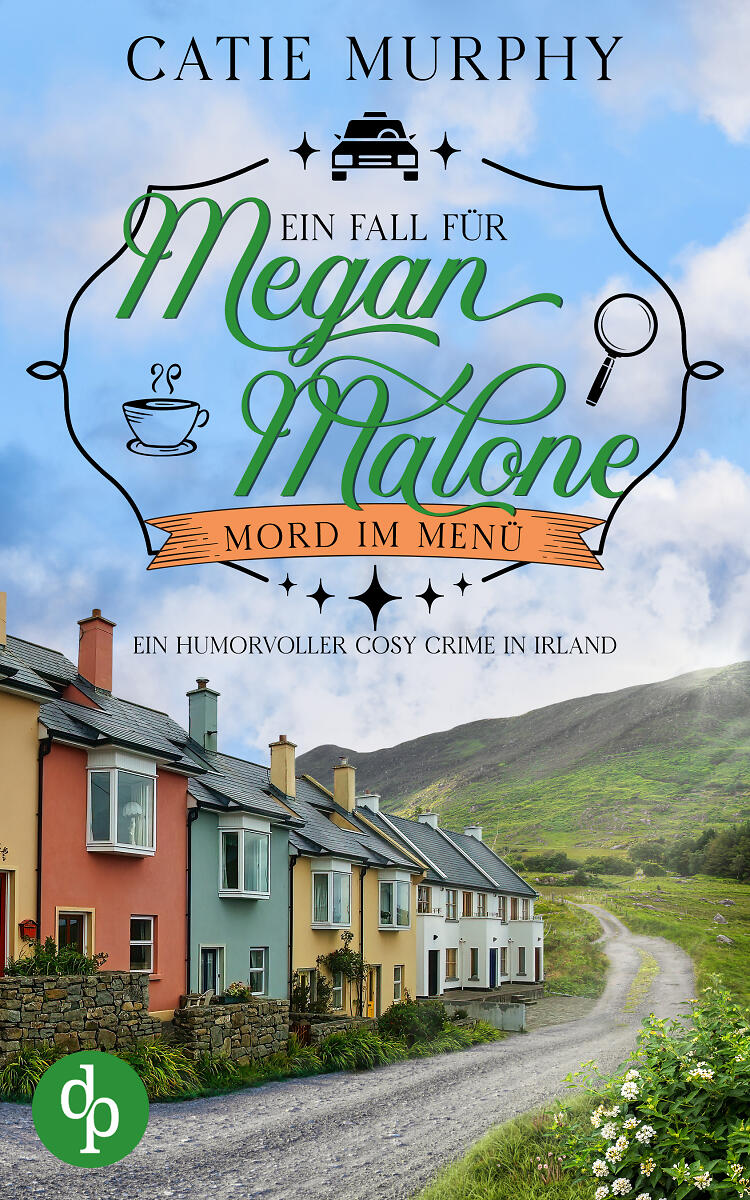Kapitel eins
Elizabeth Darr starb zu Molly Malones Füßen.
Bronzefarben und drall hatte Molly ihren starren Blick heiter in die Ferne gerichtet und nahm keine Notiz von den besorgten Rufen, die zu alarmierten Schreien heranwuchsen und von den jahrhundertealten Steinmauern widerhallten.
Einige Meter entfernt, stürzte Megan aus ihrem Wagen und eilte zu der Frau, die vor der Statue auf dem Boden lag. Zu ihrer Kundin. Zu Liz Darr, einer renommierten Restaurantkritikerin und Foodbloggerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, über internationale Kochkunst zu berichten. Sie war seit einigen Monaten in Irland, um für ihren Blog zu schreiben, und immer wenn sie Dublin besuchte, war Megan ihre Chauffeurin.
Meg hatte seit ihrem Umzug nach Irland bereits viele Menschen gefahren. Bis jetzt war noch keiner davon gestorben, schon gar nicht auf eine so spektakuläre Art, mitten in der Öffentlichkeit, zu Füßen von Dublins berühmtester Fischhändlerin.
Um Mollys Statue hatten sich bereits Menschen versammelt und versuchten, einen besseren Blick auf Elizabeth zu erhaschen.
Megan hob die Stimme. »Aus dem Weg!«, brüllte sie in ihrem breitesten texanischen Akzent. »Lasst mich durch!«
Die Menge teilte sich wie das Rote Meer. Megan drängte sich nach vorn, bis sie neben Liz auf den Boden fiel. Deren Ehemann Simon kniete bereits an ihrer Seite, und sein normalerweise blasses Gesicht war vor Angst und Anstrengung gerötet, während er mit professioneller Expertise Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte. Wortwörtlich professionell: Er war Arzt, auch wenn Megan davon ausging, dass er üblicherweise nicht auf der Wiederbelebungsstation arbeitete.
»Ich übernehme«, sagte sie, als er sich schwer atmend von Elizabeth löste und sich auf die nächste Runde Herzdruckmassage vorbereitete. »Ich war Sanitäterin beim Militär«, erklärte sie ihm, als er ihr einen wilden Blick zuwarf.
Verständnis dämmerte auf seinem Gesicht und seine Züge strafften sich. Er nickte knapp und ließ Megan die Massage übernehmen, während er selbst sich nach unten beugte, um seine Frau weiter zu beatmen. Megan platzierte ihre Hände auf der Mitte von Elizabeths Brustbein, presste, zählte und hielt ihren eigenen Atem an, in der Hoffnung, dass die Frau irgendwie wiederbelebt werden konnte.
Die hellbraunen Haare an Elizabeth Darrs Schläfen waren vom Schweiß durchnässt und rollten sich zu engen Locken zusammen. Ihre goldene Haut wurde zusehends fahler, und selbst als der Tod sich auf ihren Zügen niederließ, schien in ihren Wangen eine heiße Röte zu glühen. Megan wusste, wann Simon aufgab: Ein hilfloses Geräusch brach aus seiner Kehle hervor, beinahe unhörbar unter dem plötzlichen Aufheulen der Sirenen des Krankenwagens.
Megan realisierte, dass sich das Fahrzeug bereits seit einigen Minuten genähert hatte. Sie hatte es bloß nicht bemerkt, bis es direkt hinter ihr zum Stillstand gekommen war.
»Schafft den Wagen aus dem Weg«, rief jemand.
Die Sanitäter erschienen so unerwartet wie der Rettungswagen und schoben Megan von Elizabeths Brust. Sie stieß mit einem Fuß gegen die Bordsteinkante und fing sich mit einem Knie ab, während die Sanitäter auch Simon Darr zur Seite drückten.
Megan hob die Stimme. »Das ist ihr Ehemann! Das ist ihr Ehemann!« Sie wiederholte die Worte so lange, bis einer der Sanitäter es hörte. Sie begannen, Simon mit mehr Vorsicht zu behandeln. Eine aufgewühlte junge Frau mit blonden Korkenzieherlocken bot Megan die Hand, um ihr auf die Beine zu helfen. Sie ergriff sie, nickte zum Dank und verstand endlich, was die Person zuvor verlangt hatte.
Schafft den Wagen aus dem Weg.
Damit war ihr Wagen gemeint. Nun gut, der Wagen ihrer Firma. Megan fuhr Limousinen und Town Cars für Leprechaun Limos, ein Unternehmen, zu dessen Kunden hauptsächlich Touristen wie die Darrs und irische Teenager zählten, die offenbar der Meinung waren, dass die Limos mit Leprechaun-Logo ein besonders lustiges Transportmittel für ihre Debs – so nannten die Iren ihre Abschlussbälle – waren. Sie kämpfte sich ihren Weg zurück durch die Menge in Richtung ihres Wagens. Da sie die Tür offen gelassen hatte, hatte bereits jemand auf dem Fahrersitz Platz genommen.
Megan deutete mit dem Daumen auf das Mädchen. »Raus da! Das ist meiner, ich fahre ihn zur Seite.«
»Sagt wer?«, murmelte die Teenagerin mürrisch, kletterte aber in einem Durcheinander aus hohen Absätzen, kurzem Rock und stark geschminkten Augenbrauen aus dem Wagen. Offenbar hatte sie eingesehen, dass es nichts brachte, mit der Frau in der eleganten schwarz-weißen Uniform zu streiten, die eindeutig zu dem Fahrzeug gehörte. Ein paar andere opportunistische Teenager verzogen enttäuscht die Gesichter, aber sie hätten angesichts des Gedränges in der Fußgängerzone der Suffolk Street ohnehin nicht viel Glück damit gehabt, den Wagen zu stehlen.
Megan fuhr ums Eck und lenkte das Fahrzeug in eine semi-legale Parklücke, sodass der Krankenwagen problemlos an ihr vorbeikommen konnte. Dann hechtete sie die zehn bis fünfzehn Meter zurück zu Elizabeth Darr.
In den zwei Minuten, die sie dafür gebraucht hatte, den Wagen zur Seite zu fahren, hatte sich die Menge bereits gelichtet. Dennoch waren noch immer genügend Schaulustige versammelt, hauptsächlich junge, weiße Iren, die das Unglück anderer genauso ungestraft beobachteten, wie weiße Amerikaner es taten. Es war für sie ein bedeutungsloses Spektakel, aber sie wollten später behaupten können, sie wären dabei gewesen. Ein groß gewachsener Mann mit dem bulligen Körperbau eines Bodybuilders gackerte die ganze Zeit in sein Handy.
Blau gekleidete Gardaí, irische Polizisten, erschienen in der Straße, viele davon mit gut sichtbaren Warnwesten über ihren Uniformen. Die Obdachlosen, von der Sonne gezeichnet und von ihrem Leben auf der Straße oder ihrem Drogengebrauch abgemagert, verschwanden, noch ehe die Polizisten eine Menschenkette gebildet hatten, um die Schaulustigen von der Leiche wegzudrängen. Ein Großteil der Menge machte sich aus dem Staub – entweder interessierte die Leute der Vorfall nicht mehr, oder sie hofften, in den Abendnachrichten mehr darüber zu erfahren.
Einige Dutzend blieben jedoch zurück, unter ihnen auch der Bodybuilder. Megan kämpfte sich mit den Ellenbogen ihren Weg an ihm vorbei. »Entschuldigen Sie, ich kenne sie«, rechtfertigte sie sich dabei in ihrem stärksten amerikanischen Akzent. Sie konnte auch nach drei Jahren ihre Herkunft nicht verleugnen, und Amerikaner kamen in Irland mit vielem durch. Sie mochte es für gewöhnlich nicht, diese Tatsache zu ihrem Vorteil einzusetzen, aber dies waren außergewöhnliche Umstände.
Als Megan das gelbe Polizei-Absperrband erreichte, das um die süße Molly Malone gespannt worden war, wurde Elizabeths Leiche gerade von grimmig dreinblickenden Sanitätern auf eine Trage gehoben. Ein großer, schlank gebauter Kriminalbeamter mit blassblauen Augen und den typischen rosa-goldenen Untertönen in seiner Haut, die man von rothaarigen Iren kannte, hatte Simon Darr einige Schritte von seiner Frau weggeführt und stellte ihm Fragen. Allerdings schien Simon nicht in der Verfassung zu sein, ihm zu antworten. Der Detective nickte einer uniformierten Polizistin zu, und die Frau führte Mr. Darr zum Krankenwagen.
Megans Telefon klingelte mit einem schnellen, beharrlichen Summen in ihrer Gesäßtasche. Sie zog es hervor, sah, dass es sich bei dem Anrufer um ihre Chefin handelte, und beschloss, dass sie den Anruf nicht bemerkt hatte. Das Telefon wanderte zurück in ihre Tasche, aber der Blick des Detectives landete auf ihr. Mit ein paar langen Schritten erreichte er die Absperrung vor ihr, hob das Band hoch und bedeutete ihr, darunter hindurchzukommen. »Megan Malone?«
Weder sie noch er konnte sich dagegen wehren: Gleichzeitig sahen sie beide zu der Bronzestatue hinter ihnen. Megan grinste schief. »Keine Verwandtschaft.«
»Ich nehme an, das hören Sie öfter«, erwiderte der Detective mit freundlichem Charme. »Sind Sie Amerikanerin?«
»Ich lebe seit fast drei Jahren hier.« Megan griff nach ihrem Ausweis, obwohl der Beamte nicht danach gefragt hatte. Sie würde sich wahrscheinlich nie daran gewöhnen: In Amerika fragte jeder nach Papieren, ganz besonders Personen, die mit dem Militär in Verbindung standen. Doch eines der angenehmen – oder seltsamen, je nachdem, in welcher Stimmung sie gerade war – Dinge an Irland war, dass kaum jemand jemals einen Ausweis sehen wollte.
»Detective Paul Bourke.« Unter seinem rötlich blonden Haar hatte Bourke scharfe Züge und außergewöhnlich helle Augenbrauen, die im Kontrast zu seiner sonnengeröteten Haut blond strahlten. Das Gesicht eines Jungen von nebenan, beschloss Megan: angenehm, aber leicht zu vergessen. Als Polizist kam ihm das vermutlich zugute. »Mr. Darr sagt, Sie sind seine Chauffeurin?«
Megan nickte. »Ich arbeite für Leprechaun Limos.«
»Ich habe deren Wagen schon in der Stadt gesehen. Wie lange haben Sie die Darrs gekannt?«
»Seit drei Monaten. Sie haben viel Zeit außerhalb der Stadt verbracht, aber wenn sie in Dublin waren, habe ich sie gefahren.«
»Obwohl Sie Amerikanerin sind.«
»Ach, klar. Ich kann den Akzent anschalten, wenn ich muss. Alles, damit die Kunden glücklich sind. Es ist ein Teil des authentischen Erlebnisses.« Megan hatte einen melodisch-irischen Akzent aufgesetzt, doch bevor sie den Satz zu Ende gebracht hatte, begann sie sich zu schämen. Eine Frau war gestorben und Humor nicht angebracht, aber dennoch kroch der Anflug eines Lächelns über Detective Bourkes dünne Lippen.
»Nicht schlecht für einen Yankee. Ich schätze, Sie können singen.«
»Hauptsächlich in der Dusche.« Megan wusste – sie wusste –, dass der Detective den Small Talk dazu benutzte, eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, damit sie ihm die wichtigen Fragen beantworten würde, die er ihr im Anschluss stellen musste. Es funktionierte dennoch und sie musste zugeben, dass sie seine Fähigkeiten einerseits verblüfften, andererseits aber auch beeindruckten. »Manche Leute, vor allem Amerikaner, mögen es, eine amerikanische Fahrerin zu haben. Ihnen gefallen die Vertrautheit und die Tatsache, dass sie sich nicht mit einem fremden Akzent herumschlagen müssen.« Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, bemerkte sie, wie fremdenfeindlich er klang.
Bourke nickte bloß. »Waren die Darrs solche Leute?«
»Nein. Elizabeth – Mrs. Darr – hat den irischen Akzent besonders geliebt. Ihre Großmutter wurde hier geboren. Aber sie waren bereits über ein Jahr auf Reisen und sie sagte, es wäre auch nett, eine Stimme aus der Heimat zu hören. Also haben sie nach mir gefragt, als sie aus dem Westen zurückgekehrt sind.«
»Waren sie in Galway?«
»In Mayo, glaube ich. Westport. Ich bin mir nicht sicher. Sie waren überall.«
»Also war Ihre Beziehung ausschließlich professionell?«
Megan hob die Brauen. »Freundlich, aber professionell. Ich war hier, um sie vom Abendessen abzuholen.«
Paul Bourke sah zu dem Restaurant, das eindrucksvoll in der alten Kirche gelegen war. Obwohl es offiziell schlicht Canan’s hieß, wurde es von den Einwohnern umgangssprachlich Canan’s in St. Andrew’s genannt, während der Nachtclub im Obergeschoss, der Fionnualas Geschäftspartner gehörte, offiziell Club Heaven hieß, aber von den meisten Leuten nur Die Kirche genannt wurde. Beide Etablissements waren kurz vor Megans Umzug nach Irland eröffnet worden und hatten sich seither gut entwickelt. Nachdem die Touristeninformation aus der Kirche ausgezogen war und sie zur Vermietung freigegeben hatte, war das Canan’s zu einem beliebten neuen Hotspot der irischen Kulinarik geworden. »Es hat einen guten Ruf.«
»Es ist gut. Ich esse ziemlich oft dort.«
Leicht erstaunt sah Bourke zurück zu Megan. »Dann werden Limousinenfahrerinnen wohl gut bezahlt. Vielleicht sollte ich mich nach einem Karrierewechsel umsehen.«
»Die Arbeitszeiten sind nicht so toll«, warnte sie. »Nein, ich kenne dort jemanden.«
Der Detective klappte seinen Notizblock auf, obwohl Megan sicher war, dass er ihn nicht brauchte. Er sah hinein. »Martin Rafferty?«
»Nein. Ich meine, ich kenne ihn, aber ich spreche von Fionn. Rafferty ist ihr Geschäftspartner.«
»Fionnuala Canan? Was können Sie mir über sie erzählen?«
Megan verzog das Gesicht. »Was meinen Sie? Sie ist eine großartige Köchin und zu meinem Geburtstag backt sie mir Kuchen als Geschenk.«
»Sie neigt also nicht dazu, ihren Gästen eine Lebensmittelvergiftung zu verpassen?«
»Was? Nein!« Megan warf einen entsetzten Blick in die Richtung, in die der Krankenwagen mit Simon Darr und seiner toten Frau verschwunden war. »Oh nein, sie kann doch keine Lebensmittelvergiftung gehabt haben, oder? So etwas wirkt doch nicht so schnell. Außerdem sterben die Menschen nicht daran, oder?«
»Ich schätze, das werden wir herausfinden.« Bourke schloss den Notizblock. »Haben Sie eine Visitenkarte, Ms. Malone? Ich würde mich gern später noch einmal mit Ihnen unterhalten, obwohl ich vermute, dass dieser Fall schnell erledigt sein wird. Soweit das möglich ist, wenn es sich um den Tod einer mehr oder weniger Prominenten handelt.«
»Wer benutzt in der heutigen Zeit noch Visitenkarten?«, erwiderte Megan, obwohl sie eine Karte hatte, auf der ihr Name und die Kontaktinformationen der Firma verzeichnet waren. Sie zog sie aus einem Zinnetui, das mit einem irischen Knoten verziert war, und bot sie Bourke an, der ihr im Gegenzug seine Karte gab. Sie steckte sie in das Etui, ohne sie anzusehen.
Er warf einen Blick auf ihre Karte, schob sie in seine Brieftasche und nickte in Richtung des Wagens. »Vielleicht sollten Sie zum St.-James’s-Krankenhaus fahren. Dort hat man Mr. Darr hingebracht. Wahrscheinlich wird er irgendwann im Laufe des Abends jemanden brauchen, der ihn nach Hause bringt.«
»O Gott, wahrscheinlich braucht er das, der arme Kerl. Ja, das übernehme ich.« Megan verschwieg, dass sie bereits gewusst hatte, in welches Krankenhaus die Darrs gebracht worden waren. Sie hatte es auf den Uniformen der Sanitäter und auf dem Krankenwagen gelesen.
Bourke winkte sie erneut unter der Polizeiabsperrung durch, und sie trat einige Schritte auf den Wagen zu, ehe sie zögerte und zurück zum Canan’s sah.
Wenn Elizabeth Darr an einer Lebensmittelvergiftung gestorben war, würden die Inspekteure des Gesundheitsamts das Restaurant bald durchkämmen, aber bislang war es noch nicht einmal abgesperrt worden. Meg bahnte sich ihren Weg zurück durch das, was von der Menschenmenge übrig war. Das Mädchen mit dem kurzen Rock und den stark geschminkten Augenbrauen war noch nicht nach Hause gegangen, und das Gleiche galt für ihren Kader aus hoffnungsvollen jungen Männern. Auch die Blondine mit den Korkenzieherlocken, die Megan zuvor geholfen hatte, war noch nicht verschwunden und verzog das Gesicht in traurigem Mitleid, als Megan das Restaurant betrat.
Direkt hinter der Tür befand sich ein offener Bereich mit einigen Tischen, der zu einem schmalen Abschnitt mit einem Bartresen führte. Dahinter erstreckten sich die restlichen zwei Drittel des Restaurants, in denen die meisten Tische standen. An den Außenwänden befanden sich bunte Kirchenfenster, über denen ein paar moderne Luken angebracht worden waren, die geöffnet werden konnten und so für eine angenehme Brise im Lokal sorgten. Die Wände waren in Cremefarben und goldenen Brauntönen gehalten, auf die das Licht, das durch die Glasscheiben fiel, bunte Muster zeichnete. An der Innenwand waren außerdem zahlreiche gut platzierte Spiegel angebracht, die das Restaurant größer erscheinen ließen, als es tatsächlich war.
Es roch gut genug, um Megans Magen zum Knurren zu bringen. Ein paar Plätze im Restaurant und an der Bar waren noch besetzt, aber die meisten Gäste hatte der Trubel auf dem Platz nach draußen getrieben. Meg hoffte, dass der Großteil von ihnen davor zumindest ihre Rechnungen bezahlt hatte, doch als sie Fionnuala entdeckte, die niedergeschlagen am Ende des Bartresens saß, schwanden ihre Hoffnungen. »Fionn?«
»Meg«, stieß Fionnuala Canan erleichtert aus und stürzte von ihrem Stuhl in Megs Arme. Megan fing sie auf, stöhnte – Fionn war gut zehn Zentimeter größer als Meg und noch dazu recht kräftig gebaut – und drückte sie fest.
»Ich würde dich ja fragen, wie es dir geht, aber ich nehme an, alles ist furchtbar.«
»O Gott, Meg, du hast ja keine Ahnung.« Fionn richtete sich auf. Ihr sonst klarer, grüner Blick war trübe und erschöpft. Für gewöhnlich bezeichnete Meg sie als umwerfend, selbst nachdem sie einen Abend lang in der Küche über den Herdplatten geschwitzt hatte, aber in diesem Moment hing das kupferfarbene Haar der anderen Frau schlaff um ihr herzförmiges Gesicht und zog ihre Konturen mit sich nach unten. Auf ihren Wangen leuchteten Hitzeflecken und statt ihres Küchenkittels trug sie nur das olivgrüne Unterhemd – Amerikaner würden es Tanktop nennen –, das sie normalerweise unter ihrer Arbeitskleidung trug. Selbst das Shirt sah schmuddelig aus und biss sich mit Fionns schwarz-weiß karierter Kochhose. »Ich hab die meisten Angestellten nach Hause geschickt. Syzmon und Julian sind gute Jungs und sind geblieben, damit wir hier so viel aufräumen können wie möglich, vor allem im vorderen Bereich«, sie gestikulierte zu den Tischen, »aber wir können die Küche nicht putzen, bis die Inspektoren vom Gesundheitsamt nicht hier waren, um zu sehen, ob es unsere Schuld war.« Ihr Kiefer verspannte sich. »Wir haben bis jetzt jede Kontrolle mit Bravour bestanden, Meg. Der Fisch hat noch gezuckt, als er heute Nachmittag geliefert wurde. Wir können diese arme Frau nicht vergiftet haben. Es ist einfach nicht möglich.«
»Ich bin mir sicher, dass ihr es nicht getan habt«, sagte Meg aufrichtig, aber Fionnuala schüttelte den Kopf.
»Nein, du verstehst es nicht. Weißt du, wer in Irland haftet, wenn jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt?«
Megan drehte ihre Handflächen nach oben und brachte dadurch ihre Ratlosigkeit zum Ausdruck.
Fionns Lippen verzogen sich. »Der Koch. Nicht einmal das Restaurant, sondern der Koch haftet dafür. Und ich habe heute Abend gekocht. Ich weiß, dass es nicht am Essen lag.« Frust glänzte in ihren Augen und sie schien einen Wimpernschlag von den ersten Tränen entfernt. Ihre Stimme stieg eine Oktave höher, und obwohl sie weiterhin leise sprach, wurde sie immer schneller und schneller. »Ich weiß, dass es nicht das Essen war, aber ich bin trotzdem dran. Und wenn es das Essen war, und wenn sie es nachweisen können, dann bin ich ruiniert. Dann ist das Restaurant ruiniert. Und selbst wenn es nicht unser Essen war, und selbst wenn es nicht das Restaurant war, Elizabeth Darr war eine der berühmtesten Foodbloggerinnen in den Staaten. Weißt du, wie viele Touristen allein in Irland ihren Empfehlungen folgen, wenn sie einen Ort zum Essen suchen? Tausende, jedes Jahr. Sie hatte die Macht, zu entscheiden, ob ein Restaurant zum Erfolg wurde oder nicht, wusstest du das? Es ist also egal, was passiert ist, allein die Tatsache, dass sie aus meiner Tür spaziert und direkt gestorben ist, ist ein Fakt, von dem wir uns unmöglich erholen können. Und wenn es tatsächlich eine Lebensmittelvergiftung war? Dann sind wir am Ende. Das Canan’s ist am Ende. Vielleicht könnten wir es irgendwann als das Rafferty’s neu eröffnen, aber das hier ist mein Laden, mein Traum, und wenn ein anderer Name darauf steht …«
»Fionn. Fionn.« Megan schlang die Arme erneut um die andere Frau und hielt sie fest, bis sie aufhörte zu zittern. »Sieh mal. Ich kann dir nicht direkt helfen, aber ich muss heute Abend zum St. James’s fahren und Mr. Darr abholen. Vielleicht kann ich dort irgendwelche Neuigkeiten über Liz’ Tod erfahren. Vielleicht kann man ja richtig schnell herausfinden, dass es keine Lebensmittelvergiftung war, und dann bist du den Medien einen Schritt voraus. Ihr habt doch Social-Media-Profile, oder?«
Fionnuala sank vor Dankbarkeit zusammen. »Das würdest du tun? Das wäre … Das wäre der absolute Hammer, Meg. Und ja, wir haben Social … Oh, feck, ich sollte mich lieber darum kümmern, ich sollte … Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll.«
»Dein Beileid für die Tragödie, Anerkennung für Elizabeths Blog, das Restaurant wird für ein paar Tage geschlossen sein, ich weiß nicht, so was in der Art. Ich schicke dir eine Nachricht, wenn ich im Krankenhaus irgendetwas erfahre, okay? Wahrscheinlich werde ich nichts rauskriegen, aber ich versuche es.« Megan umarmte Fionn erneut. »Wo ist Martin?«
»Er ist auf dem Weg hierher. Eigentlich hatte er heute Abend frei, aber ich hab ihn natürlich angerufen … Da ist er ja.« Fionnuala sprang auf und lief ihrem Geschäftspartner, einem großen Mann, der immer besorgt aussah, in die Arme, als er durch die Tür kam. Tiefe Falten hatten sich auf seiner Stirn und um seinen Mund gebildet und er machte einen noch bedrückteren Eindruck als sonst, was allerdings wenig überraschend war. Geistesabwesend schüttelte er Meg die Hand und unterbrach Fionnuala, als sie ihm erzählen wollte, was geschehen war.
»Der rothaarige Detective da draußen hat mir schon alles gesagt und mich verhört. Jesus, Fionn, das ist ja wirklich zum Verzweifeln. Wie lange werden wir geschlossen bleiben?«
»Mindestens drei Tage.«
»Über das Wochenende?«, fragte Rafferty entsetzt.
Megan duckte sich und presste die Lippen zusammen, damit sie nicht kommentieren konnte, dass, wenn man davon ausging, dass heute Donnerstag war, drei Tage das Wochenende definitiv mit einschließen würden. Martin Rafferty brachte diese Seite an ihr zum Vorschein, aber sie arbeitete daran, den Drang zu unterdrücken, denn sie mochte Fionn, und Fionn und Martin waren bereits Geschäftspartner gewesen, lange bevor Megan sie gekannt hatte.
»Und das bei diesem Wetter?« Besorgt sah er zu dem goldenen Licht des Sonnenuntergangs, das durch die Buntglasfenster fiel. Das letzte Überbleibsel einer Reihe von untypisch warmen Sommertagen. Das Wetter hatte die Dubliner massenweise auf die Straße getrieben, gut gelaunt, sonnengebräunt und bereit, Geld auszugeben. Davon hatten alle Geschäfte in der Stadt profitiert, na ja, vielleicht mit Ausnahme der Sonnenstudios. »Es muss eine Möglichkeit geben, wieder aufzumachen. Ich werde mit dem Stadtrat sprechen oder einen Abgeordneten aus dem Dáil hierherholen, damit er …«
Megan schüttelte den Kopf. So viele Menschen – vor allem Männer – verließen sich auf ein Netzwerk aus alten Kerlen und dachten, sie könnten mithilfe der Regierung Vorschriften und Gesetze umgehen.
Fionn hatte offenbar ähnliche Gefühle, denn ihre Stimme wurde ein wenig lauter, als sie sagte: »Martin, sie müssen eine Gesundheitskontrolle machen, sie müssen das Essen überprüfen. Sie müssen eine Autopsie durchführen, verdammt noch mal. Der Taoiseach selbst könnte nichts daran ändern. Wir müssen …«
»Dann wenigstens den Club«, erwiderte Martin angespannt. »Sie können doch bestimmt das Heaven nicht schließen wegen dessen, was im Canan’s vor sich geht …«
Sanft berührte Megan Fionns Arm. »Ich fahre zum Krankenhaus und sehe, was ich rausfinden kann«, murmelte sie, während Fionn frustriert versuchte, ihrem Geschäftspartner die Dinge zu erklären. »Halt durch und ruf mich an, wenn du etwas brauchst, okay?«
Fionnuala schenkte ihr ein abgelenktes Nicken und Megan eilte zur Tür, gerade in dem Moment, in dem Detective Bourke den Raum betrat. Er wirkte im Inneren des Restaurants größer, als er es auf der Straße getan hatte. Als wären seine Schultern breiter als zuvor. Dennoch hätte Megan darauf gewettet, dass er in seinem ganzen Leben noch nie einen Anzug getragen hatte, der nicht eng anliegend geschnitten gewesen war. Na gut, vielleicht hatte er das; er war mindestens so alt wie sie, vierzig, vielleicht älter, und in ihrer Jugend war weite Kleidung im Trend gewesen. Trotzdem, sie war sich sicher, dass er sich darüber gefreut hatte, als eng anliegende Anzüge in Mode gekommen waren.
Er nahm ihre Anwesenheit zur Kenntnis, ohne sich seine Gefühle darüber im Gesicht ablesen zu lassen, doch als Fionnuala plötzlich »Megan« sagte, sah er zwischen ihnen hin und her.
Überrascht von der Vehemenz in Fionns Stimme wandte sich Megan zu ihr um und sah das Leuchten in ihren Augen.
»Danke, Meg. Du rettest mir das Leben.«
Kapitel zwei
Du rettest mir das Leben.
Fionnualas Worte hallten durch Megans Bewusstsein, während sie zum St.-James’s-Krankenhaus fuhr, das kaum eine Meile – ein paar Kilometer, wie die Iren sagen würden – von der Stelle entfernt lag, an der Liz gestorben war. Wenn es ihr doch gelungen wäre, deren Leben zu retten. Wenn sie bloß irgendwie … Sie konnte den Gedanken nicht einmal zu Ende bringen. Selbst wenn sie schneller gelaufen wäre, hätte sie Liz nicht mehr retten können. Selbst wenn es ihr gelungen wäre, sie zu warnen, keine … keine was? Keine Meeresfrüchte zu essen? Megan schüttelte den Kopf, während sie darauf wartete, dass die Ampel an der Straßenecke auf Grün schaltete.
Nachdem sie bereits seit einigen Jahren in Dublin fuhr, hatte sie sich zwar zum Großteil daran gewöhnt, dass die Ampeln in Irland an den Straßenecken standen, anstatt wie in Amerika über der Straße zu hängen, aber sie würde sich nie damit abfinden, dass die Straßennamen hier an den Hauswänden angebracht waren. Dieses kleine Detail machte es für Amerikaner äußerst schwierig, sich zu orientieren. Vielleicht sogar für alle; als Megan noch in den Staaten gewohnt hatte, hatte sie einmal Besuch von einem irischen Cousin gehabt, der sich darüber gefreut hatte, wie einfach es war, die amerikanischen Straßenschilder zu lesen. Sie hatte damals nicht verstanden, was er gemeint hatte, bis sie nach Irland gezogen war und herausgefunden hatte, dass die Schilder hier überall an Hauswänden befestigt waren. Die meisten davon waren so sehr mit Schmutz bedeckt, dass es schwierig war, sie zu entziffern, selbst wenn man wusste, wo sie sich befanden.
Du rettest mir das Leben.
Die Melodie der Worte hallte durch ihren Kopf, so sanft und schwungvoll wie eine Liedzeile. Megan glaubte keine Sekunde lang, dass ein Gericht mit fragwürdigen Meeresfrüchten für Elizabeths Tod verantwortlich war, und das nicht nur, weil sie nicht wollte, dass Fionn die Konsequenzen dafür tragen musste.
Die Ampel sprang um und der Verkehr setzte sich relativ flüssig in Bewegung, vor allem wenn man die Uhrzeit bedachte. Es war kurz vor zehn, die Sonne versank bereits hinter dem Horizont und über der Stadt läutete die Abenddämmerung das Ende eines langen Sommerabends ein. Blaue Schatten umspielten die grauen Steine des Dublin Castles, während die letzten Strahlen des Sonnenuntergangs seine Spitzen golden färbten.
Megan war es nicht gelungen, Liz zu retten, und das würde sie auch bei Fionnuala nicht schaffen. Sie konnte bestenfalls versuchen, ihr zu helfen, aber wenn das Restaurant nicht schuld an dem Vorfall war … Eine Liedzeile schoss durch ihre Gedanken:
Sie starb an einem Fieber
und niemand konnte sie retten,
sie rief »Herzmuscheln und Miesmuscheln«,
die süße Molly Malone …
Elizabeth hatte völlig normal gewirkt, als Megan die Darrs vor dem Restaurant abgesetzt hatte, und sie hatte noch nie von einem Fieber gehört, das eine Person innerhalb von drei Stunden umbrachte. Dasselbe galt allerdings auch für Lebensmittelvergiftungen, zumindest üblicherweise. Eine Allergie vielleicht, aber Elizabeth Darr war eine Restaurantkritikerin gewesen. Sie hätte nichts gegessen, das sie krank machte.
Zumindest nicht mit Absicht.
Sie trommelte mit den Fingerspitzen gegen das Lenkrad und griff dann nach der Leprechaun-Figur auf ihrem Armaturenbrett, als könnte die Berührung ihr Glück verleihen. Nicht mit Absicht. Dies kam einer Vorstellung zu nahe, die sie eigentlich vermeiden wollte; der Gedanke daran, dass Elizabeth Darr vielleicht ermordet worden war. Jede Restaurantkritikerin hatte Feinde, aber Megan ging nicht davon aus, dass es in der Branche üblich war, sich gegenseitig umzubringen. Nun, da sie die Theorie zugelassen hatte, erschien sie ihr völlig absurd.
Und selbst wenn sie das am Ende nicht sein sollte, würde Detective Paul Bourke dahinterkommen, denn im Gegensatz zu Megan war er dafür ausgebildet und wurde dafür bezahlt, herauszufinden, ob ein Verbrechen vorlag. Megan unterhielt sich gern mit Menschen und interessierte sich für ihre Geschichten, weshalb sie perfekt für die Arbeit als Chauffeurin geeignet war. Deshalb liebte sie die irische Phrase »Erzähl mir deine Geschichte«, die angefangen von »Wie geht es dir?« bis hin zu »Was ist los?« alles Mögliche bedeuten konnte. Sie interessierte sich stets dafür, was ihre Gäste darauf zu sagen hatten, und da sie eine ausgezeichnete Zuhörerin war, erzählten es ihr die meisten auch.
Ihr Handy klingelte erneut in ihrer Tasche, aber dieses Mal zog Megan es nicht einmal hervor. Wenn man sie dabei erwischte, wie sie am Steuer telefonierte, gab es Punktabzug für den Führerschein. Wer auch immer es war, konnte warten.
In der Tiefgarage des St. James’s roch es dezent nach Hopfen, was an der Guinness-Brauerei am Ende der Straße lag. An manchen Tagen war der malzige Geruch in der ganzen Innenstadt bemerkbar, aber an diesem Abend war er ihr bis jetzt nicht aufgefallen. Wahrscheinlich hatte der Wind in die falsche Richtung geweht. Sie rümpfte die Nase, stieg aus dem Wagen und eilte zum Haupteingang des Krankenhauses.
Die Edelstahlkante zwischen den Schiebetüren bot gerade genug reflektierende Oberfläche, um Megan mit ihrem eigenen Aussehen zu überraschen. Eine Frau, die sie – wenn auch nur oberflächlich – gekannt hatte, war gerade in einem öffentlichen Spektakel gestorben. Sie hatte das Gefühl, sie sollte zerzaust aussehen, gestresst, völlig durcheinander. Stattdessen offenbarte ihr der kurze Blick auf ihr Spiegelbild die Reflexion einer Frau, die ihre dunklen Haare zu einem ordentlichen französischen Knoten gedreht hatte. Ihre schwarz-weiße Fahreruniform war makellos und das dezente Make-up noch immer dort, wo es sein sollte. Sie sah nicht einmal müde aus.
Die Türen öffneten sich mit einem Zischen und Megan trat ein, die Chauffeursmütze unter den Arm geklemmt. Wenn sie ordentlich und professionell auftrat, würde sie vielleicht eher jemanden dazu bringen können, ihr zu verraten, ob Fionnualas Restaurant aus dem Schneider war. Realistisch gesehen sah sie allerdings keinen Grund, weshalb jemand diese Art von Information mit ihr teilen sollte. Vielleicht würden ihr strahlender Blick und ihr gewinnendes Lächeln ausreichen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, aber selbst wenn das nicht der Fall war, hatte sie noch immer eine Aufgabe zu erfüllen, auch wenn sie sich diese selbst auferlegt hatte. Simon Darr nach Hause zu fahren und zu sehen, ob sie etwas für Fionn in Erfahrung bringen konnte, waren die einzigen beiden Dinge, die Megan gerade tun konnte, also wollte sie es versuchen. In Zeiten einer Krise war es immer besser, zumindest irgendetwas Nützliches zu tun, als hilflos herumzusitzen. Das war mit ein Grund dafür gewesen, weshalb sie in der Armee als Sanitäterin gearbeitet hatte.
Um diese Uhrzeit war der Empfang nicht mehr besetzt. Megan tippte für einige Sekunden auf den Tresen, als wäre ihr Finger eine Tätowiermaschine. Sie sah sich um, entdeckte einen älteren Mann in Hausmeisteruniform und fragte ihn nach dem Weg zu der A&E-Abteilung – Accidents and Emergencies, so nannte man in Irland die Notaufnahme, die Megan aus den Staaten als ER kannte. Er lächelte und sein leichter südasiatischer Akzent klang mitfühlend, als er fragte: »Ist alles in Ordnung, Miss?«
Megan schüttelte den Kopf und lächelte angespannt. »Nein, aber ich bin nicht diejenige, die den Verlust erlitten hat. Danke.«
Ihr Helfer nickte und erklärte ihr, dass es einfacher wäre, in die Notaufnahme zu gelangen, wenn sie wieder nach draußen gehen und den Weg um das Gebäude herum nehmen würde. Megan eilte hinaus und lief den Bürgersteig entlang, bis sie den Fußgängereingang erreichte. Als sie die Menschenmenge im Inneren sah, atmete sie tief ein und drückte dann die Tür auf.
Bereits auf den ersten Blick war deutlich, dass die etwa fünfzig Sitze im Warteraum hauptsächlich mit Menschen besetzt waren, die an Prellungen oder verschiedenen Abstufungen von Trunkenheit litten, aber das schummrige Neonlicht ließ vermutlich alle kränker wirken, als sie tatsächlich waren. Obwohl es für einen Donnerstagabend ziemlich voll schien, wusste Megan, dass es am Wochenende noch viel schlimmer sein würde.
Simon Darr war nicht unter den Menschen im Warteraum. Geduldig stellte sich Megan an der Menschenschlange an, bis sie die Aufnahmeschwester erreichte, die sie sofort anschnauzte: »Um was gehts?«
»Ich suche nach einer Freundin oder ihrem Ehemann. Elizabeth Darr. Sie müsste so gegen neun Uhr oder neun Uhr fünfzehn hergebracht worden sein. Elizabeth war bei ihrer Ankunft wahrscheinlich tot. Ich bin hier, um ihren Mann Simon nach Hause zu fahren, wenn er dazu bereit ist.«
In den Augen der Schwester spiegelte sich nicht mal der geringste Anflug von Mitgefühl. »Die Leichenhalle befindet sich beim Eingang in der James Street.«
Megan nickte. »Vielen Dank für Ihre Hilfe.« Sie trat zur Seite und machte Platz für einen schwerfälligen Mann, der einen Hautlappen an seiner Stirn festhielt.
Die Schwester reagierte auf das blutverschmierte Gesicht genauso gleichgültig wie auf Megans Geschichte. »Um was gehts?«, fuhr sie den Mann an, und Megan machte sich auf den Weg in die Leichenhalle.
***
Simon Darr saß allein in einem Korridor, der genauso gut für eine düstere Filmszene hätte gemacht sein können: An beiden Enden befanden sich schwingende Doppeltüren und neben einer weiteren einzelnen Tür im Gang stand eine Reihe von Plastikstühlen. Selbst die Sitzmöbel wirkten trostlos, als hätten sie bereits das Gewicht von zu vielen gebrochenen Herzen getragen und Simon wäre bloß ein weiterer Unglücklicher in einer langen, traurigen Reihe. Nur wenige Stunden zuvor hätte Megan ihn noch als Läufer beschrieben, fit und athletisch gebaut. Nun hing sein feines Haar strähnig hinab und seine Schultern krümmten sich unter seiner Kleidung, die so zerknittert und unordentlich aussah, wie Megan es von ihrer eigenen Uniform erwartet hatte. Als sie ihn zum ersten Mal getroffen hatte, war ihr aufgefallen, dass seine Fingernägel perfekt manikürt gewesen waren, doch nun waren sie rau und zerfranst. Seine geröteten Knöchel sahen geschwollen aus, als er sein Gesicht in den Händen vergrub.
Eine Krankenpflegerin oder Mitarbeiterin der Leichenhalle – auf jeden Fall eine Angestellte in blauer Krankenhauskleidung – kam aus der Doppeltür gegenüber dem Eingang, durch den Megan gerade gekommen war. Sie warf Simon einen kurzen, mitfühlenden Blick zu, der zu einem fragenden Ausdruck wurde, als sie zu Megan sah. Mit einer Handbewegung deutete Megan zu Simon, woraufhin die Krankenschwester, die nun von ihrer Pflicht befreit war, an ihr vorbeiging, ohne weiter mit ihr zu kommunizieren.
Megan setzte sich auf die Kante des Stuhls neben Simon und legte die Hand auf die Lehne seines Sitzes. Er rutschte zur Seite und hob dann den stumpfen Blick. Er schien sie nicht zu erkennen.
»Megan Malone«, sagte sie leise. »Ihre Fahrerin. Ich dachte, ich komme, um Sie zurück ins Hotel zu bringen, wenn Sie bereit dazu sind.«
Der Blick des Mannes klärte sich und er erschauderte. »Megan. Ja, natürlich. Es tut mir leid, ich hätte Sie erkennen müssen.«
»Nein, ist schon in Ordnung. Sind Sie …« Megan stoppte sich, noch ehe sie die offensichtlich dumme Frage aussprechen konnte, doch ein schreckliches, gebrochenes Lächeln kroch über Simons Gesicht.
»In Ordnung? Nein. Aber …« Er holte zitternd Luft und fuhr sich mit den Händen über das Gesicht. »Ich stehe wahrscheinlich unter Schock. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot ist. Ich warte darauf, dass sie jeden Moment …« Mit einer hastigen und ungeschickten Bewegung gestikulierte er zur Tür der Leichenhalle neben ihnen. »… hier durchkommt und mich auslacht, weil ich geglaubt habe, dass sie wirklich tot ist. Oder dass sie nach mir ruft und will, dass ich ihre Haare hochhalte, während sie sich erbricht, weil sie ein bisschen zu viel getrunken hat. Oder dass sie wieder damit anfängt, dieses fürchterliche Lied zu singen. Damit hört sie nicht auf, seit wir hier sind.« Sein Gesicht zuckte. »Hat sie nicht aufgehört.«
»Molly Malone?«, fragte Meg sanft. »Ich hab gesehen, wie sie es in der Lifestyle Show auf dem Fernsehsender RTÉ gesungen hat. Sie hatte eine wunderschöne Stimme.«
»Sie hat an der Universität Oper studiert, aber dann hat sie Sängerknötchen bekommen.« Simon gestikulierte vage an seinen Hals. »Sie sind verheilt, aber sie hat den oberen Teil ihres Stimmspektrums eingebüßt. Dann hatte sie etwas mit einem Koch und hat beschlossen, dass sie lieber über Essen schreibt, als für ihr tägliches Brot zu singen.« Dasselbe schreckliche Lächeln huschte über sein Gesicht und zog tiefe Falten um seinen Mund und seine Nase. »Das hat sie immer gesagt, wenn sich ihre Eltern darüber beschwert haben, dass ihre Tochter keine Primadonna wird. Ich glaube allerdings, sie haben ihr verziehen, als sie ihr erstes Buch für Feinschmecker veröffentlicht hat. Es war etwas, das sie …« Er stieß ein kurzes, schroffes Lachen aus, ein Geräusch der Trauer, die sich nur schwer mit Humor überspielen ließ. »Etwas, womit sie beim Dinner mit ihren Freunden angeben konnten. Ich muss sie anrufen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Was haben die Sanitäter gesagt? War es eine Lebensmittelvergiftung?«
»Das kann erst nach der Autopsie ausgeschlossen werden, aber ich habe von ihrem Essen gekostet, und mir geht es gut.« Sein Blick verfinsterte sich erneut und Tränen stiegen ihm in die Augen. Megan zögerte, aber da sie ihn in seiner Trauer nicht völlig allein lassen wollte, legte sie ihm vorsichtig eine Hand auf die Schulter. Wenn es bei Leprechaun Limos noch keine Vorschriften dafür gab, wie man trauernde Kunden trösten sollte, würde Megans Chefin sie zweifelsohne bis zum nächsten Morgen in Kraft gesetzt haben, zusammen mit einer detaillierten Liste mit all den Dingen, die Megan falsch gemacht hatte.
Eine Minute verstrich, dann quittierte Simon ihre Bemühungen, indem er seine Hand auf ihre legte. Ihre Finger waren im Vergleich zu seinen kurz und klobig.
»Wollen Sie bleiben?«, fragte sie, als sein schlimmstes Schluchzen vorüber war. »Ich weiß nicht, wie hier die Regeln sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie auch bei ihr sitzen können, wenn Sie das wollen.«
»Das hilft ihr jetzt auch nichts mehr«, erwiderte er trostlos. »Sie haben versprochen, dass sie sich mit der Autopsie beeilen, aber selbst wenn ich es ertragen würde, würden sie mich nicht dabei sein lassen. Und es wird sowieso nicht vor morgen früh erledigt.«
»Haben Sie Freunde in der Stadt?«, fragte Megan. »Jemanden, der zu Ihnen ins Hotel kommen könnte oder zu dem Sie nach Hause fahren wollen?«
Simon lachte heiser. »Ich sollte jetzt wohl sagen: ›Elizabeth hat sich keine Freunde gemacht‹, oder? Hat sie aber. Leute – Fans – wollten sie treffen. Sie hatten das Gefühl, sie würden sie bereits von ihrem Blog und den Kritiken kennen. Aber dann haben sie erkannt, wie lustig und liebenswürdig sie war, und sie sind zu Freunden geworden. Die meisten davon. Es gab auch Leute, die sie nicht leiden konnten, Leute, über deren Restaurants sie schlechte Kritiken geschrieben hat, aber … Ich weiß nicht, wen ich anrufen könnte. Wir sind zu viel umhergereist. Gott, aber wir haben es geliebt. Eigentlich hat sie sich nach einer langen Reise immer auf zu Hause gefreut, aber dieses Mal hat sie … Dieses Mal haben wir darüber nachgedacht, zu bleiben. Ich habe mich sogar schon nach Arbeit umgesehen und mich bei einigen Krankenhäusern in Dublin vorgestellt. Aber wir haben noch keine engen Freundschaften geschlossen.« Ein weiteres scheußlich gequältes Lächeln zog sich über sein Gesicht. »Ich befürchte, Sie sind im Moment das für uns, was einer Freundin am nächsten kommt. Wir haben Sie regelmäßiger als alle anderen gesehen.«
Megans Hand fand ihren Weg zu ihrem Mund und presste sich gegen ihre Lippen. Sie wusste aus eigener Erfahrung, wie isolierend es sein konnte, in ein anderes Land zu ziehen, aber sie hatte sich den Großteil ihres Lebens auf die Unterstützung des Militär-Netzwerks verlassen können. Selbst sie fand die Vorstellung erschreckend, als einsamer Zivilist in einem fremden Land zu sein und mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert zu werden. Sie fasste Simon tröstend an die Schulter. »Dann bleibe ich bei Ihnen.«
Auf Simons Gesicht zeichnete sich zunächst erstaunte Dankbarkeit, dann Verlegenheit ab. »Nein, das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Ich kriege das schon hin. Ich muss ihre Eltern anrufen. Ihre Schwester. Ihren Verleger. Ich muss einen Blogeintrag für ihre Webseite schreiben …«
»Nicht heute Nacht.« Megan drückte seine Schulter. »Sie müssen heute nichts auf dem Blog posten. Oder den Verleger anrufen.«
»Sie ist in der Öffentlichkeit gestorben. Wahrscheinlich ist es schon überall in den sozialen Netzwerken. Ich muss etwas tun.« Ein Anflug von wütender Stärke schwang in Simons Stimme mit und Megan schwieg. Sie wollte ihm den Funken Trost nicht nehmen, den er daraus gewann, etwas zu tun zu haben. »Ich werde zunächst ihre Familie anrufen. Könnten Sie mich zurück ins Hotel fahren?«
Megan erhob sich, nickte und öffnete die Tür neben den Stühlen. Im Raum dahinter saß eine junge Frau an ihrem Schreibtisch und hob den Kopf.
»Ich bringe Doktor Darr zurück in sein Hotel«, sagte Megan. »Sie haben seine korrekten Kontaktinformationen?«
Die junge Frau durchsuchte ihre Unterlagen, bis sie den Zettel, den sie gesucht hatte, zuoberst auf dem Stapel fand. »Wir melden uns, sobald wir etwas Genaueres wissen.«
»Vielen Dank.« Megan ließ die Tür hinter sich zufallen und holte zu Simon auf, der durch die Doppeltür auf den Ausgang zuging. Er hielt sein Telefon in der Hand und sein Kiefer war angespannt, als er es an sein Ohr hob. Megan ging einige Schritte voran und wies ihm diskret den Weg. Die resolute Anspannung in ihren Schultern zeugte von Professionalität und der verblüffenden Fähigkeit, sein Telefonat zu überhören.
Ihr eigenes Handy gab währenddessen ein spezielles Signal von sich, das bedeutete, dass ein Anruf direkt auf ihrem Anrufbeantworter gelandet war, während sie sich in den Tiefen des Krankenhauses befunden hatte. Früher oder später würde sie sich darum kümmern müssen, aber gerade gab es wichtigere Dinge.
Die Tatsache, dass er auf den Beinen war und ein potentielles Publikum hatte – nicht Megan, denn sie war voll und ganz mit ihrer Funktion verschmolzen, mehr ›Die Fahrerin‹ als eine reale Person, doch selbst um diese Uhrzeit waren Menschen in den Krankenhauskorridoren – half Simon Darr dabei, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten, während er mit seinen Schwiegereltern telefonierte. Als sie jedoch in die Garage gelangten und Megan die Tür des Wagens hinter ihm schloss, fiel seine Fassade in sich zusammen. Das Town Car besaß keine Trennwand zwischen Fahrer und Rücksitz, die sie hätte hochkurbeln können, um ihm in seinem Kummer etwas Privatsphäre zu gönnen. Ohne diese Barriere konnte sie die hohen, klagenden Schreie von Elizabeths Mutter und die tieferen, raueren Schluchzer ihres Vaters durch den Lautsprecher von Simons Handy hören. Ihre Sicht verschwamm und sie fuhr sich mit dem Handballen über die Augen, zwang sich, gleichmäßig zu atmen, um weitere Tränen zurückzuhalten.
Im Mitternachtsverkehr war es eine kurze Fahrt durch das tausendjährige Herz von Dublin, vorbei am Guinness Storehouse, das noch immer stark nach Hopfen roch, und der St. Patrick’s Cathedral, deren Turmspitze wie ein dunkler Schatten in den blauschwarzen Nachthimmel emporragte. Selbst Stunden nach dem Sonnenuntergang verströmten die Pflanzen rund um die Kirche noch immer eine kühlere Luft als die Ziegel und der Beton der Gebäude um sie herum. Megan liebte St. Pat’s, einerseits weil sie wunderschön war, andererseits hauptsächlich wegen der Tatsache, dass die Kirche eigentlich gar nicht existieren sollte: Dublin hatte zwei Kathedralen und die zweite davon, Christ Church, war nur einen Steinwurf von St. Pat’s entfernt. Sie konnte nicht behaupten, die Komplexitäten des achthundert Jahre alten religiösen und politischen Durcheinanders zu verstehen, das dazu geführt hatte, dass beide Kathedralen errichtet worden waren, aber sie liebte die Gebäude, die daraus entstanden waren.
Die Straßen dahinter waren nicht weniger eindrucksvoll: Immer wieder führten Fußgängerwege durch mittelalterliche Bögen, die wiederum in einem Gewirr aus Straßen endeten, die für Kutschen und Pferde gebaut worden waren. Dazwischen lagen einige neuere – das bedeutete in diesem Fall zwei- bis dreihundert anstatt eintausend Jahre alte – Straßen, die von den hohen gregorianischen Herrenhäusern gesäumt wurden, die zum Stolz der Stadt zählten.
Simons Hotel, das Shelbourne, stammte ebenfalls aus dieser Zeit und überblickte das nördliche Ende von St. Stephen’s Green, einem Park, der mehr oder weniger in seiner gegenwärtigen Form seit über einhundertfünfzig Jahren existierte. Bis auf Fort Alamo gab es in Texas nicht viele von Europäern errichtete Bauwerke, die älter waren. Megan hoffte, dass der Tag niemals kam, an dem sie diese Tatsache nicht mehr erstaunte und begeisterte.
Megan parkte illegalerweise vor dem Hotel und begleitete Simon zu seinem Zimmer. Sie vermutete, dass die Chance, einen Strafzettel zu bekommen, gering war, und sollte es doch passieren, würde sie ihn einfach bezahlen. Simon unterbrach sein Telefonat und versuchte, sich zu sammeln, als sie den öffentlichen Bereich betraten, jedoch waren seine Bewegungen zu unkoordiniert, um das Kartenschloss an seinem Zimmer zu öffnen. Megan nahm die Karte schweigend entgegen, öffnete die Tür, ließ ihn in den Raum treten und wartete, bis er sie mit einem zitternden Nicken entließ. Auf ihrem Weg nach draußen machte sie an der Rezeption Halt und erzählte den Mitarbeitern, was geschehen war, woraufhin der ohnehin bereits blasse Rezeptionist so weiß wurde, dass seine Sommersprossen wie ein Ausschlag aussahen.
Mit einem leichten Schuldgefühl überließ es Megan dem armen Jungen, selbst herauszufinden, wie man mit einem trauernden Gast umgehen sollte. Sie trat zurück in die vergleichsweise ruhige Kulisse des nächtlichen Dublins und fand heraus, dass man ihr keinen Strafzettel verpasst hatte. Das würde auch nicht passieren, solange sie im Wagen saß, also ließ sie sich hinter das Lenkrad sinken, beschloss, die drei verpassten Anrufe ihrer Chefin zu ignorieren, und textete stattdessen Fionnuala.
Der Ehemann hat auch etwas von ihrem Teller gegessen, er ist gesund, also wahrscheinlich keine Lebensmittelvergiftung. Hoffe, das hilft dir, dich auf die ganze Sache vorzubereiten. <3 <3 <3
Die Antwort kam fast sofort zurück.
OMG DANKE, du bist ein Star!
Darauf folgte:
Wie geht es dem armen Kerl?
Ziemlich mies. Und dir?
Jetzt besser. Tausend Dank, Megan.
Nichts zu danken.
Für einen Moment saß sie in der Stille des Wagens, bis der Bildschirm ihres Handys dunkel wurde. Kurz darauf leuchtete das Telefon erneut auf und spielte die drei Töne ab, die signalisierten, dass eine weitere Textnachricht eingegangen war. Ihre Chefin, Orla. Schon wieder.
Megan verzog das Gesicht und warf ihr Handy auf den Beifahrersitz, ohne die Nachricht zu beantworten – oder überhaupt erst zu lesen. »Schon gut, schon gut, ich bin auf dem Weg und werde die Suppe auslöffeln …«