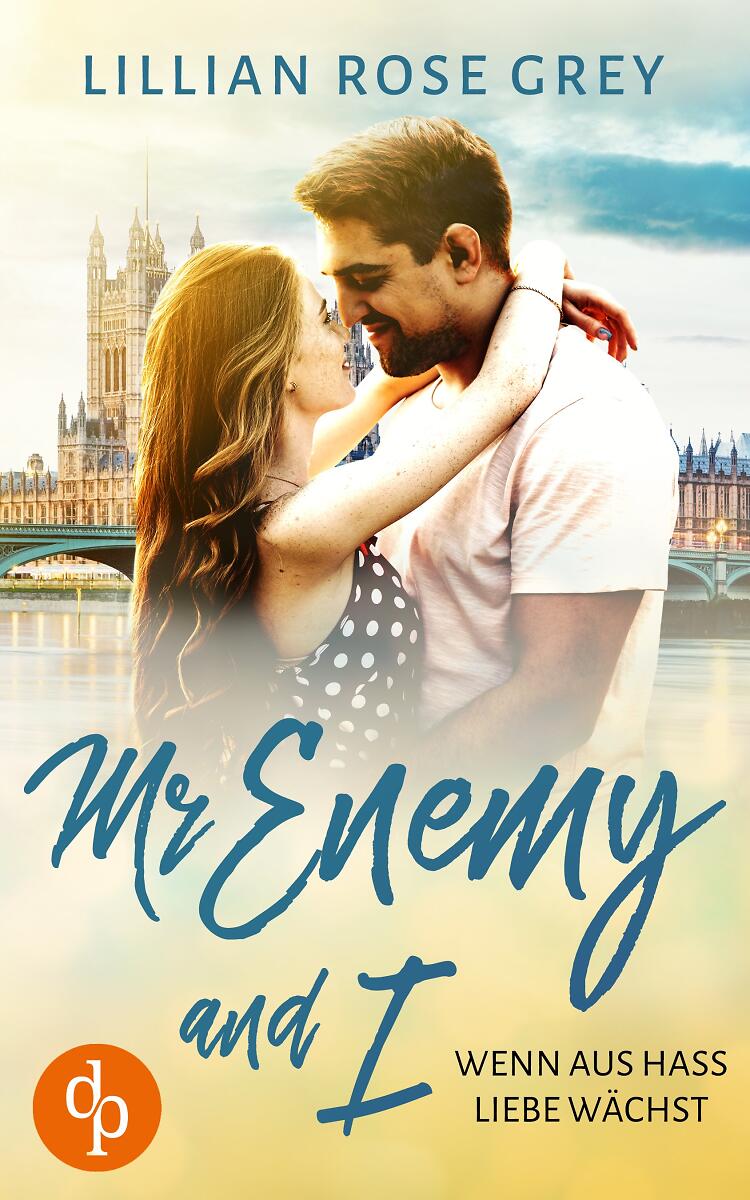Prolog
„Hier geblieben! Dachtest wohl, du kannst so einfach nach der Schule abhauen? Keine Chance, wir sind noch lange nicht mit dir fertig!“
Dröhnendes Gelächter drang an mein Ohr, gefolgt von einem scharfen Stich, der mir in die Eingeweide fuhr. Mein Kopf flog herum, und schließlich fanden meine Augen eine Gruppe Teenager, die eng aneinandergedrückt an einer Straßenecke standen. Sie lachten und schienen sich prächtig zu amüsieren, als mich die Erinnerung wie ein Blitz traf: Auch ich hatte einmal dort gestanden, genau an dieser Stelle, schwer atmend und mit dem Rücken an die Hauswand gepresst. Noch immer spürte ich die Panik in meiner Brust, als wäre es erst gestern gewesen. Ohne zu zögern, rannte ich los, direkt auf die Gruppe zu.
„Hört auf!“, brüllte ich bereits von weitem und fünf Köpfe drehten sich gemächlich nach mir um. Sie schienen nur mäßig daran interessiert, wer es wagte, ihr kleines Intermezzo zu stören. Drohend baute ich mich vor ihnen auf, so gut es bei meiner geringen Körpergröße möglich war.
Ein großer Junge mit roter Basecap, der vermutlich der Anführer der Gruppe war, sah mich nur gelangweilt an und spuckte seinen Kaugummi vor mir auf den Boden.
„Verzieh dich, Kleine, das hier geht dich überhaupt nichts an.“ Abwehrend wedelte er mit der Hand, als wäre ich nur eine nervige Fliege, die sich versehentlich in seinen Dunstkreis verirrt hatte. Aber da hatte er die Rechnung mit der Falschen gemacht. Kampflustig stellte ich mich direkt vor ihn und reckte das Kinn weit nach oben, um ihm zu signalisieren, dass ich keinerlei Angst vor ihm hatte. Ein Funken Interesse flackerte in seinen blauen Augen auf und erlosch gleich wieder. Mein suchender Blick fand ein Mädchen, das haltsuchend an der Hauswand lehnte, die Hände schützend vor das Gesicht gepresst. Sie roch förmlich nach Angst und Verzweiflung und ich konnte die Tränen fühlen, die sie mühsam zu verbergen versuchte. Diesen letzten Triumph wollte sie ihren Peinigern nicht gönnen.
Mein Herz krampfte sich vor Mitleid zusammen und entfachte meine Wut aufs Neue. „Ihr habt zwei Möglichkeiten“, sagte ich gefährlich ruhig. „Entweder ihr verschwindet auf der Stelle und lasst das Mädchen in Ruhe oder ich rufe die Polizei.“ Entschlossen zog ich mein Handy aus der Hosentasche und schwenkte es vor der Nase des Anführers hin und her. Mein Blick und meine Stimme ließen keinen Zweifel daran, wie ernst es mir war.
Einige Sekunden lang trugen wir ein stummes Gefecht aus, dann knickte die rote Basecap ein und blies zum Rückzug. „Kommt Leute, wir gehen. Die holen wir uns das nächste Mal.“ Mit voller Wucht trat er mit seinem schweren Stiefel gegen die Hauswand. Was für eine armselige Machtdemonstration!
„Beim nächsten Mal rufe ich direkt die Polizei, darauf könnt ihr euch verlassen“, drohte ich und wusste genau, dass es nichts nützen würde. Davon ließen sich die Teenager nicht abschrecken, denn sie würden immer neue Orte und Wege finden, um ihr Opfer zu quälen. Immerhin traten sie endlich den Rückzug an, wenn auch murrend und unter Protest.
Als sie fort waren, wandte ich mich schnell dem Mädchen zu, das nun schluchzend am Boden kauerte. Jede Beherrschung war von ihr abgefallen und ihre Schultern bebten. Vorsichtig näherte ich mich ihr und berührte sie sanft am Arm, während ich mich in die Hocke sinken ließ. „Ist alles in Ordnung mit dir?“
Keine Reaktion. Ich konnte sie so gut verstehen. Schließlich waren es nicht nur die Worte oder die Handgreiflichkeiten, die einen verletzten. Am schlimmsten war die Scham. Wenn man zuließ, dass die eigenen Grenzen durchbrochen wurden, fühlte es sich an, als wäre man sich selbst nichts mehr wert. Zu Beginn wusste man noch, wer Täter und wer Opfer war. Doch irgendwann fing man an zu glauben, selbst für sein Leid verantwortlich zu sein: Du hast es so weit kommen lassen! Du hast dich nicht gewehrt! Du hast sie herausgefordert! Ich wünschte, sie könnte bereits jetzt verstehen, dass es nichts gab, für das sie sich schämen musste. Dass sie keine Schuld trug, sondern nur das Opfer war. Dass es einen hässlichen Namen für ihr Leiden gab: Mobbing.
Äußerlich sah sie unversehrt aus. Wie ein kleines Vögelchen mit ihrem zarten Gesicht und den kurzen Haaren, die es wie ein Flaum umrahmten. Doch ihre inneren Wunden waren unsichtbar. Vielleicht würden sich erst Jahre später die Narben zeigen, wenn der tägliche Kampf vorbei war und die Erinnerungen an ihre Peiniger sie einholten: an jeder Straßenecke, beim Gang in den Supermarkt, praktisch überall. So wie sie es bei mir taten, an jedem einzelnen Tag seit vier Jahren.
Ich wagte einen zweiten Versuch: „Kann ich dir irgendwie helfen?“
Ihr raues Lachen war Antwort genug. „Mir kann keiner helfen.“ Die Bitterkeit und Resignation in ihrem Blick ließen mein Herz schwer werden.
Am Anfang war noch die Hoffnung da, dass es besser werden würde. Dass sie irgendwann aufhörten, obwohl sie keinen Grund dazu hatten. Schließlich war man ein leichtes Opfer. Nahezu perfekt dargeboten auf der Schlachtbank, die sich Klassenzimmer nannte. Mit Mitschülern, die eifrig mitmachten oder im besten Fall wegschauten. Toleriert von Lehrern, die zwar helfen wollten, aber zunehmend hilfloser wurden, bis sie irgendwann aufgaben.
Mühsam rappelte sich das Mädchen vom Boden auf. Ihre Beine zitterten, doch sie weinte nicht mehr.
„Kann ich dich nach Hause bringen?“, fragte ich vorsichtig.
Doch sie schüttelte nur den Kopf. „Bitte nicht“, antwortete sie leise und ich verstand sofort. Auch wenn es absurd war, wollte man seine Familie vor dem Schmerz schützen, den man Tag für Tag durchlitt. Wollte vermeiden, dass sie sich noch mehr Sorgen machte, als sie es ohnehin bereits tat. Stattdessen verhielt man sich so, als wäre alles in bester Ordnung. Als würde nicht jeden Tag ein kleines bisschen mehr der eigenen Seele sterben.
„Versprich mir, dass du dir Hilfe suchst. Es gibt immer eine Lösung, auch wenn du sie im Moment nicht siehst. Es wird besser werden“, versuchte ich ihr Mut zu machen. Keines meiner Worte würde ihr weiterhelfen, doch ich musste es zumindest versuchen. Das war ich ihr und mir schuldig.
Ihr Mund verzog sich zu einem schiefen Grinsen. „Natürlich.“
Sie glaubte mir kein Wort.
Es kam mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als ich an der Stelle dieses Mädchens gestanden hatte. Mein Vater hatte einen neuen Job angenommen und zusammen mit meinem kleinen Bruder Leo waren wir von Hamburg nach Stuttgart gezogen. Wehmütig hatte ich meine alten Freunde und meine geliebten Großeltern zurückgelassen, doch ich wusste, wie viel dieser neue Job meinem Vater bedeutete. Also beschloss ich, das Beste daraus zu machen. Fest entschlossen, mich in Windeseile einzuleben, freundete ich mich gleich zu Beginn der zehnten Klasse mit Lucy an. Wir waren wie Pech und Schwefel und ich war überglücklich, so schnell eine gute Freundin gefunden zu haben. Tagsüber steckten wir in der Schule die Köpfe zusammen und nachmittags trafen wir uns in der Stadt oder bei einer von uns beiden zuhause. Ich dachte, es könnte nicht schöner werden.
Doch als ich nach den Weihnachtsferien zurück in die Schule kam, war plötzlich alles anders. Ich spürte es in dem Augenblick, als ich das Klassenzimmer betrat und meine Mitschüler anfingen zu tuscheln. Als hätten sie nur auf mich gewartet, trafen mich ihre Blicke wie Dartpfeile. Hatte ich etwas Falsches gesagt oder getan? Doch niemand sprach mit mir und so setzte ich mich einfach auf meinen Stuhl und wartete ab. Erst als sich Jakob mit einem breiten Grinsen erhob und gemächlich auf meinen Platz zuschlenderte, dämmerte es mir langsam: Jakob Anderson, der fieseste Kerl der ganzen Schule, hatte mich auserkoren, sein nächstes Opfer zu sein.
Von Lucy wusste ich, dass er jedes Jahr einen Schüler herauspickte und ihn so lange quälte, bis er irgendwann den Spaß daran verlor und sich jemand Neues suchte. Diesmal war die Wahl auf mich gefallen und im Rückblick war mir auch klar, warum: Als neue Schülerin hatte ich noch keinen festen Stand in der Klasse. Zudem zogen meine leuchtend roten Haare und die zahlreichen Sommersprossen auf meinem Gesicht die fiesen Sprüche geradezu magisch an. Ich war das perfekte Opfer, und Jakob hatte es erkannt. Seine eisblauen Augen glitzerten voller Vorfreude, als er sich auf die Kante meines Tisches setzte. Lässig pustete er sich eine Strähne seines honigblonden Haares aus der Stirn, bevor er sich langsam zu mir hinunterbeugte. Ich konnte seinen Atem spüren und den Geruch nach Minzkaugummi riechen, als er mir ins Ohr flüsterte: „Gabs deine Sommersprossen umsonst oder hast du vor der Schule ein Schlammbad in der Pfütze genommen?“ Gespannt beobachtete er mich, so als wartete er auf eine Reaktion. Vermutlich dachte er, dass ich in Tränen ausbrechen würde. Doch ich starrte ihn nur unbehaglich an, denn mir war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollends klar, was hier gerade passierte. Unendlich sanft strich er mit dem Zeigefinger über meinen nackten Unterarm bis hinauf zu der empfindlichen Stelle in der Ellenbeuge. Diese Geste stand in solchem Widerspruch zu seinen Worten, dass mich plötzlich ein unkontrolliertes Zittern erfasste. In diesem Moment hatte mein Körper unterbewusst erfasst, was Jakob vorhatte, während mein Verstand noch dabei war, zu begreifen. Freude leuchtete in seinem Gesicht auf und in diesem Moment wurde mir klar, dass er sein Ziel erreicht hatte. Jakob wollte die Panik in meinen Augen sehen. Er wollte meinen Angstschweiß riechen und die Krönung all seiner Wünsche waren meine Tränen. Aus alldem zog er seine innere Befriedigung. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch kein Laut kam hervor. Stattdessen blieb ich stumm, denn Leuten wie Jakob konnte man mit Worten nichts entgegensetzen. Innerlich schwor ich mir, niemals vor Jakob Anderson zu weinen. Er konnte alles mit mir machen, aber diesen einen letzten Teil meiner selbst würde ich ihm niemals geben.
Als er aufstand und zu seinem Platz zurückging, drehte ich mich zu Lucy um, die stocksteif an ihrem Tisch hinter mir saß und mich mit schreckgeweiteten Augen anstarrte. Ich suchte in ihrem Blick nach Unterstützung und Hilfe. Doch alles, was ich fand, waren Mitleid und Furcht. Keine Furcht vor Jakob, das wurde mir schlagartig klar. Sondern Furcht vor unserer Freundschaft und was mein neuer Status in der Klasse für sie selbst bedeuten würde. In diesem Moment wusste ich, dass ich Lucy verlieren würde. Und so kam es auch. Dieser Tag nach den Weihnachtsferien veränderte mein Leben von Grund auf und war der Startschuss für eine nicht enden wollende Reihe an Grausamkeiten.
Jakobs erstes Ziel bestand darin, mich in der Klasse vollständig zu isolieren. Egal, wen ich ansprach, und wenn es sich nur um die Bitte nach einem Stift handelte, niemand antwortete mir. In einigen Augen las ich Scham und die stumme Bitte um Verzeihung. Die anderen Mitschüler hingegen schienen es regelrecht zu genießen, an Jakobs Feldzug beteiligt zu sein, und machten eifrig mit.
Als ich mich beinahe daran gewöhnt hatte, dass niemand mit mir sprach, änderte Jakob seinen Kurs. Der Psychoterror begann, zunächst nur gemächlich, um dann immer mehr an Fahrt aufzunehmen. Über Schimpfwörter wie „Karotte“ für meine Haare oder „Matschgesicht“ wegen der Sommersprossen konnte ich noch hinwegsehen. Bei „fetter Kuh“ und „Elefantenbeinen“ musste ich hingegen schwer schlucken. Doch ich schaltete meine Ohren auf Durchzug und blendete alles um mich herum aus, was sich allerdings als Fehler entpuppte. Denn Jakob lebte für meine Reaktion und zog Kraft aus meiner Schwäche. Wenn ich nicht reagierte, stachelte ihn das nur noch weiter an.
Jeden Tag fand ich einen Zettel an meinen Spind geklebt. Meine Finger zitterten bereits, als ich das Papier in die Hand nahm. Doch es war wie bei einem Autounfall: Wegschauen ging nicht, ich musste den Inhalt lesen. Als eines Tages ein Post-it mit den Worten „Wenn ich du wäre, würde ich mich umbringen“ mitten auf meinem Tisch klebte, war die Grenze erreicht. Ich schluckte und schluckte, um den dicken Kloß in meinem Hals loszuwerden, doch er verschwand nicht. Mir wurde klar, dass ich mit jemandem reden musste, um nicht den Verstand zu verlieren. Nach dem Unterricht nahm ich all meinen Mut zusammen und klopfte an das Büro unseres Vertrauenslehrers Herr Schulze.
„Marissa, was kann ich für dich tun?“, fragte er und deutete auf den leeren Stuhl vor seinem Schreibtisch.
Ich knetete vor Aufregung die Hände, als ich mich setzte und fieberhaft nach einem passenden Einstieg in das Gespräch suchte. „Ich glaube, ich werde gemobbt“, platzte es dann einfach aus mir heraus.
Seine rechte Augenbraue wanderte in die Höhe und er nahm eine kerzengerade Haltung auf seinem Bürostuhl ein. Jetzt hatte ich seine volle Aufmerksamkeit.
„Kannst du mir das genauer erklären?“
Es war unendlich schwer in Worte zu fassen, was in den letzten Wochen passiert war. Viele Dinge liefen auf einer so subtilen Ebene ab, dass man sie als Außenstehender kaum erfassen konnte. Also fiel ich direkt mit der Tür ins Haus und präsentierte den Post-it.
„Wenn ich du wäre, würde ich mich umbringen“, las er laut vor und sein Gesichtsausdruck wurde immer ernster. „Das ist eine schlimme Sache. Weißt du, wer diesen Zettel geschrieben hat?“
Mir wurde bewusst, dass ich in einer Zwickmühle steckte. Sollte ich Jakob verpfeifen und damit riskieren, seinen ganzen Zorn auf mich zu ziehen? Aus dem Bauch heraus entschied ich mich dagegen und antwortete stattdessen vage: „Es sind mehrere aus meiner Klasse.“
Herr Schulze seufzte. „Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, aber ich werde sehen, was ich tun kann.“
Er meinte es ernst, doch ich las in seinen Augen, was ich innerlich längst wusste: Er konnte mir nicht helfen. Niemand konnte mir helfen, solange Jakob nicht aufhören wollte. Denn er würde immer neue Mittel und Wege finden, mich zu quälen und nichts und niemand konnte ihn davon abhalten.
Am nächsten Tag hielt Herr Schulze wie versprochen eine Rede vor unserer Klasse. Natürlich nickten alle brav zu seinen Worten und beteuerten, dass es bei uns keinerlei Mobbing gab. Auch Jakob nickte, mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht, das geradezu „Lügner“ schrie. Zufrieden ging Herr Schulze zurück in sein Büro. Er hatte seine Pflicht getan, und ich war wieder allein. Für mich hatte sich nichts geändert, ganz im Gegenteil: Nach dem Auftritt von Herrn Schulze in unserer Klasse wurde alles nur noch schlimmer.
Während sich Jakob zuvor auf Worte beschränkt hatte, ließ er nun Taten folgen. Er war einfallsreich, das musste man ihm lassen. Wie zufällig wurde ich auf dem Schulhof angerempelt, geschubst und mir wurde auch mal kräftig auf den Fuß getreten. Jeder Sportunterricht war ein Trip in die Hölle, denn dort konnte man mir beinahe ungestraft weh tun. Dabei war es nicht nur Jakob, der mir all das antat. Das wäre viel zu auffällig gewesen. Er hatte seine Helfer, die für ein bisschen Anerkennung von ihm alles tun würden.
„Foul an Marissa“, schrie die Sportlehrerin beim Fußball im Minutentakt. Doch sie machte keinerlei Anstalten, einzugreifen. Erst als ich mit einem verstauchten Knöchel vom Platz humpelte, zeigte sie dem Angreifer die Rote Karte. Dieser grinste nur angesichts dieser lächerlichen Strafe und klatschte Jakob ab, bevor er auf der Bank Platz nahm.
Während ich mich am Anfang noch stark und selbstbewusst gab, verließ mich später immer mehr die Kraft. Mittlerweile verbrachte ich den gesamten Schultag allein. Wie erwartet hatte Lucy irgendwann aufgegeben und sich eine neue Freundin gesucht. Ich sah ihr das schlechte Gewissen an, doch sie wollte ihre eigene Haut retten. Ihre Freundschaft zu mir hatte Grenzen und irgendwie konnte ich sie verstehen.
Obwohl ich mit aller Macht dagegen ankämpfte, veränderte ich mich. Ich zog mich immer weiter in mein Schneckenhaus zurück und aß kaum noch etwas. Nicht etwa, weil ich abnehmen wollte, sondern ich hatte schlicht und ergreifend keinen Hunger mehr. Das war der Zeitpunkt, an dem schließlich auch meine Familie Wind von der Sache bekam.
„Hast du einen Magen-Infekt?“, fragte meine Mutter besorgt, als ich bereits den dritten Tag in Folge das Abendessen verweigerte und mich stattdessen in mein Zimmer verkroch. Zuvor hatten meine Eltern mein seltsames Verhalten vermutlich dem Teenageralter zugeschrieben. Doch als mein Gewicht rapide abnahm und ich kaum noch mein Zimmer verließ, begannen ihre Alarmglocken zu schrillen. Ihre Besorgnis zerriss mir beinahe das Herz, doch ich erzählte ihnen nichts von den Vorfällen in der Schule. Es war eine Sache, selbst unter Jakobs Grausamkeiten zu leiden. Aber zu sehen, wie es meine Eltern bis in Mark traf, dass ich litt, steigerte meine Qual ins Unermessliche. Als ich eines Abends meine Mutter leise im Bett weinen hörte, beschloss ich, die Sache fortan allein durchzustehen.
Ich zwang mich wieder zu essen und setzte zuhause ein fröhliches Gesicht auf, auch wenn ich mich innerlich wie tot fühlte. Außerdem gewöhnte ich mir an zu lügen und wurde erschreckend gut darin. Zuerst erfand ich imaginäre Freunde, mit denen ich mich nachmittags und am Wochenende traf, während ich in Wahrheit allein im Park oder in der Bibliothek saß und lernte. Aber es lohnte sich: Meine Eltern waren wieder glücklich und es reichte, dass ich litt. Es mussten nicht noch zwei weitere Menschen unter Jakob leiden. Diesen Triumph verdiente er nicht.
Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit wurde ich ihm nicht mit der Zeit langweilig. Ganz im Gegenteil: Er schien sogar besonderen Gefallen an mir gefunden zu haben und so kam es, dass er sich kein neues Opfer suchte. Vielleicht lag es daran, dass ich seine Grausamkeiten mit stoischer Ruhe ertrug. Ich hatte aufgegeben, auf ein Ende der Qualen zu hoffen, und vermutlich war genau das der Ansporn für ihn: Er wollte mich knacken, wollte irgendeine Reaktion aus mir herausholen. Sein Ziel war, dass ich weinte und ihn anflehte, endlich damit aufzuhören. Doch ich weigerte mich standhaft, genau das zu tun. Stattdessen umschloss ich mein Herz mit einer dicken, steinharten Mauer, die nicht einmal er zu durchdringen vermochte. Innerlich ging ich jeden Tag ein bisschen mehr zugrunde, doch ich würde eher sterben, als ihm zu zeigen, wie sehr ich litt. Diese Macht über mich gab ich ihm nicht und es machte ihn verrückt.
Ich lebte von Wochenende zu Wochenende und von Ferien zu Ferien, die ich allesamt allein verbrachte. Statt ins Schwimmbad radelte ich jeden Tag in die Bibliothek oder setzte mich auf eine Bank im Park. Ich achtete streng darauf, nicht zu früh nach Hause zu kommen, um meinen Eltern keinen Anlass für Misstrauen zu geben. Beinahe erschrak ich selbst darüber, wie gut mein Versteckspiel funktionierte. An jedem ersten Schultag nach den Ferien übergab ich mich heimlich ins Schulklo, wischte mir den Mund sauber und marschierte hoch erhobenen Hauptes ins Klassenzimmer.
Mein Ziel war mit einem großen X im Kalender markiert: das Abitur. Ich wollte die Schule endlich hinter mir lassen und meine Mitschüler nie wiedersehen. Keinen von ihnen aber vor allem nicht Jakob. Am Tag meiner Abiturfeier stand ich vor dem großen Spiegel in meinem Zimmer und ein Gefühl grimmiger Erleichterung durchströmte mich. Zum ersten Mal seit Jahren spürte ich einen Funken Hoffnung in mir aufflackern. Ich hatte überlebt. Ab heute stand alles auf Anfang und Jakob würde endlich Vergangenheit werden. Das dachte ich zumindest …
Kapitel 1
Schweiß lief in einem dünnen Rinnsal meinen Hals hinunter und bahnte sich einen Weg in den Ausschnitt meines blauen Sweatshirts. Angespannt fixierte ich die Pins auf der Bahn vor mir und kniff ein Auge zusammen, um besser zielen zu können. Dann holte ich aus, ließ die Kugel los und verfolgte mit angehaltenem Atem, wie sie sich ihren Weg auf der spiegelglatten Bowlingbahn suchte. Ich konnte nur beten, dass sie diesmal ihr Ziel treffen würde, ansonsten war mir der Spott der anderen sicher. Mein Herz pochte wie wild, als ich ungläubig dabei zuschaute, wie nicht nur ein oder zwei, sondern gleich alle Pins mit einem scheppernden Geräusch umfielen.
„Strike!“, brüllte es hinter mir und ich zuckte erschrocken zusammen.
„Gut gemacht, Babe.“ Adrian drückte mir einen Kuss auf die Wange und grinste mir anerkennend zu. „Wir haben gewonnen“, stellte er lächelnd fest, als er auf die elektronische Anzeigetafel deutete, die über der Bowlingbahn angebracht war.
Erleichtert atmete ich aus und machte im Stillen drei Kreuze. Ich war mit Sicherheit kein Bowling-Ass und der unbewusste Druck, sich nicht zu blamieren, gab mir den Rest. Dabei hätten mich weder Adrian noch sein bester Freund Tim oder dessen Freundin Nora ausgelacht. Es war mein eigener verbissener Wunsch zu gewinnen, der mir zu schaffen machte.
Als Tim vorschlug, etwas zu essen, stimmten wir sofort zu – Bowling machte hungrig! Wir nahmen in einer kleinen Sitznische mit roten Polsterbänken Platz, die wir in weiser Voraussicht reserviert hatten. Samstagabend war im Bowlingcenter immer die Hölle los und heute stellte keine Ausnahme dar. Die Speisekarte wanderte einmal im Kreis unserer kleinen Gruppe umher, doch als sie bei mir ankam, winkte ich direkt ab. Ich wusste genau, was mein Körper jetzt brauchte: Kalorien in Form einer großen Portion Chicken Nuggets mit Pommes. Allein der Gedanke daran ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.
„Wollen wir nächstes Wochenende ins Schwimmbad?“, fragte Tim in die Runde, während wir auf unsere Bestellung warteten.
Noras Augen leuchteten und sie klatschte begeistert in die Hände. „Super Idee! Ich wollte schon lange mein aufblasbares Einhorn testen.“
Unter dem Tisch griff Adrian nach meiner Hand und drückte sie sanft. „Hast du Lust auf Schwimmbad?“
Kurz zögerte ich, denn wenn ich ehrlich war, hielt sich meine Lust in Grenzen. Nackte Körper auf engstem Raum und mittendrin ich in meinem Badeanzug, der jedes Gramm überflüssige Körpermasse für alle Welt sichtbar machte. Doch ich wusste, wie wichtig es Adrian war, Zeit mit seinem besten Freund zu verbringen, also stimmte ich zu: „Natürlich, wir sind dabei.“
In Momenten wie diesen, wenn ich mit meinem Freund und unseren Freunden zusammensaß, überkam mich regelmäßig das Bedürfnis, mich fest in den Arm zu kneifen. Ich wollte mich vergewissern, dass all das Wirklichkeit und kein Traum war, denn in den letzten vier Jahren nach dem Abitur hatte mein Leben eine regelrechte Kehrtwende vollführt.
Nur wenige Wochen nach meinem Abschluss hatte ich Stuttgart den Rücken gekehrt. Mit Ausnahme von wenigen Besuchen bei meinen Eltern und Leo, war die Stadt seither Geschichte für mich. Meine Noten waren dank der vielen Stunden in der Bibliothek einsame Spitze und somit hatte ich die Qual der Wahl, was ich studieren wollte. Zum Glück musste ich nicht lange überlegen, denn mein Traumstudium stand bereits seit Ewigkeiten fest: Ich wollte Psychologie an der Universität Tübingen studieren, um anschließend als Therapeutin Kindern und Jugendlichen zu helfen, die Ähnliches erlebt hatten wie ich. Es sollte der Startschuss für mein neues Leben sein und so kam es auch.
Durch eine glückliche Fügung wurde mir ein Platz in einer Zweier-WG in einem Wohnheim mitten in der Altstadt von Tübingen zugewiesen. Mit noch mehr Glück entpuppte sich meine Mitbewohnerin Annie als ein wahres Goldstück. Als wir uns zum ersten Mal in der WG begegneten, war sie über und über mit Farbe bespritzt und hielt in jeder Hand einen Pinsel. „Ich arbeite gerade an einem neuen Bild. Impressionismus mit einem Hauch Surrealismus“, erklärte sie mir sofort und pustete sich eine schwarze Locke aus der Stirn, die sich frech ihrem Haarband entwunden hatte.
Ich musterte ihren Arbeitsoverall voller bunter Farbspritzer und die nackten Füße, die darunter hervorragten. Dann stahl sich ein Lächeln auf mein Gesicht. „Darf ich es sehen?“
Annie stutzte einen Augenblick, da es vermutlich nicht häufig geschah, dass sich eine Fremde für ihre Bilder interessierte. Doch dann nickte sie begeistert und zog mich in ihr Zimmer. In diesem Moment wurde unsere Freundschaft geboren. Etwas, das ich seit der unrühmlichen Geschichte mit Lucy schmerzlich vermisst hatte. Annie war die Erste, die mir die Hand zurück ins Leben reichte, und ich nahm sie dankbar an. Wie ein Fels in der Brandung saß sie jeden Nachmittag in der Küche und sobald ich die WG betrat, brüllte sie: „Marissa, Kaffee ist fertig!“
Bevor ich zum Lernen in mein Zimmer durfte, musste ich ihr zunächst haarklein von meinem Tag erzählen und irgendwann wurde aus der Pflicht eine liebgewonnene Routine.
Annie studierte Kunst und verbrachte viel Zeit in ihrem Zimmer, das mehr einem Atelier als einer Studentenbude glich. Zwei Staffeleien standen nebeneinander in dem kleinen Raum und das Weiß der Wände war kaum noch sichtbar vor lauter Farbe. In regelmäßigen Abständen packte sie die Inspiration und sie malte die ganze Nacht lang, bis sie am frühen Morgen erschöpft ins Bett fiel und bis zum Nachmittag schlief. Als Ausgleich für die vielen Stunden allein in ihrem Zimmer stand ihr Mund niemals still, sobald sie es verließ. Gebannt lauschte ich den Geschichten über ihre zahlreichen Liebschaften, denn eine feste Beziehung war nichts für sie – viel zu anstrengend! Dennoch wollte sie keineswegs auf Sex verzichten und so musste ich mir oft nachts die Bettdecke über den Kopf ziehen, wenn eine ihrer Bekanntschaften zu Besuch war. Sie legten los, als gäbe es kein Morgen mehr, denn das gab es tatsächlich nicht: Kein Junge durfte jemals an unserem kleinen Tisch in der Küche frühstücken, was ich äußerst angenehm fand, und deshalb ertrug ich die nächtliche Geräuschkulisse mit stoischer Ruhe.
Mit Annie teilte ich die Liebe zu ausgefallener Kleidung und allem Bunten. Wer unsere WG zum ersten Mal betrat, musste sie für eine fürchterliche Hippie-Bude halten. Wild gemusterte Vorhänge hingen an den Fenstern und der Fußboden war gepflastert mit Orientteppichen, die wir mühsam vom Flohmarkt nach Hause schleppten. Keines der Kissen auf unserem altersschwachen Sofa passte zum anderen, aber wir waren schrecklich verliebt in unsere kleine Studentenbude.
Vor einem Jahr lernte ich dann Adrian kennen, als ich ihm versehentlich in der Mensa einen Teller mit Linseneintopf vor die Füße leerte. Es sah aus, als hätte ich mich mitten auf seine Schuhe übergeben und ich war vor Scham wie gelähmt. Ich wartete bereits darauf, dass mich jemand von hinten geradewegs in die Essenslache schubste, doch nichts geschah. Stattdessen drückte mir Adrian beruhigend den Arm.
„Das ist mir dieses Semester auch schon passiert. Die Putzfrau schrubbt den Boden immer mit irgendeinem Höllenmittel und ständig rutscht jemand aus. Du wartest hier und ich organisiere einen Stapel Servietten.“
So kam es, dass Adrian die komplette Sauerei aufwischte, während ich daneben stand und nicht fassen konnte, dass er so nett zu mir war. Zum Dank lud ich ihn auf einen Moccachino mit Sahne in dem kleinen Café auf dem Campus ein. Vom ersten Augenblick an mochte ich diesen großen, schlanken Jungen mit seinen braunen Wuschelhaaren und einer Brille, die immer etwas schief auf seiner Nase saß.
„In zehn Jahren möchte ich ein Haus im Grünen und zwei Kinder haben“, erzählte er mir bereits beim ersten Treffen. Andere hätten bei diesem Gesprächsthema vermutlich direkt die Flucht ergriffen, doch ich hing wie gebannt an seinen Lippen und lauschte den Plänen für die Zukunft. Bei Adrian gab es keine taxierenden Blicke meinen Körper entlang, keine fiesen Sprüche oder Sticheleien. Damit war er genau das, was ich nach der Achterbahnfahrt in der Schule brauchte, und so dauerte es nicht lange, bis wir ein Paar wurden. Er konnte mir endlich geben, wonach sich mein Herz mit aller Macht sehnte: Sicherheit.
Das ganze erste Semester über verhielt ich mich wie ein verängstigtes Kaninchen. In allen Ecken sah ich Jakob lauern. Ich hörte seine Stimme im Hörsaal, sah sein Gesicht in der Mensa und roch seinen Minzkaugummi, wohin ich auch ging. Natürlich war er es nicht, kein einziges Mal. Jakob befand sich weit weg, zumindest körperlich. Emotional war er ganz nah bei mir. Ich erkannte erst jetzt, wie tief die Narben waren, die er geschlagen hatte. Mit welcher Kraft sie sich in mein Herz gegraben hatten und nicht bereit waren, es je wieder loszulassen. Immer wenn ich dachte, die Erlebnisse hinter mir lassen zu können, schlugen die Erinnerungen grausam zu und zwangen mich in die Knie. Unzählige Abende kauerte ich verzweifelt unter meiner Bettdecke, während mich die Emotionen, die ich so lange unterdrückt hatte, wie eine Lawine überrollten. Ich zahlte den Preis, den eigentlich Jakob und seine Mittäter hätten zahlen müssen. Mit jeder Faser meines Körpers hasste ich sie und wünschte mir nur eines: dass sie endlich aus meinem Leben verschwanden. Ich wollte frei sein. Frei von den Erinnerungen, den Gefühlen und diesem unerträglichen Schmerz in meiner Brust. Doch so einfach war es nicht.
Erst durch Annie gewann ich langsam aber sicher die Freude am Leben zurück, und als ich Adrian kennenlernte, kam in kleinen Schritten auch das Vertrauen in die Menschen wieder. Am Anfang nur vorsichtig, immer auf der Hut vor einer weiteren Enttäuschung. Ich traute mich nicht, mein Herz zu weit zu öffnen, denn eine weitere Verletzung würde es nicht ertragen. Zu tief waren die alten Wunden und eine weitere würde es zerstören. Doch Annie und Adrian ließen nicht locker und langsam wagte ich es, meine Fühler aus dem Schneckenhaus zu strecken und mich wieder ins Leben zu tasten.
Als ich nach unserem Bowlingabend erschöpft aber glücklich in meinem Bett lag, wanderten meine Gedanken zurück zu dem gestrigen Vorfall, als der Junge mit der roten Basecap das Mädchen bedroht hatte. Ob sie es sicher nach Hause geschafft hatte? Ich wusste, dass es nichts nützte, mir darüber Gedanken zu machen, denn ich konnte ihr nicht helfen. Nicht solange sie sich nicht helfen lassen wollte. Doch ich konnte einfach nicht anders, als mir zu wünschen, irgendetwas für sie zu tun.
Auf leisen Sohlen schlich sich plötzlich das Gesicht von Jakob in meinen Kopf. Was er wohl sagen würde, wenn er mich heute beim Bowling gesehen hätte? Dass ich jetzt Freunde hatte und sogar einen Freund, der mich liebte.
Doch vermutlich hatte er mich längst vergessen. Für ihn war ich nur ein austauschbares Spielzeug gewesen, ein Zeitvertreib für die langweiligen Unterrichtsstunden. Dass er mit seinem Verhalten beinahe ein Menschenleben zerstört hatte, war ihm sicherlich egal. Oder es gab ihm den besonderen Kick, wer wusste das schon?
Warum machte ich mir überhaupt Gedanken über ihn? Während er anfangs in Tübingen noch ständig in meinen Gedanken präsent war, hatte es mit der Zeit immer mehr abgenommen. Die letzten Monate hatte ich sogar überhaupt nicht mehr an ihn gedacht. Doch jetzt war er mit einem Schlag wieder zurück. Die Begegnung mit der roten Basecap hatte Dämonen geweckt, die ich längst vergraben glaubte. Als hätte Jakob nur auf eine Gelegenheit gewartet, in der mein Herz offen und unbewacht war, um sich dann hineinzustehlen. Doch er war lediglich ein Schatten meiner Vergangenheit und konnte mir nichts mehr tun, das sagte ich mir immer wieder. Mein verwundetes Herz musste das nur noch begreifen.