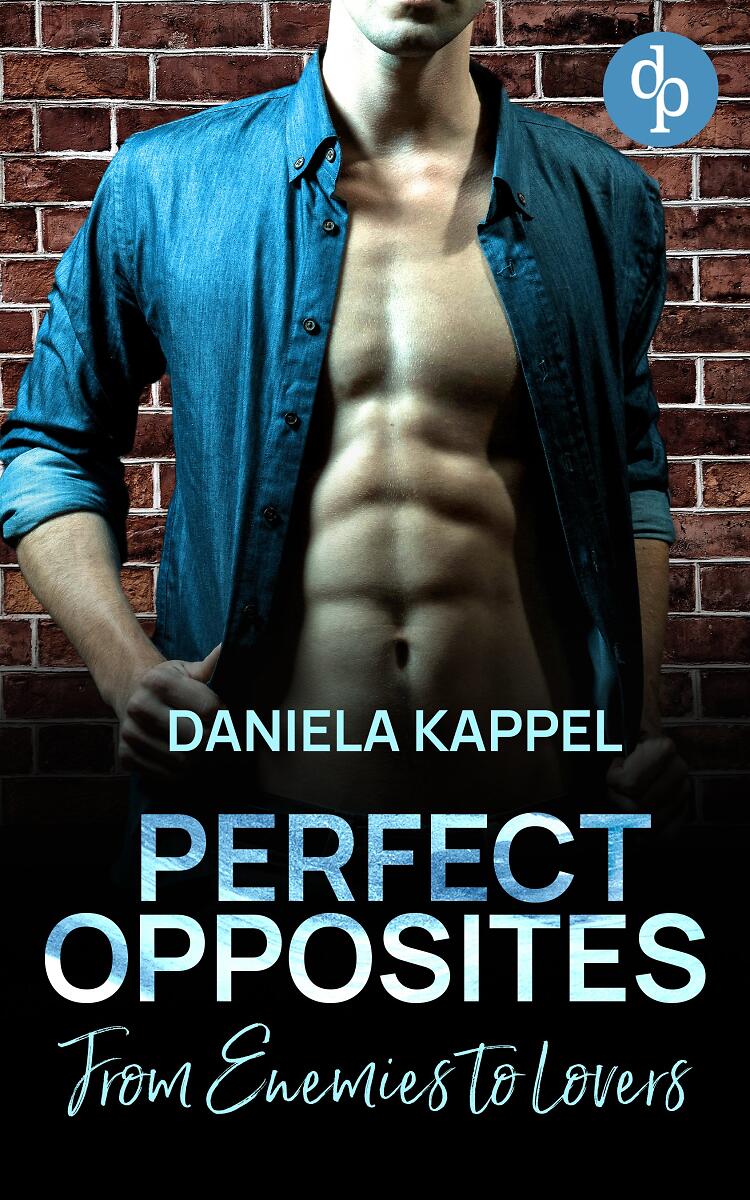Sargnagel
Lex
Gedankenverloren wischte ich über die schwarz lackierte Holztheke. Mein Blick ging ins Leere, und meine Lippen formten lautlos den Text des Songs, der aus der Jukebox dröhnte. Schon lange nicht mehr war ich so spät – oder sollte ich besser sagen früh? – in der Bar gestanden. Es war bereits Viertel nach sieben an einem Montagmorgen, und es kam äußerst selten vor, dass ich den Laden gerade sonntagnachts bis in den Morgen hinein geöffnet ließ. Allerdings gab es auch wenig Gelegenheiten dazu, wie in diesem Fall ein Junggesellenabschied, dessen betrunkene Schar nicht hatte abziehen wollen. Was dieser Umstand für die bevorstehende Hochzeit bedeuten würde, konnte ich nur erahnen.
Das Quietschen der Eingangstür riss mich aus meiner Trance.
Wir hatten seit zwei Stunden geschlossen, verdammt, und ich hatte keine Lust auf irgendeinen besoffenen Vollidioten, der noch immer um die Häuser zog und hoffte, bei mir einen Absacker abstauben zu können.
Warum hatte ich nicht abgeschlossen? Selbst schuld, Lex!
Seufzend pfefferte ich den Putzlappen ins Spülbecken und drehte mich Richtung Tür.
Beim Anblick des ernst dreinschauenden Schlipsträgers, der mit großen Schritten auf mich zukam, blieb mir die unfreundliche Begrüßung im Hals stecken.
Dieser Kerl war nicht betrunken, und ich war mir fast sicher, dass er nicht wegen eines Drinks hergekommen war.
Er wedelte die Rauchschwaden beiseite, die von meiner Zigarette im Aschenbecher aufstiegen, und hievte seinen Aktenkoffer auf die Theke.
„Mein Name ist Eliot Jenkins. Ich bin Notar und mit der Erbschaftssache von Marian Stuart betraut“, teilte er mir mit professioneller Gleichgültigkeit mit und streckte mir die Hand entgegen.
Meine wischte ich schnell, und wie ich hoffte, unauffällig an meiner Jeans ab, bevor ich Jenkins’ schüttelte. Dabei versuchte ich mir einzureden, dass die Feuchtigkeit vom Lappen rührte und nicht meiner steigenden Nervosität zuzuschreiben war. Doch wem wollte ich eigentlich etwas vormachen? Dieser Typ war wegen Marians Vermächtnis hier. Meine Zukunft stand auf dem Spiel.
Nachdem ich seinen laschen Händedruck erwidert hatte, räusperte sich Jenkins gekünstelt und löste die Verschlüsse seines Aktenkoffers. Der Deckel klappte gespenstisch geräuschlos auf und verdeckte sein Gesicht. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, und jetzt war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich die feuchten Hände meiner Aufregung zu verdanken hatte. Ich ermahnte mich, cool zu bleiben, griff aber gleichzeitig nach meiner halb abgebrannten Zigarette und nahm einen tiefen Zug. Ich zitterte leicht, was die Asche an der Spitze hinabregnen ließ. So viel also zum Thema Coolness.
„Den bei mir hinterlegten Papieren zufolge war Marian Stuarts einziger Besitz dieses Haus, was die Bar und die beiden Wohnungen im Obergeschoss einschließt“, begann er.
Verkrampft hielt ich mich an der Thekenkante fest. Die Bar war Marians Leben gewesen und meines, zumindest seit sie mich vor knapp fünf Jahren als Barkeeper eingestellt und mir das freie Apartment neben ihrem überlassen hatte.
Ihr Tod hatte nicht nur sie aus dem Leben gerissen. In dem Moment, als ich sie reglos in ihrem Bett gefunden hatte, war meine Welt aus den Fugen geraten. Ich hatte ihren kalten Körper aus den Laken gezerrt, den Notruf gewählt und sie so lange vergeblich wiederzubeleben versucht, bis die Rettungskräfte eingetroffen waren. Einer der Sanitäter hatte auf mich eingeredet und mich irgendwann, weil ich nicht reagierte, gepackt und von Marian weggezogen. Einen Tag später hatte ich mich beim Bestatter wiedergefunden und ihr Begräbnis organisiert, bei dem gerade mal zwei weitere Personen anwesend gewesen waren, eine davon der Pfarrer, die andere ein Stammgast aus der Bar.
Und seitdem bangte ich jeden verdammten Tag darum, wie es mit mir weitergehen würde.
„Sie sind doch Alexander Richardson, oder?“
Jenkins’ Frage riss mich aus den Gedanken. „Äh … ja …, der bin ich“, antwortete ich schnell.
„Könnten Sie sich bitte identifizieren?“
„Ja, natürlich“, murmelte ich und griff mir in die hintere Hosentasche, um mein Portemonnaie hervorzuholen. „Hier.“ Ich legte meinen Führerschein neben Jenkins’ Aktenkoffer.
Nickend griff er danach und notierte sich die Nummer, bevor er ihn mir wieder aushändigte. „Miss Stuart hat Ihnen ein unbegrenztes Bleiberecht für das eine der beiden Apartments in diesem Haus eingeräumt. Das ist die Beglaubigungsurkunde.“
Jenkins streckte mir ein Blatt entgegen, das ich, ohne auch nur ein Wort davon zu lesen, zweimal faltete und hinter meine Geldbörse in die Hosentasche schob.
Missbilligend sah mich Jenkins an. „Da wäre noch etwas.“
Ich hielt die Luft an.
„Die Bar …“, begann er.
Ja, die Bar! Was, zur Hölle, passierte mit der Bar? Hatte Marian sie mir etwa ebenfalls vererbt? Mir wurde heiß und kalt gleichzeitig.
„Miss Stuart hat sie ihrer Tochter vererbt.“
Ihrer Tochter? Nein, das konnte nicht sein. Marian hatte keine Tochter!
„Da muss ein Fehler vorliegen“, hörte ich mich mit rauer Stimme sagen.
„Kein Fehler. Nur ein Problem“, räumte er meinen Einwand ungerührt aus.
Eine Tochter? Meine Augenbrauen wanderten nach oben.
„Was für ein Problem?“, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, kurz davor, die Geduld mit diesem stoischen Mistkerl zu verlieren.
„Wir können sie nicht erreichen. Der hinterlegte Kontakt stimmt offenbar nicht.“
Mein Hirn war wie leer gefegt. Ich konnte einfach nicht fassen, dass Marian eine Tochter gehabt und sie all die Jahre über mit keinem einzigen gottverdammten Wort erwähnt hatte. Diesem Mädchen, wer auch immer es war, gehörte nun die Bar. Marians Bar. Meine Bar. Scheiße!
Automatisch griff ich nach einer neuen Zigarette und steckte sie mir an.
Wieder wedelte Jenkins gegen den aufsteigenden Qualm an. Missmutig schloss er seinen Aktenkoffer und schob ein Blatt Papier über den Tresen zu mir. Ich schielte darauf und erkannte die Kopie eines Reisepasses. Daneben stand in Marians Handschrift eine Telefonnummer.
„Wenn Sie Miss Stuart nicht innerhalb von zehn Tagen erreichen, geht das Haus in den Besitz der Bank über, und Ihr Bleiberecht für die Wohnung erlischt leider“, erklärte Jenkins in nüchternem, geschäftsmäßigem Tonfall. Ich legte die Stirn in Falten. Was faselte er da eigentlich? Marian war doch tot und … Da verstand ich erst, was oder vielmehr wen Jenkins meinte. Er sprach gar nicht von Marian, sondern von ihrer Tochter. Diese Miss Stuart musste ich finden, wenn ich nicht in zehn Tagen alles verlieren wollte, was ich mir in den letzten fünf Jahren aufgebaut hatte.
Ich nickte steif. Zu meiner Erleichterung verschwand Jenkins und ließ nur seine Visitenkarte auf der Theke zurück.
Zischend stieß ich Luft aus, trat gegen den Sodacontainer und wandte mich zu den Spirituosen um.
Jenkins’ Karte und die Ausweiskopie von Marians Tochter ignorierte ich erfolgreich, griff mir die nächstbeste Flasche, umrundete die Theke und schloss die Tür ab.
Bevor ich die Treppe erreicht hatte, schraubte ich den Deckel ab und genehmigte mir einen großen Schluck.
Der Scotch brannte angenehm in meiner Kehle, während ich die Stufen hinaufstapfte.
Als mein Blick auf Marians geschlossene Wohnungstür fiel, setzte ich die Flasche gleich noch einmal an. Ich bog nach rechts ab und knallte die Tür meines Apartments hinter mir zu, ließ mich daran nach unten sinken und trank einen weiteren Schluck.
Ich hatte ein pelziges Gefühl auf der Zunge, und das Licht der untergehenden Sonne war schmerzhaft hell in meinen Augen.
Stöhnend fuhr ich mir durchs Haar, rappelte mich auf und wäre beinah gegen den Beistelltisch neben der Wohnungstür gekracht.
Ich gab einen Fluch nach dem anderen von mir, setzte die Scotchflasche etwas zu fest auf dem Couchtisch ab und schleppte mich ins Bad.
Als Erstes stellte ich das Wasser in der Dusche an, weil es immer Ewigkeiten brauchte, um warm zu werden. Dann zog ich mir das T-Shirt über den Kopf und stieg aus meiner Jeans, den Socken und Boxershorts.
Mein grimmiges Gesicht blickte mir aus dem Spiegel entgegen, und ich war drauf und dran, mit der Faust hineinzuschlagen.
Stattdessen begnügte ich mich mit einem tiefen Seufzen und stellte mich unter die laufende Brause.
Nachdem ich fertig geduscht und abgetrocknet war und mich glücklicherweise wieder einigermaßen lebensfähig fühlte, griff ich nach meinen muffigen Klamotten auf dem Fliesenboden. Als ich sie anhob und gerade in den Wäschekorb stopfen wollte, fiel mein Portemonnaie aus der Tasche, gefolgt von einem gefalteten Blatt Papier.
Die Erinnerungen holten mich ein, ließen mein Herz einen Schlag aussetzen.
Heilige Scheiße, die Tochter. Marians Tochter. Ich musste sie finden, sonst würde ich in weniger als zehn Tagen auf der Straße stehen.
Leise grummelnd schnappte ich mir Geldbörse und Beglaubigung, ging ins Schlafzimmer und zog mir frische Sachen an.
Bereits auf dem Weg die Treppe nach unten begrüßte mich der altbekannte Geruch der Bar. Eine undefinierbare Mischung aus Alkohol, Schweiß und kaltem Rauch.
Auf dem Tresen, genau dort, wo ich sie am Morgen zurückgelassen hatte, lagen immer noch Jenkins’ Visitenkarte und die Passkopie.
Ich zündete mir eine Zigarette an und holte eine Coke aus der Kühllade. Nach einigen großen Schlucken konnte ich das Unvermeidliche nicht länger vor mir herschieben. Also griff ich nach dem Blatt und betrachtete es eingehend.
Die Kopie hatte keine sonderlich gute Qualität, aber ich konnte alles lesen und das Foto einigermaßen erkennen.
Amy Lynne Stuart. Das war also der Name von Marians Tochter. Die Adresse konnte unmöglich stimmen, denn ich wüsste es, wenn sie hier wohnen würde.
Als Nächstes stach mir das Geburtsdatum ins Auge. Sie war fünfundzwanzig. Gerade mal zwei Jahre jünger als ich. Kein Mädchen also, sondern eine Frau.
Dem Foto nach zu urteilen, war sie aber bei der Aufnahme um einiges jünger gewesen. Ihre grünen Augen wirkten etwas zu groß in dem herzförmigen Gesicht, das von weichen braunen Locken umspielt wurde. Unverkennbar Marians Tochter.
Ich riss mich von dem Foto los und sah mir die Telefonnummer genauer an.
Konnte es vielleicht sein? Marian hatte gern unbeabsichtigt die letzten beiden Ziffern vertauscht. Diese kleine Marotte hatte mich bei der Kontrolle der Lagerstandslisten regelmäßig zur Verzweiflung gebracht. Was, wenn sie auch hier einen Zahlendreher eingebaut hatte, ohne es zu bemerken? Zögernd griff ich nach meinem Smartphone und tippte die Nummer ein.
Lynne
Fertig! Ich schob alle Prüfungsbögen fein säuberlich zusammen und heftete sie wieder mit der Büroklammer aneinander. Meinen Rucksack über eine Schulter gehängt, stieg ich die Stufen des Hörsaals hinunter zum Lehrerpult und musste mich zusammenreißen, damit ich nicht bei jedem Schritt hopste, wie es die glücklichen Idioten in Filmen immer taten.
Das breite Grinsen konnte ich mir aber keinesfalls verkneifen, selbst wenn ich es gewollt hätte.
Ich war frei! Das war meine letzte Prüfung gewesen, und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich gut abgeschnitten hatte.
Professor Stevens schenkte mir das für sie typische steife Lächeln, als sie meine Prüfungsunterlagen entgegennahm.
Ein paar meiner Kommilitonen sahen zu mir auf und verfluchten mich sicherlich, doch das war mir so was von egal.
Während die meisten die Collegezeit mit wilden Partys und Bettgeschichten verbracht hatten, war ich über meinen Büchern gesessen. Hatte gearbeitet und gelernt. Gelernt und gearbeitet. Weiter nichts. Die Belohnung dafür war, mit Bestnoten und im Eiltempo mein Informatikstudium abgeschlossen zu haben.
Immer noch von dieser glückseligen Erleichterung getragen, ging ich ins Wohnheim.
Weil ich nie am letzten Tag vor einer Prüfung lernte, sondern den Stoff schon Tage vorher intus hatte, war mir gestern ausreichend Zeit geblieben, um die ersten Sachen zu packen. Den Rest würde ich jetzt verstauen, und dann nichts wie weg. Die Feierlichkeiten mit der Diplomübergabe waren kein Pflichtprogramm, daher würde ich nicht daran teilnehmen, mir meine Zeugnisse stattdessen abholen oder zuschicken lassen.
Ich betrat das halb abgedunkelte Wohnheimzimmer, das ich mir seit diesem Semester mit Emily teilte. Sie lag in ihrem Bett und stöhnte gequält, als ich die Verdunklungsvorhänge meines Fensters beiseitezog.
Schlaftrunken murmelte sie etwas in ihr Kissen, das nach „Du Monster“ klang. Ich sparte mir eine Erwiderung und zog unbeirrt mein Bettzeug ab.
Emily und ich hatten das letzte halbe Jahr in stiller Koexistenz verbracht. Na ja, ich war still gewesen. Sie war eher der laute Typ, vor allem, wenn sie jemanden, und damit meine ich Männer, mit aufs Zimmer nahm. Das waren die einzigen Momente gewesen, in denen wir miteinander gesprochen hatten, wenn wir uns stritten.
Emily hielt nicht sonderlich viel von mir, was definitiv auf Gegenseitigkeit beruhte. Wenn ich ehrlich war, konnte ich niemanden hier besonders leiden. Oder Menschen im Allgemeinen. Ich mochte Zahlen und Technik. Vor allem Computer.
Dieses College war vielleicht nicht das Beste, die Studiengebühren dafür halbwegs erschwinglich, und ich hatte meinen Abschluss, ohne Schulden gemacht zu haben, in der Tasche, weil ich nebenbei Websites und kleinere Apps programmiert hatte.
So stellte ich mir auch meine Zukunft vor. Programmieren und meine Ruhe haben. Mehr wollte ich nicht vom Leben.
Da gab es aber leider ein kleines Problem. Ich hatte keinen Job in Aussicht. Die meisten Stellen, die es für Computerfachleute und Programmierer ohne Berufserfahrung gab, hatten etwas mit Projektentwicklung oder Großraumbüros zu tun. Was hieß, viele Kollegen zu haben und mit diesen zwangsläufig zusammenarbeiten zu müssen. Das kam für mich definitiv nicht infrage. Ich träumte davon, allein zu arbeiten. Nur ich und mein Computer, ohne andere Leute, die mich nerven konnten.
Vielleicht war ich eigenartig. Ein Nerd. Eine Einzelgängerin. Aber so war ich eben, und ich wollte es nicht anders. Nicht ums Verrecken.
Beziehungen zu anderen Menschen machten einem bloß Probleme.
Der Haken an der Sache war allerdings: Ohne Job und ein festes Einkommen hatte ich nicht genügend Geld für eine eigene Wohnung. Die Immobilienpreise außerhalb des Campus waren nicht ansatzweise mit den Gebühren für mein Wohnheimzimmer vergleichbar. Nicht einmal in Addition mit den Studiengebühren.
Also würde ich die erste Zeit in meinem Wagen schlafen müssen. Das war zwar eine äußerst unangenehme Aussicht, aber allemal besser, als in eine WG zu ziehen.
Ich legte mein perfekt gefaltetes Bettzeug in den Karton oben auf meine Bücher und wollte gerade ins Bad, um meine Toilettensachen zu holen, da erklang eine Durchsage im Zimmer.
Die hohe Stimme von Mrs. Phelbs, der Wohnheimaufsicht, schallte aus den Lautsprechern. „Ein Telefonat für Miss Stuart. Bitte kommen Sie in mein Büro.“
Hatte sie das gerade tatsächlich gesagt? Ein Telefonat für mich? Wer rief mich denn an?
„Wer ruft dich denn an?“, kam es von Emily, die sich gleich darauf demonstrativ das Kopfkissen über die Ohren zog.
Eine bitterböse Vorahnung keimte in mir auf.
Es gab nämlich nur einen einzigen Menschen, der diese Telefonnummer kannte. Meine Mutter. Und die hatte mich in all den Jahren nie, kein einziges verdammtes Mal angerufen. Wofür ich ihr dankbar war. Auch wenn es ganz sicher das Einzige war, wofür ich ihr dankbar sein konnte.
Als ich mich mit sechzehn für volljährig hatte erklären lassen und von zu Hause ausgezogen war, hatten wir eine Übereinkunft getroffen. Sie ließ mich in Ruhe. Im Gegenzug sorgte ich dafür, dass sie immer eine Nummer hatte, unter der sie mich im allerschlimmsten Notfall erreichen konnte.
Was zum Glück bisher nie der Fall gewesen war. Also was, zum Teufel, musste vorgefallen sein, dass sie es jetzt tat?
Zaghaft klopfte ich an Mrs. Phelbs’ verglaste Bürotür. Scheiße, war ich aufgeregt.
„Herein.“
Scheiße. War. Ich. Aufgeregt.
Normalerweise brachte mich nichts so schnell aus der Ruhe. Ich war ein ausgeglichener Mensch, solange mir niemand auf die Nerven ging. Aber schon beim bloßen Gedanken an meine Mutter brach mir der kalte Schweiß aus.
Ich drückte die Klinke hinunter, trat ins Zimmer und schloss gleich darauf die Tür hinter mir.
Mrs. Phelbs hielt mir den Hörer ihres Festnetztelefons entgegen.
Ich musste mich regelrecht dazu zwingen, zum Schreibtisch zu gehen und ihn entgegenzunehmen, machte dann jedoch keine Anstalten, ihn mir ans Ohr zu halten. Stattdessen legte ich eine Hand übers Mikrofon und sah Mrs. Phelbs demonstrativ an.
Was auch immer meine Mutter von mir wollte, ich würde dieses Gespräch sicher nicht im Beisein von Zeugen annehmen.
Mit pikiertem Blick erhob sie sich von ihrem Schreibtischsessel. „Ich hole mir mal einen Kaffee“, teilte sie mir mit.
Ich nickte stockend und wartete, bis sie das Büro verlassen hatte.
Tief durchatmen, Lynne! Egal was sie bewegt hat, dich anzurufen, du schaffst das.
Ich hatte es immer geschafft, obwohl ich jeden Augenblick meines alten Lebens gehasst hatte.
„Ja“, krächzte ich schließlich in den Hörer.
Es raschelte in der Leitung. „Spreche ich mit Amy Lynne Stuart?“ Das war nicht die Stimme meiner Mutter, es war ein Mann. Ein Arzt? War meiner Mutter etwas zugestoßen? Lag sie im Krankenhaus?
Eine erdrückende Leere breitete sich in meinem Brustkorb aus. Plötzlich fühlte ich mich so einsam, dass es mir die Kehle zuschnürte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich geglaubt zu wissen, wie sich Einsamkeit anfühlt. Meine Mutter war praktisch nie für mich da gewesen. Hatte sich nie wirklich um mich gekümmert. Ihr war immer nur die Bar wichtig gewesen. Und der Alkohol. Ich war diejenige gewesen, die sich um sie gekümmert hatte. Die einkaufen gegangen war, die Wohnung geputzt und die Wäsche gewaschen hatte. Ich hatte sie beinah jeden Abend von der Bar die Stiegen ins Obergeschoss hochbugsiert und ihren besoffenen Hintern ins Bett verfrachtet.
Trotzdem überkam mich bei der Vorstellung, es könnte ihr etwas zugestoßen sein, ein eisiges Gefühl. Ich lebte mein Leben vielleicht ohne sie. Stand auf eigenen Beinen. War froh darüber. Aber trotzdem war es etwas anderes, die Gewissheit zu haben, tatsächlich ganz allein auf dieser Welt zu sein. Über meinen Erzeuger wusste ich rein gar nichts, hatte ihn kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Was mich anbelangte, existierte er nicht.
„Einfach Lynne“, murmelte ich ins Telefon.
Eine kurze Pause folgte. „Okay, Lynne. Ich bin Lex, ein Mitarbeiter deiner Mutter.“ Wieder eine Pause.
Jetzt spuck’s schon aus, verdammt! Ich konnte diese Anspannung keinen Augenblick länger ertragen. „Was ist mit ihr? Ist sie …?“, setzte ich an, unfähig, die Frage ganz auszusprechen.
Er fluchte leise und räusperte sich. „Marian hatte vorletzten Freitag einen Herzinfarkt. Lynne, deine Mutter ist gestorben.“
Ich hatte ein Rauschen im Ohr und fühlte, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich.
Meine Mutter war gestorben. Sie war tot.
Ich meinte, nicht imstande zu sein, etwas darauf zu erwidern, doch ich hörte mich mit leiser kratziger Stimme sagen: „Okay.“ Okay? Was redete ich da? Nichts war okay! Nichts, verdammt! Meine Vergangenheit, meine ganze beschissene Kindheit holte mich in diesem Moment ein, und die saftige rote Kirsche auf dem Sahnehäubchen war der Tod meiner Mum. Warum tat das so weh? Warum war es mir nicht egal? Immerhin hatte ich ihr nie das geringste bisschen bedeutet, und trotzdem trauerte ich jetzt um diese Frau, die mich zwar auf die Welt gebracht hatte, aber niemals eine richtige Mutter gewesen war.
„Okay?“, wiederholte Lex ungläubig. Sein Ton holte mich zurück ins Hier und Jetzt. Klang er vorwurfsvoll, oder bildete ich mir das ein? Was wollte dieser Kerl eigentlich von mir?
„Okay“, sagte ich noch einmal, etwas zu laut und zu schroff, aber immerhin gewann ich dadurch wieder ein wenig von meiner Fassung zurück. Sollte er denken, was er wollte. Was interessierte es mich?
„Die Sache ist die, sie hat dir die Bar vererbt“, erklärte Lex mit eisiger Stimme.
Nein! Das hatte sie nicht getan! Sie war nicht gestorben und hatte mir diese gottverdammte Kneipe hinterlassen. Was sollte ich damit? Seit meinem sechzehnten Geburtstag hatte ich jede Bar gemieden. Mein Bedarf an Barbesuchen war lebenslang gedeckt.
„Und das Apartment“, setzte Lex nach.
Apartment. Das Apartment!
Konnte ich es ertragen, in die Bar, in dieses Haus zurückzukehren? Dann hätte ich wenigstens ein Dach über dem Kopf und müsste nicht im Auto schlafen. Ich müsste mir keinen schlecht bezahlten Job suchen, sondern konnte mich, wie ich es mir vorgestellt hatte, in meinen eigenen vier Wänden verkriechen und weiter vor mich hin programmieren. Das Geld, das ich damit verdienen würde, reichte allemal für meinen Lebensunterhalt, wenn ich keine horrende Miete davon bezahlen musste. Allerdings war es in meiner Vorstellung definitiv nicht diese Wohnung gewesen.
„Lynne?“ Er klang ungeduldig.
„Du arbeitest in der Bar?“, fragte ich. Wenn er sich um die Bar kümmerte, konnte ich mit den Einnahmen das Haus halten, und mein Plan könnte tatsächlich funktionieren.
„Ja“, antwortete er gedehnt. Ich hatte das Gefühl, dass er noch mehr hatte sagen wollen, doch er schwieg.
„Okay“, erwiderte ich schließlich.
„Okay was?“ Wieder diese Ungeduld.
„Ich komme“, sagte ich ins Telefon und legte ohne ein weiteres Wort auf.
Hätte ich es nicht getan, hätte ich vermutlich einen Rückzieher gemacht. So aber stand mein Entschluss fest. Ich würde nach Hause fahren.
Viereinhalb Stunden Fahrt später passierte ich das Ortsschild meiner Heimatstadt. Home sweet home. Würg.
Ich war nur aus einem einzigen Grund hergekommen. Ich würde es irgendwie hinkriegen, mein Leben so zu leben, wie ich es wollte. Und der erste Schritt war nun mal, hier neu anzufangen.
Meinen klapprigen Ford Taunus, der den weiten Weg überraschend gut gemeistert hatte, parkte ich neben dem Haus, stieg aus und atmete den altbekannten Geruch von sonnengewärmtem Backstein ein, der die Gasse erfüllte.
Also gut. Ich würde einfach reinspazieren und sehen, was passierte. Entschlossen bog ich um die Ecke und blieb abrupt vor der Tür zum Pub stehen. Alles in mir schrie plötzlich, mich ganz schnell wieder umzudrehen und zu verschwinden. Ich hatte niemals wieder herkommen wollen! Nie mehr ins Gesicht meiner Mutter blicken wollen. Genau das würde ich auch nicht. Nie wieder. Sie war tot. Wirklich und wahrhaftig tot. Wenn ich diese Tür öffnen und die Bar betreten würde, wäre sie nicht da. Nicht hinterm Tresen, wie sie es stets gewesen war. Diese Tatsache hätte es vermutlich einfacher machen sollen, tat sie allerdings nicht. Ich hatte allen Grund, meine Mutter zu hassen, aber das einzige Gefühl, das mich in diesem Moment durchströmte, war Traurigkeit.
Komm schon, Lynne! Ich verpasste mir selbst einen gedanklichen Arschtritt und schob meine Emotionen beiseite.
Die Tür quietschte genauso wie früher, und der Geruch nach Zigaretten, Menschen und Alkohol empfing mich ebenfalls sofort, als ich in die Bar trat. Es waren kaum Leute da. Keine vertrauten Gesichter. Nicht verwunderlich an einem Dienstagabend.
Nervös zupfte ich am Saum meines Shirts, auf dem die Aufschrift Entschuldigung, ich spreche nur Ruby prangte. Es war alt, verwaschen und ausgeleiert, aber eines meiner liebsten Teile. Ich fühlte mich wohl darin, und genau deshalb hatte ich es angezogen, obwohl mir der Halsausschnitt immer über eine Schulter rutschte. Ich unterdrückte den Impuls, es hochzuziehen, und schlenderte mit all der Lässigkeit, die ich aufbringen konnte, zum Tresen.
Ein Kerl stand dahinter. Den Kopf über ein Glas gesenkt, das er mit dem Tuch in seiner Hand polierte. Wie klischeehaft!
War er der Typ, der mich angerufen hatte? Er musste es sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Mutter noch jemanden außer ihm eingestellt hatte. Es war ja bereits untypisch für sie gewesen, überhaupt jemanden in ihre heiligen Hallen aufzunehmen.
Sein dunkles Haar fiel ihm ins Gesicht und hinderte mich daran, mehr als einen dunklen Bartschatten erkennen zu können. Dafür ließ das eng anliegende Muskelshirt wenig der Fantasie übrig. Er war gut gebaut, aber ich hatte andere Dinge, über die ich mir Gedanken machen musste, als seine breiten Schultern und den ausgeprägten Bizeps. Die Bizepse. Äh, war das überhaupt der korrekte Plural?
Meine dämlichen Überlegungen verpufften, sobald er den Kopf hob und mich ansah. Überraschung spiegelte sich in seinen Augen, die einen warmen Karamellton hatten.
Ich schluckte und setzte ein Lächeln auf. Das immerhin beherrschte ich im Schlaf. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Er erkannte mich, obwohl wir uns nie zuvor gesehen hatten, darauf würde ich meinen Arsch verwetten. Mir war allzu bewusst, dass ich ein Klon meiner Mutter war. Die gleichen Gesichtszüge, die gleichen braunen Locken, die dermaßen widerspenstig waren, dass ich das Haar nie offen tragen konnte, sondern es immer, wie jetzt, mit einem Band auf dem Hinterkopf zusammenfassen musste. Nur meine grünen Augen hatte ich wohl von meinem Erzeuger geerbt, zumindest vermutete ich das.
Ein finsterer Ausdruck huschte über das kantige Gesicht des Barkeepers, dann senkte er wieder den Kopf und griff sich das nächste Glas.
War das Desinteresse? Na dann. Er hatte mich wohl doch nicht erkannt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finden sollte.
Beim Tresen angekommen, schwang ich ein Bein über den Hocker und zog mich an der Theke hinauf. Bei meiner überschaubaren Körpergröße von knapp fünfeinhalb Fuß hätte ich genauso gut auf ein Pferd klettern können, so hoch waren diese verdammten Barhocker. Erst mit fünfzehn war ich in der Lage gewesen, überhaupt allein hinaufzukommen.
Ich schob die aufkeimenden Erinnerungen vehement beiseite und klopfte auffordernd auf den Tresen. Mr. Gläser-polieren-ist-viel-interessanter-als-Kunden-bedienen sah auf. Ein kokettes Lächeln umspielte seine Lippen. Oha! Unerhört langsam ließ er den Blick über meinen Körper wandern und lehnte sich weit nach vorne.
„Na, Schönheit, was kann ich für dich tun?“, fragte er und lächelte mich nach wie vor dermaßen frech an, dass mir heiß wurde. O Gott, der flirtete mit mir! Das waren leider die Momente, in denen mir mein analytisches Gehirn den Dienst versagte. Weder mein IQ noch das jahrelange Studium wogen in solchen Situationen die mangelnde Sozialkompetenz auf.
„Eine Coke“, antwortete ich und war gleichermaßen überrascht und dankbar, nicht so perplex zu klingen, wie ich mich fühlte.
„Keinen Drink?“
Nein, keinen Drink. „Ich trinke keinen Alkohol.“ Diesmal hatte ich meine Stimme nicht gut unter Kontrolle.
Ihm entging der Frost in meinen Worten nicht. Sein Lächeln wurde schmaler, und er zog leicht die Augenbrauen hoch, fasste sich aber schnell wieder. „Ich fürchte, dann bist du hier falsch, Schätzchen.“
Schätzchen? Echt jetzt? Ich fühlte, wie Zorn in mir aufstieg. Genug der Scharade!
So graziös wie möglich glitt ich vom Barhocker, umrundete ohne zu zögern den Tresen und zog an der ersten Kühllade neben den Bierfässern. Ha!
Ich griff mir eine Coke und öffnete den Kronkorken an der Außenkante der Theke, wie ich es Hunderte Male davor gemacht hatte.
Der Kerl sah mir seelenruhig dabei zu, ohne Einwände zu erheben oder auch nur mit der Wimper zu zucken. Entweder er ließ jeden hinter den Tresen, oder aber …
„Du wusstet gleich, wer ich bin“, stellte ich in unterkühltem Tonfall fest.
Er hob die Schultern. „Ich wollte mir erst einen Eindruck von dir verschaffen“, meinte er.
Ah ja. „Dito.“
Einen Moment schwiegen wir beide. Maßen uns mit Blicken.
„Und, wie ist dein Eindruck von mir?“, fragte er und klang so sachlich, als würde er übers Wetter sprechen. Oh, das willst du nicht wissen, Freundchen!
„Ich denke, du bist ein Typ, der alles besteigt, das nicht bei drei auf den Bäumen ist.“ Ups. Hatte ich das gerade tatsächlich gesagt?
Er lachte lauthals los.
Na, schönen Dank!
„Mag sein, aber das gilt ganz bestimmt nicht für Marians kleine Tochter. Egal wie niedlich sie aussieht“, erklärte er, nachdem er sich wieder einigermaßen eingekriegt hatte.
Niedlich? Ich würde ihm gleich zeigen, wie niedlich ich war.
Er musste mir meine Gedanken angesehen haben, denn sein Lachen erstarb nun endgültig, und er lehnte sich mit verschränkten Armen seitlich an den Tresen. „Jetzt sei doch nicht so kratzbürstig.“
Ich unterdrückte ein wütendes Schnaufen, verdrehte dafür aber die Augen und nahm einen großen Schluck aus meiner Cokeflasche.
„Also“, setzte ich an.
„Also“, wiederholte er.
„Du bist Lex?“ Ich ließ es wie eine Frage klingen, obwohl ich mir mittlerweile sicher war, dass er es gewesen sein musste, der mich angerufen hatte.
„Alexander Richardson.“ Er streckte mir sogar eine Hand entgegen. Wie ein normaler Mensch mit Manieren und nicht wie der Affe, den er bisher gespielt hatte.
Nach kurzem Zögern schlug ich ein.
„Und du bist Amy Lynne Stuart, die stolze Besitzerin dieser Bar“, meinte er, wobei sich seine Züge sichtbar anspannten. Er fand das eindeutig nicht gut, was ich ihm nicht verübeln konnte. Ich fand es ja selbst nicht besser. Er kannte mich nicht und sorgte sich bestimmt um seinen Job.
„Nur Lynne, und mach dir deswegen keinen Kopf. Ich werde dich nicht gleich feuern.“ Immerhin brauchte ich jemanden, der die Bar für mich schmiss. Auch wenn ich wusste, dass ich mich ganz schön weit aus dem Fenster lehnte, ihm einfach zu vertrauen. Ich hatte keine Ahnung, ob er verlässlich war oder mich vielleicht heimlich über den Tisch zog. Aber jemand Neues einstellen zu müssen oder gar selbst jeden Abend hinter der Theke zu stehen, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Sein Blick verfinsterte sich. „Wie großzügig von dir, Lynne“, entgegnete er gepresst.
Okay, das war jetzt vielleicht doch irgendwie falsch rübergekommen. Verdammt! „Ich …“, setzte ich an.
Er unterbrach mich. „Schon gut. Wir kennen uns nicht. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen.“ Wow. Ja, genau. So viel Einfühlungsvermögen und gesunden Menschenverstand hätte ich ihm nicht zugetraut. Gleichzeitig traf mich die kühle Geschäftsmäßigkeit, mit der er das sagte. Warum, wusste ich selbst nicht so richtig.
Das war mein Zuhause. Ich kannte alles hier drinnen, da sich auf den ersten Blick nichts verändert hatte. Trotzdem fühlte ich mich plötzlich so fremd, so fehl am Platz und verloren, dass mir ganz anders wurde.
„Die Fahrt war lang. Ich werde dann mal raufgehen. Wir sehen uns morgen?“, fragte ich und bemühte mich, offen und freundlich zu klingen.
Lex nickte steif und griff wieder nach einem Glas und dem Poliertuch.
Ich drückte mich an ihm vorbei zum anderen Ende der Bar und verließ sie durch die Hintertür, wo mein Ford auf mich wartete.
Nun merkte ich, wie müde ich war.
Ich schnappte mir meine Reisetasche und den Laptop, versicherte mich, dass der Wagen wieder abgeschlossen war, und stieg die abgewetzten Stufen ins Obergeschoss hinauf.
Dort angekommen, überlegte ich kurz, ob ich die zweite, leer stehende Wohnung nehmen sollte, statt die Räume zu beziehen, in denen ich aufgewachsen war. Aber da drin erwarteten mich sicherlich eine dicke Staubschicht und jede Menge Spinnweben. Dann doch lieber Mums Chaos.
Mit leichter Beklemmung griff ich nach der Türklinke und stellte überrascht fest, dass abgeschlossen war. Unter der abgetretenen Türmatte fand ich den Ersatzschlüssel, der dort bestimmt schon lag, seit ich ein kleines Mädchen gewesen war. Meine Mutter war beim Heimkommen meistens nicht in der Lage gewesen, gerade zu gehen, geschweige denn, an einen Schlüssel zu denken, und hatte daher auf das Abschließen ganz verzichtet. Warum also gerade jetzt abgeschlossen war, verstand ich nicht recht, aber ich hatte andere Sorgen.
Ich drückte die Tür hinter mir zu, die sich mit einem leisen Klicken schloss, und lehnte mich dagegen. Das Licht der Straßenlaternen drang durch die schmutzigen Fenster und beleuchtete das Wohnzimmer vor mir nur spärlich. Von unten war gedämpfte Musik aus der Bar zu hören.
Ich tastete nach dem Lichtschalter und stellte fest, dass bloß eine der ursprünglich drei Glühbirnen in der Deckenlampe funktionierte.
Trotzdem entging mir nicht, wie ungewohnt aufgeräumt es war. Es lagen keine Klamotten auf dem Boden oder leere Getränkedosen auf dem Tisch. Auf der kleinen Kücheninsel zu meiner Rechten türmten sich keine Geschirrberge. Erleichtert und befremdet gleichzeitig legte ich das Gepäck auf die Couch und schlurfte ins Bad.
Bevor ich mich auszog, drehte ich das Wasser in der Dusche auf, damit es in der Zwischenzeit warmlaufen konnte.
Als ich mir schließlich frisch geduscht meine Schlafshorts und das All You Need Is Linux-Top überzog, war ich hundemüde.
Erstaunt stellte ich fest, dass sogar das Bett in meinem alten Zimmer frisch bezogen war. Mein Blick schweifte durch den schuhkartongroßen Raum, und ich gab mich den Erinnerungen hin, die unweigerlich in mir aufstiegen. Hier hatte ich von einem anderen Leben, einer freien und unbeschwerten Zukunft ohne meine immerzu betrunkene Mutter geträumt.
Und jetzt war ich zurück. Ohne Mum.
Ich ließ mich aufs Bett fallen und starrte hinauf zur Decke, die ich irgendwann mit mathematischen Formeln vollgekritzelt hatte.
Eine Stunde später wälzte ich mich noch immer herum. Obwohl ich echt erledigt war, wollte sich der Schlaf einfach nicht einstellen.
Ich hätte diese verdammte Coke nicht trinken sollen. Das Koffein, gepaart mit meinem unruhigen Geist, machte es mir unmöglich einzuschlafen.
Aus der Reisetasche holte ich mir eines meiner Bücher, das nicht mehr in den Karton gepasst hatte, und lehnte mich auf dem Bett mit dem Rücken an die Wand.
Ein Geräusch ließ mich hochschrecken.
Was war das? Mit pochendem Herzen lauschte ich in die Dunkelheit. Schwere Schritte waren von der Treppe zu hören. Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken.
Ich hatte nicht einmal gemerkt, dass ich aufgesprungen war und nach dem Baseballschläger gegriffen hatte, der zwischen Schreibtisch und Kleiderschrank an der Wand lehnte.
Auf Zehenspitzen huschte ich durchs Apartment. Das Blut rauschte mir in den Ohren und übertönte das leise Knarzen der Dielen unter meinen nackten Füßen.
Jemand hustete draußen auf dem Flur. Direkt vor meiner Wohnungstür.
Ohne nachzudenken riss ich sie auf und stürzte mich mit einem Kampfschrei auf den Eindringling.
Ich traf seinen Kopf, und er ging in die Knie, aber ausgeknockt hatte ich ihn nicht.
Er fluchte lauthals und hob schützend die Arme über den Kopf. „Was, zum Teufel? Lynne, hör auf!“, schrie er.
Es war Lex! Mir klappte der Mund auf, und ich ließ den Baseballschläger fallen. Er polterte auf den Boden und rollte davon.
„Scheiße!“, keuchte er und drückte sich die Hand gegen die Stirn. „Wolltest du mich umbringen?“
„Nein! Ich dachte, du wärst irgendein Betrunkener oder ein Einbrecher“, stieß ich atemlos hervor und kniete mich neben ihn. Ich hatte ihn ganz schön erwischt, wie ich beklommen feststellen musste. Blut rann ihm über die Wange, und unter seiner Hand schauten die Ränder einer Platzwunde hervor.
Lex grummelte etwas Unverständliches und machte Anstalten aufzustehen, strauchelte aber und musste sich an der Wand abstützen.
Ich wollte ihn fragen, was, verdammt noch mal, er hier machte, allerdings wirkte er derartig angeschlagen, dass ich die Frage herunterschluckte. Stattdessen schnappte ich mir seinen Arm und legte ihn über meine Schulter. Mann, war der schwer!
„Komm.“ Ich hatte vor, ihn in mein Apartment zu ziehen, aber er hielt dagegen.
„Nicht da rein. Ich habe Verbandszeug in meiner Wohnung“, sagte er schwach und dirigierte mich weiter.
In seiner Wohnung? O heilige Scheiße! Er wohnte hier? Mum hatte ihn ernsthaft bei sich einziehen lassen?
Wir wankten durch die Tür und weiter ins Bad, wo er sich an der Wand nach unten sinken ließ.
„Dort.“ Lex deutete auf den kleinen Spiegelschrank über dem Waschbecken. Ich öffnete ihn und holte Desinfektionsmittel und einige Kompressen heraus.
Der war aber gut ausgestattet!
Neben ihm kniend, drehte ich sein Gesicht ins Licht und begann damit, die Wunde abzutupfen.
Er sog scharf die Luft ein, rührte sich aber kein Stück. Glücklicherweise war die Schramme weniger schlimm, als ich zuerst angenommen hatte, und blutete nicht mehr.
Mehrmals musste ich ihm ein paar widerspenstige Haarsträhnen aus der Stirn streichen, die sich unglaublich weich zwischen meinen Fingern anfühlten. Unwillkürlich stellte ich mir vor, wie es wäre, mit der Hand durch sein Haar zu fahren.
„Baseball, was? Ich hätte bei dir eher auf Yoga getippt“, murmelte er.
Ich lachte auf, und unsere Blicke trafen sich.
„Entschuldige, dass ich dich angegriffen habe“, meinte ich verlegen.
Lex zuckte mit den Schultern. „Ich schätze, ich bin selbst schuld. Du konntest ja nicht wissen, dass ich hier wohne, und ich bin froh zu wissen, dass du bestens ausgerüstet bist, wenn uns mal ein Einbrecher überrascht.“ Er grinste schwach.
Ich legte einen sauberen Tupfer auf die gereinigte Wunde und klebte sie notdürftig mit Pflastern ab. „So, das müsste gehen. Wie fühlst du dich?“, fragte ich und stand auf.
„Erschlagen“, antwortete er und lächelte wieder. Ich konnte nicht verhindern, dass sich auch meine Mundwinkel nach oben zogen.
Er ignorierte meine ausgestreckte Hand, rappelte sich hoch und betrachtete mein Werk im Spiegel.
„Also, Krankenschwester bist du schon mal nicht.“
„Ich bin Informatikerin. Programmiererin, um genau zu sein“, teilte ich ihm mit und straffte die Schultern.
„Soso.“ Lex ging durchs Wohnzimmer zur Kochnische und goss sich ein Glas Wasser ein.
„Also, ich werde dann mal“, setzte ich an und wandte mich zur Tür.
„Lynne.“ Seine Stimme ließ mich innehalten.
„Ja?“
„Danke.“
„Dafür, dass ich dich niedergeschlagen habe?“, feixte ich.
Doch Lex sah mich ernst aus seinen karamellfarbenen Augen an. „Dafür, dass du mich nicht blutend liegen gelassen hast“, meinte er und lächelte erneut. „Und dafür, dass du hergekommen bist.“ Nun war der Schalk aus seinem Gesicht verschwunden.
„Schon gut“, presste ich hervor und machte mich davon.
„Guten Morgen, Sonnenschein.“
Hä?
„Lass mich in Ruhe“, murmelte ich in mein Kissen und dämmerte wieder weg.
Eine große, warme Hand berührte mich an der Schulter und rüttelte sanft an mir.
Was …? Ich fuhr hoch.
„Scheiße! Was tust du hier?“, wollte ich wissen. Hatte ich denn die Tür nicht abgesperrt?
„Ich hab dir Kaffee gemacht“, meinte Lex schmunzelnd. „Du bekommst ihn aber nur, wenn du jetzt brav aufstehst.“ Boah, war der fies.
Ich warf ihm einen bösen Blick zu, stand auf und schlurfte ins Bad. „O Gott“, stöhnte ich, als ich mein Spiegelbild erblickte. Ich hatte einen Abdruck vom Kissen an der Wange, und meine Haare sahen aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Kein ungewöhnlicher Anblick für mich kurz nach dem Aufstehen, aber normalerweise bekam das niemand mit.
So schnell es mir in meinem schlaftrunkenen Zustand möglich war, ging ich zur Toilette und putzte mir die Zähne. Wie spät war es überhaupt, und was wollte Lex?
Leise vor mich hin grummelnd, lief ich ins Wohnzimmer, schnappte mir die Tasse vom Tisch und hockte mich Lex gegenüber auf den Futonsessel. Die Beine untergeschlagen, nippte ich vorsichtig an dem Gebräu.
Es war richtig guter Kaffee.
„Ich wusste nicht, wie du ihn magst“, sagte Lex.
„Was?“ Ich war eindeutig nicht munter genug für Konversation. Schnell nahm ich einen weiteren Schluck.
„Deinen Kaffee“, erklärte er mir.
„Gut so“, murmelte ich. Schwarz wie meine Seele.
Er nickte bedächtig.
„Wie geht’s deinem Kopf?“, fragte ich nach einer Weile.
„Der wird wieder. Ist dicker, als man glauben möchte“, gab er zurück. Das konnte ich mir vorstellen.
„Was verschafft mir die Ehre deines frühmorgendlichen Besuchs?“
Er lachte. „Es ist zwei Uhr nachmittags.“
Okay. Ich zuckte mit den Schultern.
„Wir müssen zum Notar, der die Erbschaftsangelegenheiten deiner Mutter regelt“, erklärte er und wirkte mit einem Mal angespannt.
Mein Magen krampfte sich zusammen, aber ich zwang mich dazu, einmal zu nicken.
Lex stand auf und umrundete den Couchtisch.
„Zieh dich an und komm nach unten, wenn du fertig bist“, bat er und betrachtete meine nackten Beine.
Reflexartig zog ich ein Kissen auf meinen Schoß, doch er hatte sich bereits umgedreht und ging.
Jawohl, Sir, dachte ich genervt und trank noch einen Schluck Kaffee.
Lex
Ich hatte eigentlich keine richtige Vorstellung von Marians Tochter gehabt. Das wäre ohnehin zwecklos gewesen, denn diese Frau hatte meine Vorstellungskraft definitiv übertroffen.
Sie war eine Nummer für sich.
Frech und aufmüpfig – obwohl ich das Gefühl hatte, dass sie sich hier mehr als unbehaglich fühlte – und dabei so nerdig, wie man nur sein konnte. Fehlte bloß eine dickrandige Lesebrille und dass sie Star-Wars-Fan war.
Unter der zickigen Fassade und ihrer gelegentlichen Unbeholfenheit schlummerte aber offenbar eine Kriegerprinzessin. Mir war nie zuvor eine Frau begegnet, die sich mit einem Baseballschläger bewaffnet auf einen vermeintlichen Einbrecher stürzte. Ganz schön mutig, das musste ich ihr lassen.
Ach ja, und ihre Beine und der Po waren auch sehenswert, Vogelnestfrisur hin oder her.
Ich stellte die letzten leeren Flaschen unter den Tresen, und als ich aufsah, stand Lynne vor mir. Sie trug Chucks, eine schwarze Röhrenjeans und dazu ein schulterfreies Top mit dem Aufdruck Systemfehler.
„Können wir?“, fragte sie und nickte auffordernd in Richtung Tür. Dabei wirkte sie keineswegs, als wäre sie sonderlich erpicht auf diesen kleinen Ausflug mit mir.
Ich nickte, ging voran zur Tür und hielt sie ihr auf. Jede andere Frau hätte sich über diese höfliche Geste gefreut. Doch Lynne verdrehte die Augen und sagte nicht einmal Danke. Okay. Das würde schwerer werden, als ich gedacht hatte.
Normalerweise hatte ich keine Probleme damit, das weibliche Geschlecht um den Finger zu wickeln, aber an Lynne biss ich mir die Zähne aus. Zumindest im Moment.
Ich sperrte die Bar ab und deutete auf mein Motorrad, eine mitternachtsblaue Victory Vegas.
„Da steig ich auf keinen Fall drauf“, sagte sie sofort.
Ich zählte im Kopf bis drei und atmete tief durch. „Und warum nicht, wenn ich fragen darf?“ Ich war echt stolz auf mich, weil meine Stimme nichts von der aufkeimenden Ungeduld in mir verriet.
Sie zögerte und sah mich an.
„Angst?“ Betont spöttisch grinste ich ihr ins Gesicht. Jackpot! Ich konnte zusehen, wie sich ihre Miene veränderte. Von skeptisch zu entschlossen. Sie schlug wirklich keine Herausforderung aus.
„Na schön, wenn’s unbedingt sein muss“, meinte sie und streckte den Rücken durch.
„Gut.“
„Warte“, rief sie, als ich gerade ein Bein über die Maschine schwingen wollte. Was denn noch? Ich warf ihr einen fragenden und, wie ich hoffte, nicht allzu genervten Blick über die Schulter zu.
Sie wiederum blickte mich an, als würde sie vor einem Idioten stehen. Autsch. Ich hatte echt noch nie jemanden kennengelernt, der dermaßen ausdrucksstark war.
„Helme? Ohne Helm fahr ich nicht mit.“ Lynne verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust. Himmel!
Ich erwiderte nichts, weil ich stark vermutete, dass es ohnehin sinnlos gewesen wäre, mit ihr darüber zu debattieren, und ging zur Hintertür.
Mit zwei Helmen, einem unter jedem Arm, kam ich zurück und reichte ihr einen. Ich hatte die Dinger beim Kauf der Victory dazubekommen, allerdings nie Verwendung dafür gehabt.
„Danke“, sagte Lynne steif und wollte sich den Helm überziehen, kam aber nicht weit. Der Haarknoten an ihrem Hinterkopf war im Weg. Grummelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht entwirrte sie das Haargummi aus ihren Locken und fächerte sie über ihren nackten Schultern auf. Wow. Sie waren etwas durcheinander, und trotzdem hatte ihre weiche hellbraune Mähne etwas Sinnliches an sich.
„Warum schneidest du sie nicht einfach ab?“, hörte ich mich fragen und verfluchte mein loses Mundwerk im selben Moment.
Lynne hielt mit dem Helm über ihrem Kopf inne. „Es geht dich zwar rein gar nichts an, was ich mit meinen Haaren mache“, begann sie.
„Aber?“, hakte ich nach, als sie nicht weitersprach.
„Wenn ich sie kurz trage, sehe ich aus wie Brian May“, gestand sie und verzog das Gesicht.
Ich musste lachen und wurde dafür mit einer rausgestreckten Zunge belohnt. Also, also, Miss Stuart.
Lynne schob sich den Helm über den Kopf und nestelte am Kinnverschluss herum.
„Lass mich mal“, meinte ich und griff danach. Sie zuckte zurück und funkelte mich durch das Visier hindurch böse an.
„Hey, ich wollte dir nur helfen“, sagte ich und hob abwehrend die Hände. Lynne murmelte etwas in ihren Helm, das ich nicht verstand. „Was?“
Sie zögerte einen Herzschlag lang und klappte das Visier hoch. „Ich bin fürchterlich kitzelig“, grummelte sie und schaffte es endlich, selbst die Schnalle zu schließen.
Gut zu wissen, dachte ich bei mir, setzte meinen eigenen Helm auf und schwang mich aufs Motorrad. Ich sah herausfordernd zu Lynne. Sie war ein gutes Stück kleiner als ich, deshalb kippte ich die Victory etwas zur Seite, damit sie hinter mir aufsteigen konnte.
„Halt dich fest“, rief ich über das Startgeräusch des Motors hinweg. Sie tat nichts dergleichen. Ein Blick über die Schulter verriet mir, dass sie die Maschine nach Griffen oder Ähnlichem absuchte. Ich musste lachen. „An mir!“
Lynne starrte mich finster an, schlang aber gehorsam die Arme um meinen Bauch. Als ich anfuhr, verstärkte sich ihr Griff, und ich meinte, sie quietschen zu hören.
Auf dem Weg in die Stadt hinein vergaß ich einen Moment meine Sorgen. Das geschah immer, wenn ich auf meiner Maschine über den Asphalt glitt und der Wind an meinen Kleidern riss. Es befreite mich.
Bisher hatte ich nie jemanden mitgenommen, es war ungewohnt für mich. Nicht nur weil sich dadurch die Fahreigenschaften des Motorrads veränderten, sondern weil es einer gewissen körperlichen Nähe bedurfte, die ich in dieser Weise nie zuvor erlebt hatte.
Wenn mich eine Frau berührte, dann, wenn ich Sex mit ihr hatte, und sonst nicht. Keine Küsse außerhalb des Betts oder wo auch immer wir uns vergnügten. Keine Zärtlichkeiten oder irgendein anderer Quatsch. Diese Dinge führten bloß dazu, dass sich meine Bettgespielinnen im Nachhinein mehr erhofften, als ich ihnen zu geben bereit war. Abgesehen davon gab es mir nichts.
Das hier aber, mit Marians durchgeknallter Tochter, war irgendwie … angenehm. Oder zumindest nicht unangenehm.
Eine Viertelstunde später hielt ich vor Jenkins’ Kanzlei und stellte den Motor ab. Lynne rutschte vom Sattel und machte einen stolpernden Schritt zur Seite. Sie schaffte es, die Schnalle zu lösen, und zog sich den Helm vom Kopf. Zerzaust, aber sichtlich begeistert schaute sie mich an. Ihre Augen strahlten regelrecht. Sie waren das Einzige in ihrem Gesicht, das sie eindeutig nicht von Marian geerbte hatte.
Meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das ich bis in die Zehenspitzen spüren konnte. Ihre Freude und Begeisterung steckten mich an.
„Na komm, du Bikerbraut“, neckte ich sie und ging voraus.
Lynne stieß verächtlich Luft durch die Nase, grinste aber weiter – bis wir ins Büro des Notars traten.
Lynne
Schlagartig verflog die Leichtigkeit, die ich während meiner ersten Motorradfahrt gespürt hatte. Ich begann zu zittern, und die Gedanken, die ich bis jetzt, so gut es ging, unterdrückt hatte, prasselten auf mich ein wie ein Platzregen.
„Lex, warte!“ Ich packte ihn am Arm und zog ihn ein Stück zurück. Gerade war mir etwas klar geworden, und ich verfluchte mich innerlich. Warum hatte ich ihn nicht gleich gefragt? Warum hatte er es mir nicht von sich aus erzählt? Ich war dermaßen dumm!
„Was hast du, Lynne?“, fragte er mit besorgter Stimme. Besorgnis. Eine ganz neue Seite von Lex. Ich presste die Lippen zusammen und atmete hörbar aus.
„Wie …?“ Ich stockte. „Wie ist sie denn genau gestorben?“, brachte ich mühsam hervor und lehnte mich an die kühle Steinmauer in meinem Rücken.
Ein Schatten huschte über Lex’ Gesicht, und er biss die Zähne zusammen. Sein Kiefer mahlte. Er tat ja gerade so, als wäre der Tod meiner Mutter eine Tragödie für ihn. Sie war doch nur seine Chefin gewesen. Oder war da etwa mehr zwischen ihnen gelaufen? Nein! Bitte lass meine Fantasie kranker sein als die Realität!
„Sie hatte einen Herzinfarkt. In ihrer Wohnung. In ihrem Bett. Sie ist im Schlaf gestorben, Lynne. Der Arzt meinte, sie hat es höchstwahrscheinlich nicht einmal mitbekommen. Der schönste Tod, den man sich wünschen kann“, sagte er mit ungewohnt sanfter Stimme.
Ich schluckte schwer und nickte mechanisch. „Sie hat dir viel bedeutet, oder?“ Die Worte waren heraus, bevor ich sie hatte aufhalten können.
Lex’ Reaktion überraschte mich. Er sah traurig aus. Richtig traurig.
Trotzdem lächelte er. „Sie hat mich unter ihre Fittiche genommen. Mir geholfen, als ich eine schwere Zeit durchgemacht habe. Ja, Lynne, deine Mutter hat mir viel bedeutet.“ Er kratze sich verlegen am Hinterkopf, ganz, als bereute er, mir das verraten zu haben.
Es traf mich, dass er sie auf diese Weise erlebt hatte und ich nicht. Dass sie anscheinend für ihn da gewesen war, aber niemals für mich.
„Lass uns jetzt reingehen“, sagte ich mit belegter Stimme und wandte mich zur Tür.
Lex folgte mir in Jenkins’ Büro, wo wir vor seinem Schreibtisch Platz nahmen.
„Miss Stuart, wie schön, dass Sie hergekommen sind“, begrüßte Jenkins mich.
Ja, sehr schön. Es musste nur meine Mutter sterben, damit wir uns kennenlernen durften. Ich nickte bloß, um nicht wieder mit etwas herauszuplatzen, das besser ungesagt blieb.
„Hier sind die Urkunde für das Haus, die Betriebsgenehmigung für die Bar und eine beglaubigte Kopie der Bleiberechtsurkunde von Mister Richardson“, erklärte Jenkins und legte ein Blatt nach dem anderen vor mir auf den Tisch.
Bleiberechtsurkunde? „Was hat es mit dieser Bleiberechtssache auf sich?“, wollte ich wissen und schielte zu Lex hinüber. Er musterte mich, scheinbar ruhig, abwartend. Allerdings entging mir nicht, wie angespannt seine Haltung war.
Jenkins räusperte sich. „Ihre Mutter hat Mister Richardson eingeräumt, auch nach ihrem Tod die Wohnung weiterhin behalten zu dürfen. Sie war vor ungefähr drei Jahren deshalb bei mir“, teilte er uns mit.
Vor drei Jahren? Ich konnte gar nicht fassen, dass sich meine Mutter überhaupt Gedanken über ihren Tod gemacht hatte, geschweige denn, dass ihre Fürsorge für ihren Mitarbeiter so weit gegangen war.
Lex neben mir war offenbar ebenso überrascht darüber wie ich. Er atmete hörbar ein, blieb jedoch stumm.
Jenkins schenkte unseren Gefühlsregungen keinerlei Beachtung. „Dann benötige ich bitte noch ein paar Unterschriften von Ihnen.“ Er legte ein weiteres Blatt vor mir auf den Tisch. „Hier, hier und hier“, meinte er und deutete auf die entsprechenden Stellen im Text.
Ohne einen Buchstaben des Dokuments zu lesen, unterzeichnete ich. Ich hätte genauso gut einen Pakt mit dem Teufel schließen können, es war mir egal.
Die allumfassende Leere, die ich in den letzten Jahren mit meiner Arbeit und dem Studium gefüllt hatte, nahm mich wieder in Besitz und hinderte mich daran, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen.
„Sind wir fertig?“, fragte ich schnell. Ich wollte raus hier. Aus diesem Büro. Aus der Stadt und am liebsten aus diesem Leben, in dem ich durch Mums Tod gelandet war.
Jenkins verabschiedete uns. Ich steckte die Papiere in das Kuvert, das er mir dankenswerterweise gegeben hatte, und klemmte es hinten in den Bund meiner Hose.
Lex voraus lief ich zu seinem Motorrad, schnappte mir den Helm und zog ihn über. Tränen brannten in meinen Augen. Das Letzte, was ich jetzt wollte, war, dass er sie sah.
Lex schwieg die ganze Heimfahrt über. Hing vermutlich ebenfalls seinen Gedanken nach.
Zu Hause angekommen, sprang ich gleich ab, ging zur Hintertür und hinauf in mein Apartment. Ich blieb erst stehen, als ich mit den Schienbeinen an Mums Bett stieß. Es war gemacht. Kissen und Decke aufgeschüttelt und hübsch drapiert. Mit einer energischen Bewegung krallte ich die Finger in die Decke und zerrte sie von der Matratze. Anschließend nahm ich mir das Kissen vor, schleuderte es gegen Mums Frisiertisch und fegte damit ein paar der Fläschchen und Dosen von der Kommode.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich atmete und atmete, trotzdem gelangte irgendwie nicht genügend Sauerstoff in meine Lungen.
Stolpernd hastete ich zum Fenster und riss es auf. Das half ebenso wenig.
Hinter mir hörte ich ein Poltern, achtete aber nicht darauf. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen. Schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen, und meine Knie gaben nach. Ich kippte zur Seite, rechnete damit, auf den Dielen aufzuschlagen, aber es kam anders.
Starke Arme umfingen mich, bremsten meinen Sturz ab, und im nächsten Moment saß ich auf Lex’ Schoß.
Er redete beruhigend auf mich ein, das Rauschen in meinen Kopf machte es mir allerdings unmöglich, etwas davon verstehen zu können. Mein Blickfeld flimmerte, trotzdem nahm ich wahr, wie Lex mich behutsam absetzte, aufsprang und hektisch in einer Küchenschublade kramte. Rasch kehrte er zu mir zurück und hielt mir eine Brottüte vor den Mund. Offenbar sah ich aus, als würde ich mich jeden Moment übergeben müssen. Was gar nicht so abwegig war.
Auf das Schlimmste gefasst, atmete ich in die Papiertüte, die Lex mir verbissen entgegenhielt. Es musste lustig aussehen, wie wir dasaßen. Er auf dem Boden, ich neben ihm, mit der Tüte an meinen Lippen, die sich bei jedem meiner Atemzüge einem Luftballon gleich aufblies.
Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, aber irgendwann konnte ich wieder normal atmen, und Lex nahm mir die Papiertüte vom Gesicht.
„Geht’s wieder?“, fragte er leise. Seine Hand streichelte sanft über meinen Rücken.
Es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich antworten konnte. Lex drängte mich nicht. Wartete und streichelte mir weiter den Rücken. Es fühlte sich gut an. Ich glaubte, mich nie zuvor derart geborgen und verstanden gefühlt zu haben.
„Noch ein erstes Mal mit dir“, flüsterte ich.
Er neigte den Kopf, um mir direkt in die Augen sehen zu können, und war mir auf einmal so nah, dass sein Atem über meine Wange strich. „Was meinst du?“
Das war zu viel. Zu viel Nähe und zu viel Kribbeln in meinem Bauch. Ich rückte von ihm ab und setzte mich ihm gegenüber auf den Boden, den Rücken an die Kommode gelehnt.
„Na ja, vorher bin ich zum ersten Mal auf einem Motorrad mitgefahren, und das gerade war wohl meine erste Panikattacke“, erklärte ich und war selbst verwundert, dass sich meine Lippen zu einem schiefen Lächeln verzogen. Offenbar hatte ich durch den Sauerstoffengpass ein paar Gehirnzellen eingebüßt.
Lex erwiderte nichts. Sah mich nur an. Dann stand er auf, und ich dachte schon, er würde mich sitzen lassen, einen Augenblick später war er jedoch wieder da. Er reichte mir eine Cokeflasche und setzte sich mit seiner eigenen in der Hand wieder auf den Boden.
„Auf erste Male“, meinte er und prostete mir mit seiner Flasche zu.
Wir tranken ein paar Schlucke.
„Hast du hier aufgeräumt?“, wollte ich wissen. Eigentlich konnte ich es mir denken, dabei interessierte mich vor allem der Grund dafür.
„Ja. Marian hatte es nicht so mit Hausarbeit“, sagte er, ohne mich anzusehen.
Ich lachte trocken. „Wem sagst du das?“
Wieder nippten wir schweigend an unseren Cokes.
„Danke, dass du dich um alles gekümmert hast, Lex.“
„Es tut mir leid, dass ich dir nicht eher Bescheid geben konnte. Ich wusste bis gestern nichts von dir.“
Meine Mutter hatte mich also nie erwähnt. Wie schön.
„Willst du zu ihrem Grab?“, fragte Lex vorsichtig.
Auf gar keinen Fall! Ich schüttelte vehement den Kopf. „Ich glaube, die eine Panikattacke reicht mir für heute“, erwiderte ich.
„Das war ganz schön gruselig“, neckte er mich.
„Und es macht hungrig“, gab ich gespielt beleidigt zurück.
„Pizza?“
„Unbedingt.“