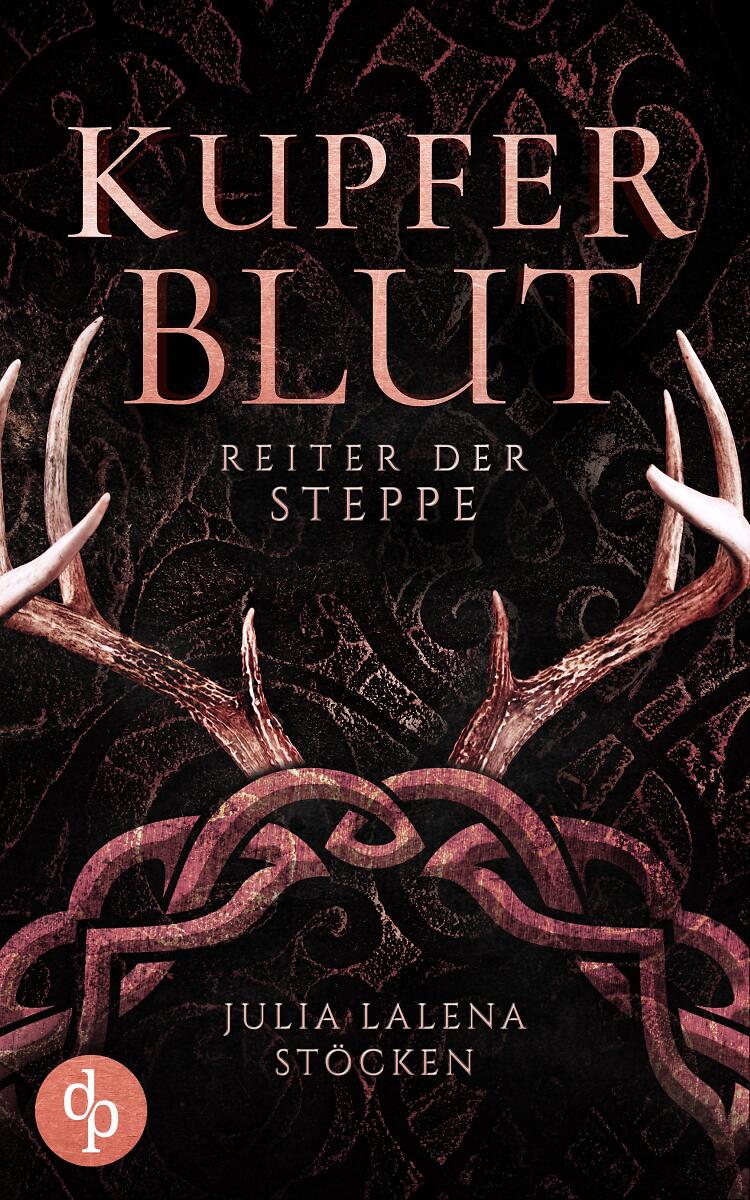Prolog
Der kalte Lufthauch, der aus der Höhle wehte, brachte die Flamme der Fackel zum Tanzen. Wilde Schatten zuckten über den rauen, mit gelben Flechten überzogenen Fels.
Erregung rann wie ein einzelner kühler Regentropfen über den schlanken Rücken des Jungen. Augenblicklich stellten sich die feinen Haare in seinem Nacken auf. Die Nacht griff mit schwarzen Klauen nach ihm, aber der Feuerschein bewahrte ihn davor, von ihr gepackt und verschluckt zu werden. Er machte einen Schritt vorwärts und das Laub raschelte unter seinen Füßen, dann stand er wieder still. Es waren nicht die nächtlichen Geräusche des Waldes wie der schauerliche Schrei einer Eule oder das Knacken im Unterholz, die ihn erzittern ließen. Ehrfurcht durchströmte seine Adern. Vor ihm lag Jelens Höhle.
Der Junge war allein. Und er zauderte. Es war das erste Mal, dass er den heiligen Ort des S teppenreitervolks von selbst aufsuchte. Er wusste, dass sein Vater ihn nach seiner Geburt hergebracht hatte, um dem Hirschgott für den gesunden Sohn zu danken und ihm ein Opfer darzubringen. Dieses Ereignis jährte sich in diesem Sommer zum zwölften Mal. Inzwischen war er alt genug, um Jelens Höhle erneut zu betreten. Er hatte alles dafür getan, was notwendig war, damit ihm dieses Privileg zuteilwurde.
Jetzt stand der Junge wie angewurzelt davor und traute sich nicht, hineinzugehen. Er straffte die Schultern, streckte den Arm aus und leuchtete in den Höhleneingang, dann stieg er über eine Felsstufe ins Innere.
Drinnen schlug ihm die Mischung aus feuchtkaltem Muff der unterirdischen Welt und menschlichem Schweiß entgegen, die von dem Höhlenwind hinaufgetragen wurde. Die Männer warteten bereits auf ihn.
Der Junge beschleunigte seine Schritte, die dumpf von den Steinwänden des Tunnels widerhallten und ihn immer tiefer in den Felskamm hineinführten, der inmitten hoher Buchen aus dem Boden ragte. Er lauschte. Teile eines Gesprächs drangen an seine Ohren, aber die weitentfernten Stimmen wurden von den Felsen zerrissen, sodass ihn nur Fetzen erreichten. Der Junge folgte seinem Gehör, achtete für einen kurzen Augenblick nicht auf den Weg und stolperte über einen Stein. Er stürzte und ließ die Fackel fallen, um sich abzustützen, trotzdem schlug er sich das linke Knie auf. Die Fackel rollte über den abschüssigen Boden und blieb an der Felswand liegen. Der Junge biss die Zähne zusammen und rappelte sich wieder auf. Er ging hinüber und wollte sie eben aufheben, als sein Blick auf ein Bild an der Wand fiel.
Hartgeführte, dunkle Striche von der Dicke eines Zeigefingers fügten sich zu einer Gestalt zusammen. Im ersten Moment hielt es der Junge für einen Menschen, dann bemerkte er, dass das Wesen an der Wand zwar aufrecht stand, aber dass aus dem mit wilden Linien gezeichneten Kopfhaar ein schwarzes, weitverzweigtes Geweih und spitze Ohren erwuchsen. Der Rumpf schloss mit einem geschwungenen Tierschwanz ab. Das Gesicht war leer, während der Körper mit rotbrauner Farbe ausgemalt worden war. Es zeigte Jelen, den Hirschgott, das Totem des Steppenreitervolks, seit es aus den Weiten der kargen Tundra im Nordosten gekommen war, um eine gastlichere Heimat in der Ebene zu finden.
Der Junge streckte die Hand aus, um die markante Rückenlinie des Gottes nachzuziehen. Just als seine Fingerkuppen den kalten Fels berührten, zuckte ein Gedanke hell wie ein Blitz durch seinen Schädel. Gestern hatte er im dichten Unterholz des Waldes einen Hirsch gestellt, einen erstaunlich großen Bullen. Gewöhnlich nahmen die scheuen Tiere Reißaus oder verharrten reglos, um mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, sobald sie einen Menschen gewahrten. Und der nur mit einem Lendenschurz bekleidete Junge war tatsächlich eine Gefahr, denn er war mit einer Handvoll Pfeilen und einem Bogen aus Eschenholz bewaffnet. Doch der Hirsch zeigte keine Furcht, wandte ihm den Kopf zu und starrte ihn aus dunklen Augen an. Der Junge war wie paralysiert – und senkte den Bogen. Eine Weile hatten sie sich still angesehen, dann hatte sich der große, muskulöse Hirschbulle umgedreht und war mit stolzen Schritten im Dickicht verschwunden.
Jetzt legte der Junge den Kopf schief. „Ob er es war?“
Wieder spülte der Höhlenwind Stimmen aus der Tiefe nach oben und holte ihn aus seiner Versunkenheit. Er bückte sich, sammelte die Fackel auf und eilte weiter durch den Tunnel.
Endlich erreichte er das Ende des Ganges, der in eine breite, flache Höhle mündete. Die Decke war gerade hoch genug, dass die Männer darin nicht den Kopf einziehen mussten. Es waren mehr als zwei Handvoll und sie bildeten einen Halbkreis vor dem Jungen. Alle waren in traditionelle Kleidung gehüllt, die aus einem Lendenschurz, Beinlingen und Stiefeln bestand und mit Perlen, Federn und Zähnen bestickt war. Klimpernde Knochenketten lagen um ihre Hälse. Einige trugen Fackeln, deren kupfernes Licht auf nackte, muskulöse Oberkörper fiel. Sie hatten lange, geflochtene Zöpfe aus hellem Haar und kurzgeschnittene Bärte.
Der Junge blieb im Eingang der Höhle stehen. Wieder breitete sich Gänsehaut auf seinem Körper aus, aber es lag nicht daran, dass auch er nur einen Lendenschurz und weiche Lederschuhe trug. Er fror nicht, im Gegenteil, die Aufregung wälzte das heiße Blut schneller durch seine Adern. Schweiß benetzte seine Handflächen. Im Fackellicht wirkten die grauen Tätowierungen, die Schultern und Brust aller Anwesenden bedeckten, schwarz. Nur einer trug keine Zeichen auf seinen schlanken Gliedern – er selbst.
„Komm her“, sagte der Schamane. Er hatte als einziger einen Umhang angelegt, gefertigt aus rotbraunem Hirschfell, der ihm weit über den hageren Rücken fiel. Die Kapuze, die mit runden Geweihscheiben verziert war, hatte er weit nach hinten über seinen grauen Haaransatz geschoben. Sein Gesicht war mit rotem Ocker bemalt, der im Feuerschein regelrecht glühte. Er lächelte und entblößte schlechte Zähne in einem dunklen Gaumen. „Komm.“
Der Junge trat in den Halbkreis der Jäger. Sein Blick fuhr über die ausdruckslosen Mienen der Männer. Einer, groß und bullig, mit mächtigen Muskeln an den Oberarmen, grinste ihn an. Daneben stand mit angespanntem Ausdruck Labi, sein Vater.
„Hat er alle Prüfungen bestanden?“, fragte er.
„Hat er alle Prüfungen bestanden? Hat er alle Prüfungen bestanden?“, wiederholten die Männer leiser.
Der Junge nickte.
Sein Vater blickte ihn streng an. „Dann soll er antworten.“
„Er hat jede Prüfung, die man ihm auferlegt hat, bestanden.“
Ein heller Funke blitzte in Labis Augen. „Welche waren das?“
„Er hat ein Pferd zugeritten.“
„Was noch?“
„Er hat einen Speer gefertigt.“
„Was noch?“
„Er hat mit diesem Speer gejagt.“
„Was hat er gejagt?“
„Ein Reh.“
„Was war die letzte Prüfung?“
„Er hat einen Mond allein in den Wäldern gelebt.“
Labi verengte seine Augen. „Dann hat er alle Prüfungen bestanden.“
„Er hat alle Prüfungen bestanden“, raunten die Jäger. „Er hat alle Prüfungen bestanden.“
„Schamane!“, rief Labi.
Der Mann mit der Kapuze schlurfte einen Schritt näher.
„Du hast die Geister angerufen?“
„Ja.“
„Was haben sie dir gesagt?“
„Sie haben gesagt, dass der Junge einen Namen haben soll.“
„Welchen Namen?“
„Er ist unter dem Hirschmond geboren“, sagte der Schamane. „Die Geister sagen, er hat eine besondere Verbindung zu Jelen.“ Er sah den Jungen durchdringend an. „Sein Name lautet Cuska – wie die Schlange, die Jelens Gefährtin ist.“
Die Männer brummten zustimmend. Labi trat vor und legte eine Hand auf die Schulter seines Sohnes. Seine Finger fühlten sich kühl auf der fiebrig heißen Haut des Jungen an, und er zuckte leicht unter der Berührung.
„Cuska.“ Labi nickte zufrieden, dann wandte er sich an den Schamanen: „Verleih ihm die Zeichen.“
„Ja“, antwortete der und bedeutete dem Jungen, ihm zu folgen. Er führte ihn zu der rechten Seite der Höhle, wo ein Fellteppich auf dem Boden lag, der Cuska zuvor nicht aufgefallen war. Trommelschläge erklangen und vibrierten in seiner Brust. Er warf einen Blick zurück zu den Jägern. Zwei hatten sich auf den nackten Felsboden gesetzt und schlugen rhythmisch auf kleine ziegenfellbespannte Trommeln, während ein dritter einer kleinen Knochenflöte schrille surrende Töne entlockte. Eine Handvoll Männer begann in der Mitte des Raums zu tanzen.
„Setz dich“, bedeutete ihm der Schamane freundlich.
Der Junge fuhr herum und ließ sich hastig mit überkreuzten Beinen neben dem Zauberer nieder. Die Musik brachte seinen Kopf zum Schwirren.
„Es wird wehtun. Hast du Angst?“ Der Mann nahm eine riesige knöcherne Nadel in die Hand. Sie hatte die Länge eines menschlichen Oberarms.
„Nein.“ Der Junge schüttelte den Kopf. „Ich vertraue dir.“
Der Schamane lächelte. „Sei vorsichtig, wem du dein Vertrauen schenkst. Du siehst nicht, wer sich hinter der Maske versteckt.“ Er zeigte mit der freien Hand auf sein rotbemaltes Gesicht.
„Dann soll ich mich vor dir fürchten?“
Der Zauberer beugte sich zu Cuskas Schulter vor und schob die Spitze der Nadel unter die weiche, empfindliche Haut.
Der Junge spannte seine Muskeln an. „Nein, aber es gibt auch böse Schamanen.“
1. Kapitel
Ein Jahr später
Der dumpfe Schlag, der von einer großen Faust herrührte, die auf den festgestampften Lehmfußboden niederfuhr, ließ das Mädchen zusammenfahren. Bojana sah von ihrer Näharbeit auf und hinüber zu ihrem Onkel, der auf der anderen Seite der großen Hütte in einem Kreis von Männern saß.
Winzige Staubfedern schwebten um seine Hand und glitzerten im Sonnenlicht, das wie eine schmale Säule durch den Rauchabzug fiel. Sein rötlichbrauner Bart leuchtete wie Feuer, die dunklen Augen wirkten ungewöhnlich hart. „Ich werde es nicht mehr dulden, dass sie unsere Herden überfallen und unsere Pferde stehlen!“, knurrte Ando, der Sippenführer des Graslandclans – und Bojanas Onkel. Die ernsten Gesichter der Ratsmitglieder waren ihm zugewandt, aber niemand sagte etwas.
Ando senkte seinen Blick auf die Glutreste in der Kochstelle vor sich, die dabei waren, unter einer dicken grauen Ascheschicht zu ersticken. Die schmutzigen Tontassen, aus denen die Männer zuvor frischgebrühten Tee getrunken hatten, stapelten sich neben ihm.
Draußen erfüllte der Duft von süßem Frühlingsgras die Luft, aber in der Hütte des Sippenführers roch es nach Schweiß. Es war stickig und warm, aber das lag nicht an der Sonne, die die Außenwände der runden Hütte aufheizte. Lehm besaß die Eigenschaft, die Wärme aufzunehmen, aber nicht weiterzugeben. Deswegen war es in den Behausungen des Graslandclans, die sich dicht an dicht in einer Talsenke der Ebene aneinanderschmiegten, im Sommer angenehm kühl und im Winter warm. Der Lehm war kostbar und nur am Rande der Steppentundra, die sich im Osten an die Ebene anschloss, in den ausgetrockneten Flussläufen zu finden. Die Männer hackten den Lehm heraus und beförderten ihn auf Stangenschleifen zurück zum Lager, wo er erst mit Getreidehalmen gemagert werden musste, bevor er zum Verputzen der Wände oder als Bodenbelag weiterverwendet werden konnte.
Die schlechte Luft rührte von den vielen Menschen in Andos Hütte, die über wichtige Dinge zu sprechen hatten.
Bojana verhielt sich ganz still. Sie hatte nie Schwierigkeiten mit ihrem Onkel gehabt, aber wenn seine Laune so war wie jetzt, dann zog man besser nicht seine Aufmerksamkeit auf sich. Bojana stach die Knochennadel in das feine, geschmeidige Ziegenleder, aus dem sie eine kleine Kappe für das Baby machen wollte, und zog die dünne Sehne hindurch. Ihre Augen waren an das fahle Licht der Hütte gewöhnt, genauso wie ihr Verstand daran gewöhnt war, zuzuhören und nachzudenken, während ihre Finger weiterarbeiteten. Keiner der Männer beachtete sie. Es schien, als hätten sie ganz vergessen, dass sie da war. Und solange das der Fall war, durfte sie bleiben.
„Was hast du vor, Ando?“ Die tiefe, schartige Stimme, die an einen Sägestein erinnerte, der sich in splittriges Holz fraß, klang misstrauisch.
Bojana brauchte nicht aufzusehen, um zu wissen, dass der Schamane des Stammes gesprochen hatte.
„Ich will sie angreifen! Niemand darf so mit dem Graslandclan umgehen“, antwortete ihr Onkel hasserfüllt. „Dusan soll sich hüten, uns zu unterschätzen!“
Auf seine Worte folgte angespanntes Schweigen. Bojanas Herz pochte heftig. Sie wusste genug von den Clanangelegenheiten, um die Tragweite seiner Forderung zu verstehen. Die Männer des Stammes sollten kämpfen. Es würde Verletzte geben, Tote. Unter gesenkten Lidern beobachtete sie die Ratsmitglieder, die sich gegenseitig besorgte Blicke zuwarfen.
„Du willst sie angreifen?“, fragte jemand.
Ando nickte. „Nicht das Hauptlager“, erwiderte er. „Das Sommerlager.“
Der Schamane strich sich mit nachdenklicher Miene über den langen, dünnen Bart. Plötzlich klatschten die Tierhäute, die vor dem Eingang der Hütte hingen, aneinander. Bojana drehte sich ruckartig zu dem Geräusch um und entdeckte ein kleines Mädchen mit wilden dunklen Locken in der Tür. Alle Blicke richteten sich auf Andos Tochter, die die Männer ihrerseits mit riesigen Augen anstarrte und ängstlich auf ihrer Unterlippe kaute, ein geschnitztes Holzpferd unter den Arm geklemmt.
Ando räusperte sich. Die Störung war ihm sichtlich peinlich, aber während er jemand anderes deswegen angebrüllt hätte, wandte er bei seiner Tochter lediglich den Blick ab. „Letztes Jahr haben sich die Steppenreiter Dusan unterworfen“, sagte er in die Runde, und die Ratsmitglieder wandten sich wieder ihrem Sippenführer zu.
Bojana legte die kleine Kappe beiseite und streckte die Hände nach ihrer Base aus, die noch immer zitternd im Eingang stand. Sofort rannte Ljuba zu ihr und warf sich an ihre schmale Brust. Sie zog sie auf ihren Schoß und legte die Arme fest um sie. Vor zwei Jahren waren Bojanas leibliche Eltern an einer furchtbaren Krankheit gestorben. Seitdem lebte das Mädchen bei seiner Tante und deren Familie. Besonders die Kinder hatte Bojana ins Herz geschlossen. Andos Sohn war mit zehn Jahren im selben Alter wie sie, Ljuba war sechs Sommer alt und ihre jüngere Schwester vier. Und ihre Tante war wieder schwanger.
„Noch ein Stamm, der sich Dusan beugt“, hörte sie einen Mann sagen.
„Wie viele sind es jetzt?“, fragte ein anderer.
„Mit den Steppenreitern drei“, antwortete Ando düster.
„Hm“, machte der Schamane. „Der Graslandclan zählt viele Mitglieder, der Schwarze Clan ist nicht einmal halb so groß – warum sollten wir uns von Dusan bedroht fühlen?“
Bojana bemerkte die Besorgnis in den Augen ihres Onkels, die den hübschen Hinterkopf seiner Tochter fixierten. Auch wenn er es nie aussprach, ahnte sie, dass Ljuba sein Liebling war. Sie war ein ruhiges, zurückhaltendes, aber auch sehr furchtsames Kind und das absolute Gegenteil von ihrer jüngeren Schwester Dafina. Das Holzpferd, das Ljuba im Arm hielt, hatte Ando für sie geschnitzt. Bojana konnte sich genau daran erinnern, wie er es Ljuba geschenkt hatte. Ihr helles, glückliches Lachen klang noch in ihren Ohren nach. Andos Augen hatten nie so warm und gütig ausgesehen wie in diesem Moment.
„Im Herbst haben sie zwei Mädchen in der Nähe des Dorfes entführt. Von den geraubten Pferden fange ich gar nicht erst an“, berichtete der Sippenführer. „Und im letzten Mond haben sie zwei Äcker im Norden angesteckt. Ein Großteil des jungen Emmers ist verbrannt. Beim Angriff gab es vier Verletzte, einer ist tot. Wie viele Tote kannst du verschmerzen, Schamane?“
„Genauso haben sie es mit dem Steppenreitervolk gemacht“, murmelte eins der Ratsmitglieder, während der Zauberer augenscheinlich über Andos Worte nachdachte.
Er schob das Kinn vor, zog die Mundwinkel weit nach unten und kratzte sich am Hals. „Es wird mehr Tote geben, wenn du sie angreifst“, erwiderte er.
Ando schnaubte, aber bevor er antworten konnte, kam ihm ein anderer zuvor: „Sie werden uns für schwach halten, wenn wir nicht kämpfen. Und eines Tages werden sie unser Dorf überfallen.“
Der Schamane nickte bedächtig. „Das ist wahr“, gab er zu. „Wann willst du den Schwarzen Clan angreifen, Ando?“
„Sobald sie ins Sommerlager umgesiedelt sind.“
„Wann wird das sein?“
„Beim nächsten vollen Mond.“
Es kam Bojana vor, als hielten alle Anwesenden die Luft an, während der Schamane das Für und Wider abwog. Endlich erklärte er: „Ich bin einverstanden. Wer noch?“
Zögernd schlossen sich vier der sieben Ratsmitglieder an. Nur zwei stimmten gegen Andos Vorschlag. Zum ersten Mal seit die Versammlung begonnen hatte, sah Bojana ihren Onkel lächeln. Sein Grinsen glich dem Zähnefletschen eines Wolfs und sie erschauerte.
„Dann ist es beschlossen“, sagte er. „Lasst uns den Ablauf des Angriffs durchgehen.“
Bojana hörte nicht mehr zu. Sie sah auf den dunklen Haarschopf an ihrer Schulter. Sie spürte Ljubas Herzschlag, der im Einklang mit ihrem eigenen schlug. Ihre Base wirkte so hilflos auf sie, als müsste sie vor allem beschützt werden. Bojana legte ihr Kinn auf den Scheitel des kleinen Mädchens und sog den Geruch der Locken ein. Angst schlich sich wie ein lautloses Raubtier in ihr Herz. Hoffentlich ging bei Andos Plan alles gut. Sie hatte ein schlechtes Gefühl, aber ihrem Onkel davon zu erzählen, wäre unsinnig. Sie war nur ein Mädchen, das Furcht verspürte – mehr nicht. Bojana drückte ihre Lippen auf das weiche Haar ihrer Base. Sie würde sie beschützen, was auch passieren mochte.
***
„Gehst du wirklich mit Vater ins Sommerlager?“, fragte Karan und sah seinen Bruder mit leuchtenden Augen an.
Tarin nickte lächelnd. Er stellte einen Fuß auf den dünnen Holzbalken des Zauns, der die Koppel eingrenzte, hob das Bündel von seiner Schulter und ließ es zu Boden gleiten. Er schnalzte mit der Zunge. Sofort löste sich eine schwarze Stute mit einer weißen Zeichnung auf der Stirn aus der kleinen Herde und trabte auf ihn zu. Der junge Mann streckte die Hand aus und berührte den hellen Streifen, der vom Punkt zwischen den Augen bis hinunter zum Maul verlief. Die Stute wieherte leise. Die Sonne brachte ihr dunkles Fell zum Leuchten und offenbarte das fleckenartige Muster, das bei herkömmlichen Lichtverhältnissen nicht sichtbar war.
In den Bergen, wo der Schwarze Clan sein Lager in einem von hohen Felswänden umschlossenen Tal aufgeschlagen hatte, dauerte der Winter länger als in der Ebene. Doch inzwischen stand die Sonne so hoch, dass ihre Strahlen über die Gipfel reichten und die vereisten Pässe freischmolzen. Es war so warm, dass Tarin auf seine dicke Felljacke verzichtet hatte und nur eine knielange Tunika aus gegerbtem Ziegenleder und passende Beinlinge trug. Seine Winterstiefel hatte er gegen weiche Lederschuhe getauscht.
„Ich möchte auch mitkommen!“, rief sein kleiner Bruder empört.
Tarin grinste. „Du bist zu klein, um Vater eine Hilfe zu sein, Karan“, stichelte er. Er zog ein Zaumzeug, geflochten aus Pferdehaar mit hübsch verzierten Trensenknebeln aus Geweih, aus seinem Reisebündel und duckte sich unter der Querstrebe des Zauns hindurch.
Karan schnaubte.
Während Tarin der schwarzen Stute den Zaum anlegte, sah er mit einem Seitenblick, wie sein Bruder die Fäuste ballte. Er ignorierte Karans Geste und streichelte liebevoll den langen, muskulösen Hals der Stute. Sie gehörte ihm allein. Vater hatte sie ihm geschenkt.
Tarin war einer der Ersten gewesen, der vor einem Jahr zu reiten gelernt hatte. Der Schwarze Clan war nicht beritten gewesen, bis ihm das Steppenreitervolk vier Handvoll rappwindfarbener Pferde für den vereinbarten Frieden überlassen hatte. Die Stuten waren an den Umgang mit Menschen gewöhnt und zum Reiten ausgebildet. Dafür mussten die Männer des Schwarzen Clans erst noch lernen, welchen Preis die Freiheit kostete, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen. Eine Stute brauchte viel Futter und vier Handvoll Stuten umso mehr. Heu musste in der Ebene geschnitten und für den Winter bevorratet werden. Zudem wollten die Tiere auch dann regelmäßig bewegt werden, wenn ihr Dienst nicht vonnöten war. Im Winter mussten sie sogar trocken gerieben werden, um nicht zu erkranken. Ein Pferd zu besitzen machte viel Arbeit, aber der Schwarze Clan verfügte über genügend Sklaven, die diese Aufgaben übernahmen. Drei Jungen hatte das Steppenreitervolk im letzten Sommer nach den Verhandlungen mit Dusan geschickt, damit sie den Männern alles über die Haltung von Pferden beibrachten. Einer von ihnen, wortkarg und ruhig, sein Name war Cuska, hatte Tarin das Reiten beigebracht. Und er hatte schnell gelernt. Erfüllt von väterlichem Stolz hatte Dusan seinem erstgeborenen Sohn eine der schwarzen Stuten geschenkt.
Tarin führte die Stute am Zaun entlang zu einem Gatter, das nur aus einem schweren Balken bestand, der in einer Halterung lag, sodass man ihn herausheben konnte.
Karan lief außerhalb des Geheges neben ihm her. „Warum kann ich nicht mitkommen?“
„Weil du noch nicht initiiert worden bist“, antwortete Tarin. „Nur die erwachsenen Männer gehen ins Sommerlager.“
„Warum?“, wollte Karan wissen.
Tarin zuckte mit den Achseln. „War schon immer so.“
Karan verzog beleidigt den Mund. „Ich wäre Vater eine große Hilfe!“
Tarin blieb stehen, die Stute tat es ihm gleich, und er sah den Jungen mit den dunklen wuscheligen Haaren nachdenklich an. „Das wärst du, Bruder. Ganz bestimmt.“
Für Tarin war es das erste Mal, dass er ins Sommerlager ging. Es lag außerhalb des Tals und weit hinter den Bergen. Das offene Land der fruchtbaren Ebene war das Zuhause vieler Stämme. Von Zeit zu Zeit wurde Tauschhandel betrieben. Es fanden Treffen statt und manchmal folgte eine Frau einem Mann, um mit ihm bei seinen Leuten zu leben, aber die meiste Zeit blieb jeder Stamm für sich. Der Schwarze Clan hatte sich im Westen am Rande der Ebene in einem Gebirge niedergelassen. Nordöstlich von dort, kurz bevor die Tundra begann, lebte das Steppenreitervolk und im Südosten, wo die Weiden am fruchtbarsten waren, hatte der größte Stamm der Ebene sein Lager: Der Graslandclan. Dahinter erstreckte sich die raue Steppe, wo die großen Rentierherden lebten und Menschen, die eine andere Sprache sprachen als sie. Neben diesen drei Stammesverbänden gab es noch eine Reihe kleinerer, und für alle galt das unausgesprochene Gesetz: untereinander Frieden halten.
Doch das Gesetz war gebrochen worden.
Dusan, der Fürst des Schwarzen Clans hatte Überfälle auf die anderen Stämme befohlen. Tarin war sich nicht sicher, was sein Vater damit bezweckte, aber es hatte ihnen die Pferde eingebracht und neue Sklaven. Und es war nicht an ihm, an seinem Vater zu zweifeln.
Im späten Frühling, sobald die Pässe frei waren, zog ein Großteil der jungen Männer und einige Frauen in das Sommerlager um. Die Berge mochten den Schwarzen Clan vor Feinden schützen, aber sie gaben nicht genug her, um die wachsende Gemeinschaft zu ernähren, und die Abgaben, die die unterworfenen Stämme in Form von Getreide und Vieh leisteten, waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen mussten sie während der warmen Jahreszeit genügend Vorräte für den Winter anlegen. Jedes Jahr schlugen sie ihr Lager an einem Fluss östlich des Gebirges auf, um zu jagen, zu fischen, Korn zu ernten, das wild auf den Wiesen wuchs, und im nahegelegenen Wald Holz für die Herdfeuer und den Bau der großen Langhäuser zu schlagen.
Im letzten Jahr hatte eine Handvoll Jungen und Mädchen die Pferde auf die höher gelegenen Bergweiden getrieben und den Sommer über gehütet. Doch in diesem Jahr hatte der Fürst des Schwarzen Clans beschlossen, die Pferde mit in die Ebene zu nehmen. Vier Tage zuvor war ein Trupp zu Fuß aufgebrochen, um den langen Pass durch die Berge zu nehmen, der zu den üppigen Weiden führte. Sie sollten die Zelte aufbauen und ein Gehege für die Stuten errichten. Heute würden die Übrigen mit den Tieren nachkommen, und Tarin gehörte zu den besten Reitern. Das war der Grund, warum ihn sein Vater dabeihaben wollte, wenn sie die Pferde zum ersten Mal aus dem Tal führten. Zudem war Tarin bei weitem alt genug, um ihn zu begleiten.
„Ich werde ein großer Jäger, Tarin. Und dann werde ich ins Sommerlager gehen!“, rief Karan und schob seinen Kiefer trotzig vor.
Tarin sah die Entschlossenheit in den braunen Augen seines Bruders lodern. Liebe wallte in ihm auf. Er wollte eben etwas erwidern, da machte Karan kehrt und stampfte den sandigen Weg zurück zu den Häusern oberhalb der Anhöhe, kleine Staubschwaden mit den Füßen aufwirbelnd. Tarin sah ihm nach, ehe er sich wieder in Bewegung setzte. „Das wirst du“, murmelte er, „und dann begleite ich dich.“
Er steuerte mit seiner Stute auf das Gatter zu, nahm kurz eine Hand vom Zaum, um den Balken anzuheben, dann führte er das Pferd hinaus. Die drei Stuten, die noch auf der Koppel standen, sollten den Sommer im Tal verbringen. Dusan wollte sofort benachrichtigt werden, falls etwas im Hauptlager passierte.
Eine Sklavin hastete mit einer meckernden Ziege, die sie an einem Strick hinter sich her zerrte, an Tarin und seiner Stute vorbei, als er den kürzesten Weg zum östlichen Pass einschlug. Schweiß glitzerte auf ihrem schmutzigen Gesicht. Sie schnaufte.
Tarin hörte Kinderlachen, dann ein lautes Heulen. Er entdeckte Jungen, die sich gegenseitig jagten. Einer war hingefallen und hatte sich das Knie aufgeschlagen. Die anderen beachteten ihn nicht und tobten weiter.
Das Leben im Dorf ging seinen gewohnten Gang. Keiner bemerkte ihn. Und es ärgerte Tarin, dass niemand Anteil an seinem Glück nahm. Als er an den beiden strohgedeckten Langhäusern vorbeimarschierte, verfinsterte sich sein Gesicht. Ein spitzer Stein bohrte sich in die Sohle seines rechten Schuhs und er starrte verdrießlich zu Boden.
Plötzlich ertönte eine heisere Stimme: „Bist du so weit?“
Tarin hob den Blick, beschattete seine Augen vor der Sonne und sah die großen schwarzen Silhouetten der beiden Reiter und ihrer Pferde. Er konnte ihre Gesichter nicht erkennen, aber seinen Vater hatte er bereits an der markanten Stimme ausgemacht. Der andere war höchstwahrscheinlich sein Vetter Darko. Tarin nickte eifrig. Beim Näherkommen sah er, dass der linke Reiter grinste. Selbst im Schatten leuchteten die kräftigen, hellen Zähne seines Vaters.
„Dann komm.“ Dusan lenkte sein Pferd herum und ritt los. Der zweite Reiter folgte ihm.
Tarin zog sich eilig an der dunklen Mähne seiner Stute auf deren Rücken, presste dem Pferd mit leichtem Druck die Fersen in die Flanken und schnalzte. Sogleich fiel das Tier in einen schnellen Trab. Tarin holte die anderen ein und lenkte seine Stute neben Dusans. Aus den Augenwinkeln beobachtete er seinen Vater.
Dusan war kein großer Mann, nichtsdestotrotz war er eine imposante Erscheinung. Er war muskulös, mit einem sehnigen Hals und tiefen Furchen in seinem kantigen Gesicht. Sein dunkles, schulterlanges Haar war mit schmutziggrauen Strähnen durchsetzt. Der dichte, kurzgeschnittene Bart war vollständig ergraut. Er wirkte älter, als er tatsächlich war.
Der Reiter auf Dusans anderer Seite beugte sich vor und grinste Tarin an. Darko war eine Handvoll Jahre älter als er und schon mehrere Male im Sommerlager gewesen. Er musste die Vorfreude in Tarins Gesicht gesehen haben, denn er zwinkerte ihm zu, und dem Jungen stieg die Hitze in die Wangen. Schnell richtete er den Blick nach vorne.
Sie ritten aus dem Dorf und über eine Wiese mit leichtem Gefälle, die übersät war mit kleinen gelben Blüten, und hielten auf die dunklen Berge zu. Der östliche Pass fraß sich wie eine klaffende Wunde in den Fels und warf einen breiten Streifen Licht in das Tal. Eine Gruppe von Männern wartete im Schatten der Berge auf sie. Alle waren beritten und einige führten zusätzliche Packpferde mit sich. Nur eine einzelne schmale Gestalt war zu Fuß. Sie stand neben einem großen grauen Pferd, das Gesicht in Tarins Richtung gewandt. Als er sie erkannte, zuckte er heftig zusammen. Ruckartig drehte er sich zu seinem Vater um. „Was tut Mutter hier?“
In Dusans Gesicht regte sich kein einziger Muskel. „Auf Wiedersehen sagen“, erklärte er knapp.
Tarin verglühte geradezu vor Scham. Er stierte auf den Widerrist seiner Stute. Wie mochte es auf die anderen Männer wirken, dass seine Mutter ihn verabschieden wollte? Seine Zähne knackten laut. Die drei Reiter erreichten die anderen und hielten an.
Die Frau mit dem dicken dunklen Zopf kam auf Tarin zu. Sie stellte sich neben seine Stute und streichelte ihre Blesse, ohne ihren Sohn anzusehen.
Tarin rutschte unbehaglich mit dem Hinterteil auf dem Rücken des Pferdes hin und her.
„Ich wünsche dir eine gute Reise, mein Sohn“, sagte Rajka. Sie sah immer noch nicht auf. „Komm gesund zurück.“ Dann wandte sie sich ab und ging ohne ein weiteres Wort davon.
Tarin öffnete erstaunt den Mund. Er hatte erwartet, dass sie ihn in den Arm nehmen, ihn küssen wollte. Sein Magen klumpte sich zusammen. Plötzlich wünschte er sich, sie hätte es getan. Er sah ihr nach, wie sie über die Wiese zurück ins Dorf ging und sich immer weiter entfernte. Würde sie sich wenigstens umdrehen? Er hörte den Befehl zum Aufbruch dicht an seinem Ohr und das Klappern der Hufe auf dem felsigen Untergrund, als sich der Trupp in Bewegung setzte, aber er rührte sich nicht.
„Komm, Tarin!“
Widerwillig riss Tarin seinen Blick von der kleiner werdenden Gestalt seiner Mutter und nickte Dusan zu, dann bedeutete er seiner Stute, loszutraben.
***
Feiner Niesel nahm Karan die Sicht. An diesem Morgen war der Himmel in dichtes Grau gehüllt, kein Sonnenstrahl vermochte durch die Wolkenmauer zu brechen, Regentropfen dagegen zuhauf. Das struppige dunkle Haar des Jungen sog sich mit Wasser voll und klebte an seinem Kopf.
Gemächlich schlenderte er in der Siedlung umher, während die anderen Leute durch den Regen hasteten, um nicht allzu nass zu werden. Sein Blick war auf einen kleinen Kiesel gerichtet, den er lustlos vor sich her stieß. Der Sandweg war zu festgetreten, um matschig zu werden, aber der Kies knirschte unter seinen durchnässten Lederschuhen. Der nächste Tritt versenkte den Stein in einer Pfütze, die sich in einer Mulde gebildet hatte. Karan blieb stehen, glotzte in das schmutzige Wasser und zog geräuschvoll die Nase hoch.
Elf Sommer zählte er, aber er fühlte sich nicht mehr wie ein Kind. Er verspürte keine Lust, mit den Gleichaltrigen zu spielen. Er wollte reiten lernen, jagen und kämpfen! Der Steppenreiterjunge war nur ein Jahr älter gewesen als Karan, als er in den Kreis der Jäger seines Stammes aufgenommen worden war. Er hatte ihm selbst erzählt, dass er schon im Alter von acht mit seinem Onkel auf die Jagd gegangen war. Karan war neidisch auf den Sklaven, denn er besaß all das Wissen, was er sich aneignen wollte.
Dusan hatte gesagt, dass die Ausbildung seines zweitgeborenen Sohns frühestes im nächsten Sommer beginnen würde. Und erst wenn er so alt war wie Tarin jetzt, durfte er sich als Mann bezeichnen, und das auch nur, wenn der Stammesrat ihn als solchen anerkannte. Karan knirschte mit den Zähnen. Sein Vater beschwerte sich oft über die alten Männer, die ihn nicht handeln ließen, wie er wollte. Karan fragte sich, warum es einen Rat gab, wenn dieser kluge Ideen nicht verstand. Dumme Ratsmitglieder – sie schafften Gesetze, die keinen Sinn machten.
Am liebsten wäre Karan seinem Vater und Tarin ins Sommerlager gefolgt. Im Kopf hatte er es viele Male durchgespielt. Dann hatte er seine Sachen gepackt, war des Nachts aus der Holzhütte, die er seit drei Handvoll Tagen nur mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder Dajan bewohnte, geschlichen, hatte sich ein Pferd geholt und war den östlichen Pass hinuntergeritten. Doch das waren Tagträume, denn Karan konnte nicht reiten. Noch nicht.
Der Junge nieste. Er wischte sich mit dem Handrücken den Rotz von der Nase. Seine Ledertunika war tropfnass, fühlte sich kalt an auf seiner Haut und scheuerte. Er war schon viel zu lange draußen im Regen. Bestimmt hatte seine Mutter inzwischen das Mittagessen bereitet. Er sah auf und wollte eben kehrtmachen, um zum Haus des Stammesfürsten zurückzutraben, als er eine dunkle Gestalt auf dem Hauptweg bemerkte. Karan blinzelte den Regen fort.
Die Gestalt kam geradewegs auf ihn zu. Es war ein Mann, gehüllt in einen Umhang aus schwarzen Rabenfedern, an denen Myriaden von glänzenden Tropfen hingen. Erregung rieselte wohlig wie ein Sommerschauer sein Rückgrat hinab. Mit Verwunderung stellte Karan fest, dass keiner der wenigen Dorfbewohner den Fremden auf sein Erscheinen ansprach. Wie angewurzelt stand der Junge da und ließ den Mann näherkommen. Er blieb nur eine Speerlänge von Karan entfernt stehen. Ein schiefes Lächeln lag auf den schwarzbemalten Lippen inmitten eines hageren Gesichts. Ein Tropfen zitterte an der Spitze der langen Nase. Die Augen waren unter der Kapuze verborgen und Karan reckte unwillkürlich den Hals, um darunter zu spähen. Das Grinsen des Fremden vertiefte sich.
„Wer bist du?“, fragte der Junge misstrauisch.
„Man nennt mich Vater der Krähen. Ich möchte mit Dusan sprechen.“
Die Stimme des Mannes war klangvoll und erstaunlich klar und drang in Karans Brust, wo sein Herzmuskel in kräftigen Stößen das Blut in seine Adern drückte.
„Mein Vater ist nicht da“, antwortete er zögerlich.
„Dusan ist dein Vater? Wo ist er?“
„Im Sommerlager.“
„Ah“, machte der Fremde und lächelte wieder.
„Meine Mutter ist da“, murmelte Karan.
„Bringst du mich zu ihr?“
Der Junge nickte, wirbelte herum und lief durch den Regen. Mit patschenden Schritten erreichte er das Holzhaus mit dem Dach aus nassem, grauem Stroh und steckte seinen Kopf zur Tür herein.
Seine Mutter saß mit Dajan am Feuer und hob den Blick. „Wo warst du?“, fragte sie scharf.
„Wir haben Besuch!“, rief Karan bloß und trat wieder nach draußen, um dem Fremden, der ihm langsam hinterhergetrottet war, die Türvorhänge aufzuhalten.
Der Mann mit dem Rabenfederumhang betrat die Hütte. Über seine niedrige Schulter hinweg sah Karan, wie seine Mutter aufsprang. Ihre Züge verwandelten sich in eine verzerrte Fratze, eine Mischung aus Furcht und Wut spiegelte sich in ihnen. Sein kleiner Bruder versteckte sich hinter Rajkas Rücken. Sie funkelte den Besucher herausfordernd an. „Was willst du hier, Schamane?“, knurrte sie.
Schamane? Wieder erfasste Karan dieses merkwürdige Prickeln. Er runzelte die Stirn.
Rajkas Augen richteten sich auf ihn. „Karan!“, rief sie schrill. „Komm her!“
Nicht sein Gehorsam, sondern die Verwunderung über die Panik in der Stimme seiner Mutter brachte ihn dazu, ihrem Befehl Folge zu leisten. Er schlüpfte an dem Schamanen vorbei, stellte sich neben Rajka und drehte sich zu dem Mann um. Seine Mutter griff nach seinen Schultern und zog ihn an sich, bis sein Rücken an ihrem Körper lehnte.
„Halt dich von meinen Kindern fern!“
Der Schamane lächelte kalt. „Ich bin nicht wegen deiner Kinder hier. Ich möchte mit Dusan sprechen.“
„Er hat dir gesagt, dass du nicht herkommen sollst“, zischte Rajka.
„Ich habe ihm einen Vorschlag zu machen. Er könnte mich wenigstens anhören … nach allem, was ich für ihn getan habe.“
Karans Mutter schnaubte. „Er schuldet dir nichts. Er hat den Preis bezahlt, oder etwa nicht?“
Der Schamane nickte, dann seufzte er betont laut. „So ist es“, gab er zu und wandte sich halb um. „Dann werde ich gehen. Ich hoffe, dass dein Starrsinn Dusan nicht teuer zu stehen kommen wird, Frau.“
Der Schamane kehrte ihnen den Rücken zu, schob die Türvorhänge auf und wollte gerade hinausgehen, als Karan ihn zurückhielt.
„Was willst du von meinem Vater?“ Er spürte, wie sich seine Mutter versteifte. Ihre Hände gruben sich schmerzhaft in seine Schultern.
„Ich wollte ihm nur meine Hilfe anbieten.“
Bevor Karan noch etwas fragen konnte, rief seine Mutter: „Geh, Schamane, geh! Meinen Jungen bekommst du nicht!“
Der Mann lachte und hinter ihm klatschten die nassen Ledervorhänge zu.
Karans Herz pochte laut. Der Junge hielt den Atem an. Er straffte die Schultern und wirbelte zu seiner Mutter herum. „Vater muss das wissen! Schick mich zu ihm.“