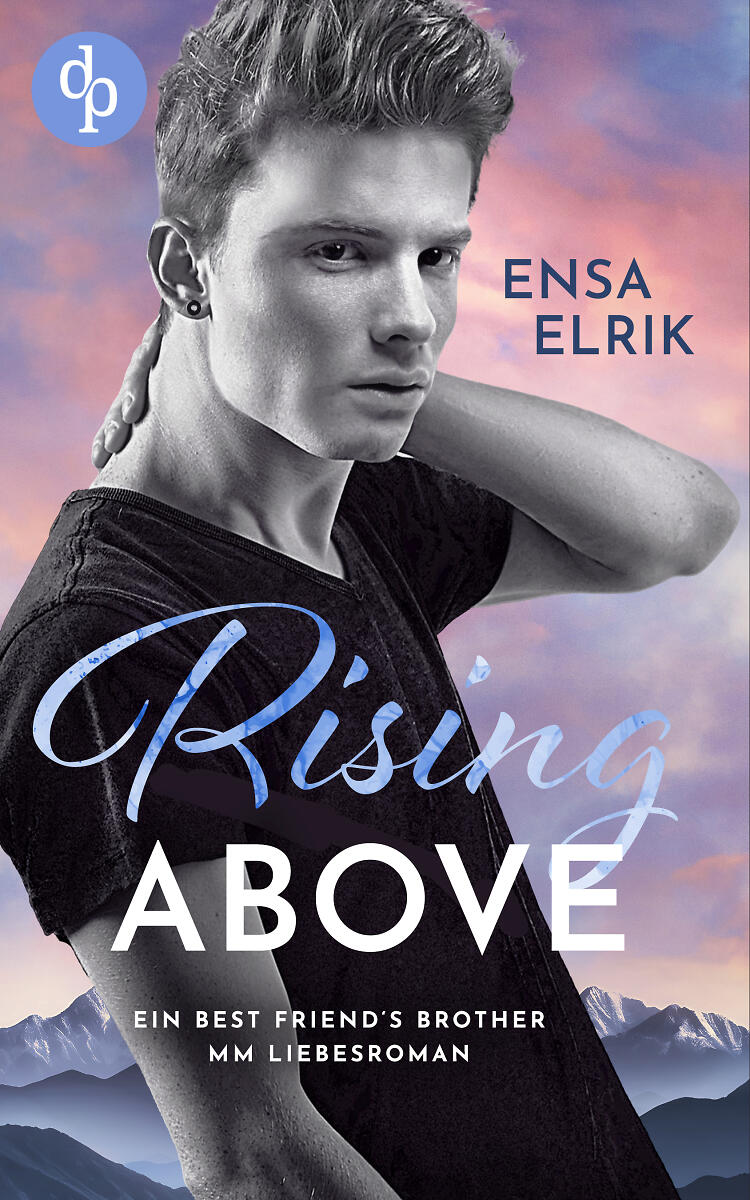Kapitel 1: Durch das Raue zu den Sternen
Atlas
Kein Plan ist wasserdicht.
Das hat meine beste Freundin Forest immer gesagt, wenn wir beim Klettern ohne Seil an einer Wand hingen und spontan unsere Route ändern mussten. Genau daran denke ich, als der erste Tropfen in meinem Nacken landet.
»Es regnet«, bemerkt Sam unnötigerweise. Ich ignoriere die Warnung, die in seiner Aussage mitschwingt. Nicht einmal eine Zombieapokalypse kann mich davon abhalten, die Tower Bridge zu besteigen, und schon gar nicht etwas Nieselregen. Sie ist die berühmteste Brücke in London und liegt im Herzen der Stadt. Über 40.000 Menschen überqueren die Brücke täglich, was sie zur perfekten Location für unsere Aktion macht. Je mehr Aufmerksamkeit, desto besser. Ehrlicherweise gefällt es mir, dass die Chancen schlecht für uns stehen. Die frische Nachtluft riecht nach Abenteuer.
Wenn der Wind und der Regen von Osten kommen, dann klettern wir halt auf der Westseite. Wir wechseln die Straßenseite.
Ein Autofahrer im Anzug rast hupend vorbei und streckt uns den Mittelfinger entgegen. Sam brüllt ihm hinterher, dass er ein kleiner Pisser ist, und ich winke. Ganz ehrlich? Wenn ich noch vor dem Morgengrauen ins Büro fahren müsste, wäre ich auch angefressen.
Ich schwinge mich leichtfüßig auf den gebogenen Stahlträger der Tower Bridge. Ich binde mir die dunkelbraunen Haare zu einem Pferdeschwanz und ziehe die schwarze Sturmhaube auf. London schwebt durch die Zeit, bei der niemand weiß, ob es noch Nacht ist oder schon früher Morgen. Bald geht die Sonne auf und es wird hier nur so vor Menschen wimmeln. Am anderen Ufer der Themse blinken die Lichter der Stadt in einem dunstigen Blau. Der Wind ist stark und die nächsten Regentropfen besprenkeln mich von der Seite. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Turm besteigen wollen, bevor irgendein Arsch auf die Idee kommt, die Polizei zu alarmieren. Ich liebe Herausforderungen, aber nur solange ich nicht hinter Gitter muss.
»Showtime«, rufe ich Sam zu, bevor er es sich anders überlegen kann. Er sieht mich kurz mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Neunzig Prozent von Sams Emotionen werden durch seine buschigen Augenbrauen gezeigt, die wie zwei schwarze Raupen aus den Löchern seiner Sturmhaube kriechen. Darunter hat er blondes, gewelltes Haar. Ein paar der Strähnen kräuseln sich aus den Gucklöchern und es sieht so aus, als würden die Raupen Spaghetti futtern. Wir stecken beide in dunklen Kampfuniformen bestehend aus taktischer Jacke, Cargohosen, Rucksack und Kletterschuhen. Die Beschreibung auf Ebay »original SWAT-Uniform« war einfach zu verlockend und ich finde man könnte uns wirklich für Spezialagenten halten. Sam und ich sind ungefähr gleich groß, doch da enden schon unsere Ähnlichkeiten. Er ist stark und sehnig, wie die meisten Free Climbing-Profis eben aussehen. Seine Haare sind blond und er hat die typische englische Blässe, weswegen er das halbe Jahr mit einem Sonnenbrand auf den Schultern herumrennt. Mir sieht man die spanischen Gene direkt an. Dunkle, lange Haare, olivfarbener Teint, den ich nur im Winter verliere, und ein breites Kreuz, weswegen die Jacke etwas spannt. Wenn ich klettere, dann liebe ich große, präzise Bewegungen, da ich mit fast 1,90 m nicht für kleine Manöver gemacht bin.
Sam seufzt, dann holt er aber doch das Equipment aus dem Rucksack und montiert eine GoPro-Kamera an seinem Helm. Heute ist die letzte Chance, diese Aktion durchziehen zu können, und ich werde das Team von Green Vanguard nicht im Stich lassen. Dafür sind wir zu weit gekommen.
Unsere – nicht ganz legalen – Klettervideos für die Naturschutzorganisation sind auf TikTok durch die Decke gegangen und haben in der britischen Bevölkerung eine Protestwelle ausgelöst. Wir müssen das Biest weiter füttern, solange Green Vanguard noch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
Ich ziehe Sam mit einem Ruck auf den Stahlträger.
»Denk an die Klicks«, sage ich mit einem Grinsen, in der Hoffnung, Sams Bedenken über das miese Wetter wegzublasen. Ich weiß, wo ich sein Ego kitzeln muss. Wenn es um Social Media-Reichweite geht, ist er ganz vorne mit dabei. Ich bin mir sicher, dass er es insgeheim lieber hätte, wenn wir unsere Gesichter auf den illegalen Protestvideos zeigen könnten. Viral zu gehen, ohne die Anerkennung zu kassieren, stinkt ihm gewaltig. Zum Glück kenne ich ihn, seitdem wir als Rotzlöffel gemeinsam Pokémon-Karten auf dem Schulhof getauscht haben, und weiß, dass er lieber anonym auf der For You-Page von Tausenden landet, als gar nicht zu trenden.
Ich visualisiere ein letztes Mal die Kletterroute. Die Tower Bridge besteht aus zwei Brückentürmen, die 65 Meter hoch sind. Die Türme werden von zwei Fußgängerstegen verbunden, die in einer Höhe von 43 Metern liegen. Unser Ziel ist es, in der Mitte der Stege ein zwanzig Meter langes Banner von oben zu hissen. Zu den Türmen gelangt man über gebogene Stahlträger, die kurz über der Fahrbahn anfangen und sich dann bis hinauf zu den Türmen erstrecken. Der knifflige Teil ist es, von dem Stahlträger zu den Fußgängerstegen zu kommen. Dafür müssen wir uns entlang der Turmfassade hangeln. Nichts leichter als das.
Sam schlingt seine Sicherheitsleine um den Träger und richtet dann die GoPro auf mich. Sobald das rote Licht blinkt, ziehe ich die Sturmhaube über und greife in den Chalkbeutel an meiner Hüfte. Chalk hält meine Hände trocken und griffig, denn anders als Sam klettere ich ohne Leine. Eine falsche Bewegung und ich ende als Fliegenschiss auf dem Asphalt.
Wie jedes Mal vor einem Free Solo fahre ich mit dem Daumen über das Tattoo an meinem Handgelenk und hinterlasse eine weiße Schicht über dem »Don’t Panic«.
Ich blicke auf das dunkle Wasser unter uns. Jeder Kletterer sagt einem, dass man nicht in die Tiefe schauen soll. Mir hilft es. Zuerst Gänsehaut, dann Herzrasen und dann verschwindet die Welt und es gibt nur noch mich und den Stahlträger.
Bereits nach wenigen Metern sind meine Finger taub von der Kälte des Metalls. Ganz anders als die Felsen, die ich sonst so besteige. Der Seitenregen macht alles rutschig. Wir kommen zu langsam voran. Ich klettere in Schuhen, die mir extra Halt geben. Sie dienen nicht nur dem Halt, sondern auch der Tarnung. Ich bin dafür bekannt, dass ich in meiner Freizeit gerne barfuß klettere. Bei Tag sind Sam und ich professionelle Climber und auf Social Media nehmen wir die Menschen in die Welt des Kletterns mit. Unter unseren Followern gibt es genug Fußfetischisten, denen ich zutraue, mich anhand meiner Zehen und Fußtattoos wiederzuerkennen. Bei knapp vier Millionen Followern erhalte ich täglich Anfragen, meine Fußbilder gegen etwas Taschengeld herauszurücken. Eventuell habe ich ein oder zwei Mal darüber nachgedacht. Sams Mutter Camilla ist auch gleichzeitig unsere Managerin und sie hat mir vehement davon abgeraten – Spaßbremse. Wenigstens weiß sie nicht, was wir hier für Green Vanguard machen, dann wären meine sexy Zehen ihr kleinstes Problem.
Der Neigungswinkel wird immer steiler, bis ich fast im neunzig Grad Winkel aufsteige. Hier bin ich in meinem Element. Oben bei der Turmfassade angekommen, drehe ich mich zu Sam um, der mir dicht auf den Fersen ist. Der Stahlträger liegt wie eine abgefahrene Rutsche hinter uns. Vor uns ragt die Tower Bridge empor, ein über 100 Jahre altes Mahnmal, das zu der Zeit erbaut wurde, als England in der zweiten industriellen Revolution steckte. Ob die Menschen schon damals geahnt haben, dass sie mit diesem Fortschritt das Grab für unser Klima schaufeln würden?
»Fuck, die sind sicher wegen uns hier«, ruft Sam, als in der Ferne Polizeisirenen zu hören sind. Mist. Unter uns versammeln sich Schaulustige. Die Scheinwerfer der Brücke verwandeln uns in Theaterkünstler auf einer improvisierten Bühne. Der Regen nimmt zu.
»Wir müssen abbrechen«, ruft Sam und seine Stimme verliert sich im peitschenden Wind.
Ich strecke die Hand aus. »Gib mir die GoPro.«
Wenn er nicht weitergehen will, dann ziehe ich es allein durch. Ich bin noch nie vor einer Challenge zurückgeschreckt und ich werde jetzt nicht damit anfangen.
Sams Blick verhärtet sich. »Lass den Mist«, sagt er und geht einen Schritt zurück.
»Ich mache das mit dir oder ohne dich«, verkünde ich. The show must go on.
»Atlas«, sagt Sam mit Nachdruck und packt meinen Unterschenkel. In dieser Sekunde rutscht er. In einem Moment sehe ich noch seine vor Schreck geweiteten Augen, dann ist er weg. Der Ruck an meinem Bein bringt mich ins Wanken. Ich strauchle. Unten schreien Menschen.
Ich bekomme den Träger mit einer Hand zu fassen und mit all der Kraft in den Fingerspitzen, die ich mir in den letzten fünfzehn Jahren im Freeclimbing angeeignet habe, ziehe ich mich in Sicherheit.
Mein Puls wummert so laut in meinen Ohren, dass es den Tumult unter uns übertönt.
Shit. Was ist mit Sam? Ich halte den Atem an und beuge mich vorsichtig vor. Die Schlaufe der Sicherheitsleine ist drei bis vier Meter an dem Träger heruntergerutscht und dann eingerastet. Erleichterung rollt in Wellen über mich. Sam flucht laut. Die Leine ist kurz und mit etwas Schwung ist er wieder auf dem Träger.
»Das sind fünf Pfund für das Fluchglas«, versuche ich es mit einem Scherz.
»Halt den Mund und lass uns endlich dieses verdammte Banner hissen«, sagt Sam entschlossen.
Ich lächle erleichtert gen Himmel.
»Per aspera ad astra«, rufe ich unser Motto. Durch das Raue zu den Sternen. Oder mit anderen Worten: Ohne Fleiß keinen Preis.
Ich stelle mir vor, wie Forest mit uns klettert und dieselben Worte in den Wind schreit. Die Tower Bridge gegen den Klimawandel zu besteigen, wäre ganz nach ihrem Geschmack gewesen. Aber Forest ist nicht hier. Aus dem Trio ist ein Duo geworden.
Die Seite der Brücke zu wechseln, ist eine gute Entscheidung gewesen, denn auf der Westseite sind wir besser vor Wind und Regen geschützt. Der Übergang vom Stahlträger auf den Turm klappt reibungslos. Ich blende den Lärm unter uns aus. Schalte meine Neuronen auf Durchzug und überlasse mich ganz meinem Instinkt. Der Vorsprung an der Turmfassade ist nur eine halbe Hand breit und nicht dafür gedacht, zwei Männer Mitte zwanzig zu halten. Dennoch lege ich mein Leben in die Hände von vier Zentimetern. Ich ertaste winzige Ritzen im Gestein und halte mein Gewicht mit der Kraft meiner Fingerspitzen.
Ich gelange zu dem Fenster des Towers, wo ich mehr Fläche zum Greifen habe. Dort lege ich eine kurze Verschnaufpause ein und greife in den Chalkbeutel. Die Wetterlage verändert sich schlagartig. Der Wind dreht und kommt plötzlich aus Westen. Da, wo der Stein gerade noch trocken ist, sehe ich die ersten Tropfen.
»Eure Taten stören die öffentliche Ordnung. Dies ist das Eigentum der Stadt London. Kooperieren Sie mit den Autoritäten«, dröhnt die Stimme eines angepissten Polizisten aus einem Megafon. Kooperieren? Mit Bullen? Niemals. Ich beobachte die Fassade, zähle die Sekunden, bis die Tropfen einziehen. Dann mache ich weiter. Ein Fuß nach dem anderen. Die andere Seite des Turms, zu der ich muss, um auf die Balken in der Mitte zu kommen, ist schon zum Greifen nahe. Trotzdem finde ich mit meiner führenden Hand keinen Halt mehr. Bislang habe ich mich an der Ritze zwischen den Steinen über mir orientiert. Der Spalt ist so durchnässt, dass ich mich nicht traue, mit der anderen Hand loszulassen. Mittlerweile tropft es in die Sturmhaube und läuft mir in die Augen. Ich blinzle und klammere und blinzle weiter. Der Regen hat den Chalk von meinem Tattoo gewaschen. Das »Don’t Panic« liegt offen. Die Sehne an meinem Handgelenk tritt bei der Anstrengung hervor und teilt das Tattoo in zwei. Don’t. Panic.
Wie fühlt es sich an, zu fallen? Der Gedanke streift mich in dem Moment, als ich endlich den Handwechsel vollführen will. Ich halte inne. Ein Blitz durchzuckt den dunklen Himmel und plötzlich höre ich die Welt um mich herum, als hätte jemand das Radio aufgedreht. Ich verliere den Fokus. Das Heulen der Polizeisirenen, die Rufe der Schaulustigen, der Wind, der an der Brücke zerrt. Panik.
Ich schließe die Augen. Ich will nicht an Forest denken, aber es ist wie mit dem rosa Elefanten. Plötzlich sehe ich ihr schiefes Grinsen, mit der gleichen, niedlichen Zahnlücke, die auch ihr kleiner Bruder hat. Ihre grünen Augen sind wie die Wipfel der Bäume, die wir als Kinder zusammen hochgeklettert sind, und ihre Haare so braun wie die Äste, an denen wir uns entlanggehangelt haben.
Ist es schnell gegangen? … »Nein«, sage ich laut, um das Denken zu durchbrechen und ihr Bild aus meinem Kopf zu verbannen.
Stattdessen beginne ich, mein Leben wie der Moderator einer Naturdoku zu kommentieren.
»Hier sehen Sie Atlas Cruzado in seinem natürlichen Habitat. Er gehört zur Gattung der sogenannten Freeclimber, einer kleinen Subgruppierung von Homo sapiens, die sich am wohlsten fühlen, wenn ihre Eier vierzig Meter über der Erde baumeln.« Ich verstelle meine Stimme zu einem tiefen Bariton, um einen zweiten Kommentator in das imaginäre Gespräch zu holen: »Erzähl mir mehr, Terry!«
Ich habe schon gefährlichere Klippen in die Knie gezwungen.
»Wie Sie sehen, befindet sich Atlas gerade in einer misslichen Position. Seine Griffel sind nicht in der Lage, ihn bei diesem Wetter zu halten.« Erneut verstelle ich die Stimme. »Oh nein, Terry! Und jetzt?«
Ich verlagere mein Gewicht, bis ich die perfekte Balance zwischen Körperspannung und Halt finde.
»Er wird wohl Trick 17 verwenden müssen.« Ich mache mich bereit. »Terry, was ist Trick 17?«
Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt zu fallen, und ich werde es auch nicht herausfinden.
»Beten, dass sein dummer Plan aufgeht.«
Wenn ich mich nicht langsam vortasten kann, muss ich es mit einem Schwung bis auf den Balken in der Mitte schaffen. Wer zögert, verliert.
Ich klammere mich an den unteren Teil eines kleinen Türmchens, der in die Höhe ragt und in einem Kreuz endet. Erst, als ich mich in meinem Griff sicher fühle, schwinge ich mich zurück, bis meine rechte Körperhälfte an der Wand ist, um mich mit aller Kraft meinem Ziel entgegen zu katapultieren.
Ich halte die Luft an, vertraue den Sternen und … lande sicher auf dem Balken in der Mitte. In meinem Kopf brennt Jubel auf, der verebbt, als ich nach unten blicke.
»Die sperren die Straße«, sage ich zu Sam, als er ebenfalls den Übergang schafft. Die Brücke ist für diese Uhrzeit ungewöhnlich voll geworden, mehrere Polizeifahrzeuge verursachen einen Stau bei aufkommendem Berufsverkehr. Die Leute stehen mitten auf der Straße und sehen uns zu.
»Dann lass uns den Scheiß endlich hinter uns bringen und abhauen«, brummt Sam und reicht mir ein Ende des Banners und eine Rauchbombe. Er zählt von drei runter und dann zünden wir sie. Dichter roter und grüner Rauch hüllt uns ein. Sofort sprinte ich los bis ans andere Ende des Tower-Übergangs, hake den Karabiner des Banners ein und warte, bis Sam so weit ist, dann werfen wir den Stoff von der Brücke. Mit erhobener Rauchbombe stehe ich über den Dächern Londons. Ich habe mich schon lange nicht mehr so badass gefühlt.
»Lass dich nicht erwischen«, rufe ich Sam zu, bevor wir in entgegengesetzte Richtungen flüchten. Niemandem ist geholfen, wenn wir gemeinsam geschnappt werden. Im Vergleich zum Aufstieg ist der Abstieg entlang des südlichen Turms ein Kinderspiel. Ich schaffe es problemlos auf das Dach des Häuschens, von dem man die Zugbrücke kontrolliert und das sich auf der Höhe der Straße befindet. Drei Polizisten kommen angerannt, schreien mir zu, dass ich stehen bleiben soll. Ich denke nicht mal dran.
»Parkour!«, rufe ich und springe vom Dach. Mein Publikum jubelt. Ihre Aufmerksamkeit macht süchtig. Bevor einer der Bullen mich zu fassen bekommt, hüpfe ich auf das Geländer, das die Tower Bridge von der Themse trennt, und sprinte auf ihm davon. Es ist Flut und der Fluss schimmert dunkel unter mir. Wenn ich es nur bis zur südlichen Seite des Flusses schaffe, kann ich dort untertauchen. Die Bullen versuchen mir zu folgen. Doch ich habe den Teil des Geländers erreicht, der an die Straße angrenzt und die Cops müssen sich erst mal durch die gaffenden Menschen kämpfen. Allerdings hetzen sie jetzt von vorne und von hinten auf mich zu. Das juckt mich aber nicht, denn mir kommt ein neuer Fluchtplan in den Sinn. Ich setze zum Sprung an.
»Hab ich dich!« Jemand packt mich an meinem Knöchel im selben Augenblick, in dem ich springe.
Scheiße.
Kapitel 2: Kontrollverlust
River
Wenn man sein Leben nicht unter Kontrolle hat, kann das manchmal verdammt hilfreich sein. Ich bin mir sicher, dass Londons Lärm und Menschenmassen mich heute tagsüber zum Verzweifeln gebracht hätten. Denn im Ernst. Dieser Tag hat mir vor einem Jahr alles genommen.
Außerdem: Welche Person, deren Augenringe so schwarz sind wie die sieben Tassen Kaffee, die sie intus hat, mag schon laute Menschen?! Oder schlimmer noch: gut gelaunte, kreischende Tourist*innen?
Aber um sechs Uhr morgens ist der Weg entlang der Themse eine fast idyllische Strecke für mein Skateboard und mich. Diesen Luxus habe ich nur meinem kaputten Biorhythmus zu verdanken. Ich habe bis um acht Uhr abends geschlafen und den Anfang der Nacht mit meinem Laptop und Photoshop im Bett verbracht. Um Mitternacht gab es Instantnudeln zum Frühstück, um vier Uhr bin ich mit dem Nachtbus zu einem 24 Stunden offenen Copyshop gefahren. Und nun trage ich eine Rolle mit Postern, Stickern und Zetteln mit mir herum.
Also alles in allem ein perfektes Beispiel für mein erfolgreiches Erwachsenenleben. Wenigstens ist es auf den Straßen still.
An Tagen wie diesen frage ich mich, wie es so weit kommen konnte. Jeder bleischwere Meter vorwärts fühlt sich gleichzeitig lächerlich klein und wie ein Marathon an.
Ich atme tief durch, doch selbst der immer stärker werdende Wind, der über die Themse fegt, ist feucht und schwer. Ich stelle mein Board an der Reling ab. An ihr hängt ein Mosaik, das die Aussicht auf die historische London Bridge beschreibt. Kurz halte ich inne und sehe mich um. Obwohl ich am King’s College London Sports Medicine studiere, war ich seit Ewigkeiten nicht mehr hier in der Gegend. Der einzige Kurs, zu dem ich mich hin und wieder geschleift habe, ist Introduction to Psychology, weil unsere Seminarleitung Xenia die schrecklichsten Witze der Welt drauf hat.
Hier am Ufer der Themse erkennt mein professionell geschultes Videografenauge Potenzial. Die Lichter der London Bridge schimmern auf der dreckigen Oberfläche des Flusses. Sie schmücken die Dämmerung mit Rot- und Blautönen, und in meinem Kopf gehe ich die Einstellungen durch, die ich bräuchte, um mit der Kamera in diesem Halblicht die perfekten Bokeh-Effekte einzufangen.
Gleichzeitig sieht meine Seele nur Schrott. Eine verschmutzte Stadt. Ein Ort, der trotz seiner Millionen Einwohner nur so von Einsamkeit trieft.
Aber ist nicht jeder Ort ohne dich einsam?
Ich wünschte, ich könnte einer dieser Menschen sein, der sich einredet, du seist irgendwo um mich herum. Im Wind, Wasser, was auch immer für ein Scheiß. Wenn das der Fall wäre, würde ich dir abraten, deine Existenz durch diesen Dreck zu ziehen. Mein Augenlid zuckt, ich rümpfe die Nase. Der einzige Ort, wo vielleicht noch etwas von dir übrig ist, ist am Fuße dieser beschissenen amerikanischen Klippe. Wobei selbst dein Blut sicher mittlerweile von irgendwelchen Insekten aufgeleckt wurde.
Du solltest dringend schlafen, River. Und deinen Zynismus unter Kontrolle bringen.
Wie ich mir allerdings immer und immer wieder beweise, ist Kontrolle absolut nicht meine Spezialität. Ich fluche und trete gegen das Schild vor mir. Das Einzige, was es mir bringt, ist ein dumpfer Schmerz im Knie.
Konzentrier dich. Du bist hierhergekommen, weil du eine Mission hast. Weil deine Zukunft von dem Erfolg dieser Aktion abhängt.
Ich drehe Wind, Wasser und nie dagewesenen Geistern den Rücken zu und wende mich zur Hay’s Galleria. Ich sehe zu einem Torbogen, stelle meinen Rucksack ab und versuche eines der Poster aus der Rolle zu ziehen, die mir der Verkäufer aus dem Night Shop aufgeschwatzt hat. Warum habe ich dazu nochmal ›ja‹ gesagt? Normalerweise bin ich gut darin, Menschen den verbalen Mittelfinger zu geben. Doch im Moment ist nichts normal. Nichts, wie es sein soll.
Nicht mal das Poster, das ich versuche herauszuziehen. Obwohl ich vorsichtig bin, reißt das Scheißding an der Kante ein. Wer gibt nun wem den Mittelfinger?
»Die wollen mich doch verarschen!«
Zehn Pfund. Zehn beschissene Pfund habe ich pro Poster bezahlt! Ich habe nur sieben gedruckt und kann es mir nicht leisten, eines davon zu verlieren.
Vielleicht meldet sich ja jemand aus Mitleid, wenn sie sehen, wie schlecht das Ding angebracht ist …
Elf gescheiterte Versuche und viel zu viel Klebeband später, ist das Poster in der richtigen Position.
Capturing Life’s Flow – River Trayl Cinematography. Dokumentarfilme, Hochzeiten, Veranstaltungen, Werbung.
Buche jetzt dein kostenloses Erstgespräch.
Mein eigenes, dürres Gesicht starrt mich an und ich hoffe, dass man mir das Lächeln abkauft. Hoffentlich bekomme ich keine Anzeige wegen Vandalismus. Doch das muss ich riskieren. Was sind schon mehrere Dutzend Pfund, wenn die Schulden in meinem Briefkasten die tausender Marke überschritten haben? Als Sirenen durch den Morgen jaulen, zucke ich zusammen. Ich sehe mich paranoid um und frage mich, ob ich die Dämonen der Stadt heraufbeschworen habe, als hätte ich dreimal Bloody Bullen gedacht.
Ich muss dringend weiter. Meine Strecke führt mich östlich, der Tower Bridge entgegen. Ich stoße mich schwungvoll mit dem Skateboard ab und muss noch im selben Moment mein Gewicht verlagern, da eine Windböe mich fast von den Füßen reißt.
Ein weiterer Beweis dafür, dass du nicht mehr hier bist. Du bist immer diejenige gewesen, die mir Stabilität und Halt gegeben hat. Und genau das hat dir das Leben gekostet: meine beschissene Unfähigkeit, die Kontrolle zu behalten.
Die Wolken spucken mir Regen ins Gesicht. Sie sind genauso angewidert von mir, wie ich es bin. Wer behauptet, die Zeit heilt alle Wunden, ist sicher nicht für den Tod seiner Schwester verantwortlich. Heute raubt Zeit mir nur den letzten Nerv und rennt mir davon. Der Regen nimmt zu, die Nacht neigt sich dem Ende zu.
Ich passiere die HMS Belfast und erkenne, wie sich die Tower Bridge wie ein schwebendes Schloss aus dem Dunst des Regens abhebt. Ihre zwei Türme ragen dem unbarmherzigen Himmel entgegen und lassen mit ihrem Licht die dunklen Wolken leuchten. Selbst ich kann die gotische Architektur wertschätzen. Die Steine tragen Geschichte mit sich, Eleganz, wie sie heute nicht mehr erschaffen wird, und ich wünschte, London hätte mehr von seiner alten Magie behalten. Stattdessen wird ein Hochhaus aus Metall und Glas nach dem nächsten gebaut. Die Tower Bridge, die einst eines der größten und beeindruckendsten Bauwerke der Stadt war, geht nun unter, wird klein gehalten von Fortschritt, während sie im Suff verloren geht.
Vielleicht sollte ich mich nochmal bei meiner Therapeutin melden. Mehr Sympathie für Brücken als für Menschen zu empfinden, ist sicherlich nicht gesund. Genau diese fragwürdige Empathie wirft mich fast vom Board. Ich rudere mit den Armen, springe ab, renne ein paar Schritte, damit ich abbremsen kann. Mein Board überschlägt sich, schlittert und bleibt auf dem Asphalt liegen.
Ich will meinen Augen nicht trauen. Sofort beschleunigt sich mein Atem, trotzdem bekomme ich kaum Luft. Meine Hände zittern. Ich balle sie zu Fäusten, in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird.
Es wird nicht besser.
Mein Blick schweift erneut nach oben und katapultiert mich zurück zu dem Tag vor einem Jahr.
Dort oben klettern zwei Menschen über das Metall, was bei diesem Wetter fürchterlich rutschig sein muss. Es ist genau wie damals in Kalifornien. Ein plötzlicher Umschwung im Wind. Nässe, wo trockener Stein sein sollte. Eine Lebensgefahr für jeden, der es wagt, die Natur herauszufordern. Die Panik in meiner Brust vermischt sich mit Galle. Sie schmeckt wie die Luft am El Capitan. Wie der Regen, der alles zerstört hat. Wie der Stein, der dich nicht gehalten hat.
»River, du blutest! Warte. Ich helfe dir. So kannst du nicht weiterklettern.«
»Nein! Bleib auf der Route! Wir müssen einen sicheren Part finden, um dir eine Sicherung anzulegen. Du kannst bei dem Regen nicht weitermachen! Ich schaffe das allein! Du musst auf dich aufpassen!«
»Keine Sorge, Riv. Auf mich passen die Sterne auf.«
Versprechen, die nicht gehalten werden konnten. Worte, die nicht deine letzten hätten sein dürfen.
Ich möchte schreien. Doch genau wie damals starre ich nur, während ich zusehen muss, wie dein Lächeln sich in Ungläubigkeit verwandelt und du dich plötzlich immer und immer und immer weiter von mir entfernst.
Der Regen spuckt mich an und verachtet mich. Hasst mich, wie ich mich selbst hasse. Wie ich die Menschen hasse, die dort klettern.
Polizeiwagen rasen auf die Brücke zu und versperren die Straße. Selbst von hier unten kann ich sehen, wie sich Schaulustige im Regen versammeln. Es widert mich an. Sie glotzen, jubeln, statt auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, was passiert, wenn einer der Kletterer fällt.
Ich muss hier weg. Weg von diesen Arschlöchern. Weg von den Erinnerungen an El Capitan und an dich. Aber ich bin wie paralysiert. Der Regen durchnässt mich und meinen Rucksack. Er zerstört die Poster, all das Geld und damit meine letzte Hoffnung auf neue Kund*innen.
Zu dem Lärm der Polizist*innen gesellt sich das Schreien eines Rettungswagens. Ein Geräusch, das mich wieder das sehen lässt, was damals von deinem Körper übriggeblieben ist. Ich hatte noch von der Klippe die Emergency Services über Satelliten benachrichtigt, in der lächerlich naiven Hoffnung, sie könnten dich retten. Doch stattdessen war da nur ein lärmender Hubschrauber, aus dem sich das Rettungsteam abseilte. Genau wie ich, der so schnell die Felswand heruntergeschlittert ist, wie jemand, der sich danach sehnt, dir hinterherzufallen. Als ich unten ankam, erkannte ich deine Kleidung.
Weiß und Rot. Chalk und Blut.
Und irgendwo dazwischen deine Haare, dein Körper, das Ende deiner Existenz. Ich zittere. Oder ist es die Kälte, die mich auffressen will?
Reiß dich zusammen. Du musst hier weg und dein Werbematerial retten. Dich retten.
Es gibt keine Rettung für mich.
Ein Knall und ich schrecke auf. Wie von selbst springt mein selbstzerstörerischer Blick zurück zur Tower Bridge. Ein riesiges, neongrünes Banner flattert von der mittleren Fußgängerbrücke, die die beiden Türme verbindet.
Terra Drill kills!
ziert das Banner.
Terra Drill tötet.
Ein weiterer Knall.
Die beiden Kletterer thronen über ihrem Werk und halten Rauchgranaten über ihre Köpfe. Rote und grüne Wolken werden vom Wind und Regen über den anbrechenden Tag getragen. Wenn die ganze Scheißaktion nicht so fürchterlich rücksichtslos wäre, hätte das sogar ein verdammt cooles Bild oder Video abgeben können. Doch nichts, absolut nichts, kann die unnötige Gefahr rechtfertigen, in der die Kletterer sich gebracht haben.
»Woah! Sieh dir das an, Mate!«
»Megacool!«
»Schnell, starte einen Livestream.«
Vollkommen taub rappele ich mich auf und schnappe mir mein Board. Ich greife in meine Jackentasche und ziehe eine durchgeweichte Visitenkarte heraus.
»Shit, der eine Bulle hat ihn zu fassen bekommen!«
»Nimm das auf. Nimm das auf«, sagt ein Kerl zu seinem Kumpel, der das Handy auf den Tower richtet. Diesmal schaffe ich es, wegzusehen. Ich trete auf die Kerle zu und drücke dem Sprecher meine Karte gegen die Brust.
»Was zur Hölle, Dude?«
»Falls ihr mal einen richtigen Kameramann braucht«, erwidere ich nüchtern, lasse mein Board auf den Boden knallen und drehe dem Geschehen den Rücken zu. Fliehe den Weg zurück, den ich gekommen bin, ohne zu beenden, was ich angefangen habe.
Eine weitere gescheiterte Mission.
Kontrollverlust, der nicht länger hilfreich ist, sondern mich meine letzte Hoffnung kostet.
In nur wenigen Stunden erwarten unsere Eltern, dass ich bei der Trauerfeier eine Rede für dich halte. Aber wenn etwas immer noch am Fuß des El Capitan begraben liegt, dann ist es mein Wille, ohne dich weiterzuleben.
Kapitel 3: Siebzehn Jahre Freundschaft und ein Dutzend Insider
Atlas
»Shit«, murmle ich mit dem Gesicht im Fell meines Teppichs und fange ungewollt an zu lachen. Ächzend setze ich mich auf und versuche im Halbdunkeln zu entziffern, über was ich gestolpert bin. Der Aufprall hat meine verstopften Ohren gelöst und nun fließt mir die halbe Themse aus dem Schädel. Angewidert wische ich mir die langen, nassen Haare aus dem Gesicht. Ach, da war ja was. Kurz bevor ich heute Morgen zur Tower Bridge aufgebrochen bin, habe ich hastig das monatliche Carepaket meiner Mutter in das Apartment geschoben und vergessen. Es sieht aus wie immer: etwas ramponiert, mit tausend Briefmarken aus El Chorro, dem Dorf aus Malaga, in dem ich geboren wurde und in das meine Eltern vor einigen Jahren zurückgekehrt sind.
Ein eingehender Anruf kommt rein und ich beschließe, dass das Paket warten kann.
»Sam und ich sind in einer halben Stunde da«, ist das Einzige, was Lex sagt, bevor dey direkt wieder auflegt. Obwohl ich nichts anderes von Green Vanguards Founder erwarte, grinse ich, als eine Sekunde später eine Nachricht von dem erscheint:
Lex: Sorry, ich hasse es, zu telefonieren. Wollte dich nicht abwürgen. Freue mich auf dich. / Aufgeregt und erwartungsvoll.
Am Anfang unserer Freundschaft war es mir merkwürdig und überflüssig vorgekommen, dass Lex kenntlich macht, wie deren Nachrichten zu verstehen sind. Dafür verwendet dey niemals Emojis, da diese je nach Internetkultur und Altersgruppe zu Missverständnissen führen.
Mittlerweile mag ich Lex’ Art. Mit dey zu schreiben ist erfrischend ehrlich und unkompliziert. Nach der letzten Green Vanguard Aktion im Februar, bei der ich zum ersten Mal ein Hochhaus im Finanzdistrikt bestiegen habe, sind unsere nächtlichen Gespräche immer häufiger vom Umweltschutz in eine private Ecke gerutscht. Seit Forest gestorben ist, blockt Sam ab und redet nur noch über Extremsport und das Social Media Business mit mir. Meistens hocken wir in meiner Bude und brüten über TikTok Content oder trainieren. Ich weiß, dass er seine Zeit braucht, aber so langsam vermisse ich ihn als Freund. Als Kletterfreak kann ich echt den ganzen Tag über Felsspalten und Grifftechniken diskutieren, aber es tut auch mal gut, wenn Lex mich aus meiner Bubble holt und sich erkundigt, wie die Nacht mit meiner letzten Eroberung war, wie meine Ernährungsumstellung läuft – sehr mies – oder bei welcher Folge True Detective ich bin. Wenn ich mal einen Abend Zeit habe, zocken wir online oder hängen schweigend im Discordserver ab, während Lex den Abwasch macht. Freundschaft eben.
Ich stelle mich unter die Dusche. Während Sand und Schlamm in langen, braunen Schlieren in den Abfluss wirbeln, kann ich nicht aufhören, meinen linken Knöchel zu inspizieren. Der Bulle hat ihn beinahe als Souvenir behalten. Jetzt, wo das Adrenalin langsam meine Glieder verlässt, drängt sich der pochende Schmerz in den Vordergrund. Ich lasse den Kopf hängen, verteile halbherzig das Shampoo in meinen langen Haaren, kratze gedankenversunken den Sand von der Kopfhaut. Mein Gehirn bleibt in einer Endlosschleife kleben, in der ich jeden Schritt der heutigen Aktion durchgehe. Das Urteil ist vernichtend: Der Free Solo-Aufstieg der Tower Bridge war nicht gut genug. Ich ertrage es nicht. Mich so kurz vor Sams und meiner Klettertour zu verletzen, ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Zugegeben, es gibt nie einen guten Zeitpunkt, um sich den Fuß zu verletzen. So eine Kleinigkeit wird mich aber nicht aufhalten, schon gar nicht, wenn es die zertifizierte I.I.I. Atlas-Methode gibt: Ignorieren, Ibuprofen, Im Notfall amputieren. Für mein verletztes Ego wegen dieses erbärmlichen Abgangs gibt es leider keine Pille. Ich hoffe ernsthaft für diese bedrohten Robbenbabys, dass Sams Video so richtig reinhaut.
»Wenn du mich jetzt sehen könntest, Forest«, murmle ich und halte das Gesicht unter den Wasserstrahl. Der Gedanke an meine beste Freundin ist tröstlich. Sie hätte das mit dem Fuß zu einem Dauerwitz gemacht und am Ende auf ihrem iPad einen hässlichen Button designt, nur um mich zu ärgern. Sowas wie: Wenn du um 6 Uhr morgens als Cop für Recht und Ordnung sorgst und als Dank einen Fuß bekommst.
Ich trockne mich ab, öffne die Fenster, um Licht in das Appartement zu locken. In der Ferne schlägt eine Kirchturmuhr Zwölf. Der Himmel ist dunkel verhangen.
»Lass uns einen Deal machen, du schickst mir Sonne und ich trage für dich ein Hemd, Deal?«, sage ich und blinzle erwartungsvoll in die Gewitterwolken. Nichts geschieht.
»Wenn du mir so die kalte Schulter zeigst, werde ich mir den Bart abrasieren.« Wie auf Kommando erhellt ein Blitz den Himmel. Ich lache und streife über meinen Bart, der tatsächlich etwas zu lang ist.
»Trimmen ist aber okay?«, frage ich und bekomme ein Donnergrollen als Antwort.
***
»Sei mir nicht böse Atlas, aber dein Zuhause sieht aus wie ›Schöner Wohnen‹ für Serienmörder*innen«, sagt Lex, sieht sich um und verschränkt die Arme, als müsste dey sich vor der minimalistischen Einrichtung und der grau-weißen Farbpalette schützen. Dey ist das erste Mal bei mir, sonst schreiben wir uns oder hängen in Discord ab.
»Das sage ich ihm auch andauernd«, erwidert Sam, der immer noch in den nassen Kletterklamotten steckt und meinen 3.000 Pfund Teppich volltropft. Seine blonden Haare trägt er ordentlich zurückgekämmt und erinnert mit dem überheblichen Grinsen an einen schmierigen Staubsaugervertreter.
»Das ist modern. So leben halt erfolgreiche Leute«, erwidere ich, klinge aber selbst in meinen Ohren nicht ganz überzeugt. Lex mustert mich amüsiert, betrachtet dann meinen Eingang, das offene Wohnkonzept und die teuren weißen Möbel wie bei einer Ausstellung.
Alles an Lex ist auf den ersten Blick laut, mit starkem Kontrast und genauso starker Meinung. Dey ist ein Klecks roter Farbe auf der eintönigen Leinwand, die mein Appartement darstellt. Die Haare, die Jacke und die Kontaktlinsen leuchten rot. Selbst deren Jutebeutel hat was zu sagen: Eine brennende Erde und darunter der Schriftzug »I burn for climate crisis«. Den Beutel hat Lex designt und man konnte ihn als Goodie bei einer Spendenaktion von Green Vanguard erwerben. Mit dem Erlös hat dey den ersten Mitarbeitenden der Klimaaktivistengruppe eingestellt.
Sam legt Lex eine Hand auf die Schulter, lehnt sich vor und flüstert übertrieben laut. »Atlas hat das Apartment so einrichten lassen, um seinen Daddy zu beeindrucken.«
Die beiden sehen mich grinsend an. Obwohl Sam recht hat, will ich mich verteidigen, beiße mir dann aber auf die Zunge. Mein Vater kann es nicht ausstehen, dass ich mein Leben mit dem Klettern und meiner Arbeit als Content Creator finanziere. Aber er ist auch ein Mann, der seinen Erfolg zur Schau stellt, und als er mich vor ein paar Monaten besucht hat, war er so etwas wie beeindruckt. Zum ersten Mal, seitdem ich volljährig bin, gab es keine Diskussion über meine Zukunft. Sam deutet auf das zwei Meter hohe abstrakte Gemälde, das hinter der Ledercouch hängt. Schwarze Striche und Kreise auf weißem Hintergrund. »Drei Mal darfst du raten, wie viel er dafür ausgegeben hat«, sagt er gehässig. Was für ein kleines Wiesel dieser Bastard doch ist. Das nächste Mal, wenn wir campen, werde ich ihm die Augenbrauen mit Kaltwachs entfernen.
»Es ist von einem lokalen Künstler«, verteidige ich mich, weiß aber, dass ich auf verlorenem Posten kämpfe.
»Er hasst es«, sagt Sam immer noch in diesem gespielten Flüsterton. Das habe ich ihm im Vertrauen erzählt. Wofür braucht man Feinde, wenn man solche Freunde hat? Die beiden drehen eine Runde und bleiben vor meinem künstlichen Kamin hängen. Ja, der Kamin ist nur zur Deko da, na und?
»Wir sollten ihn nicht verärgern, sonst weidet er uns aus und hängt uns zu den Trophäen«, sagt Lex in demselben Flüsterton und deutet auf die Wand über dem digitalen Feuer.
Über ihm hängen eingerahmte Zeitungsartikel über mich, meine Zertifikate als Bouldertrainer, Auszeichnungen und drei Sportmagazincover in Übergröße. Auf meinem Lieblingscover des Magazins »Climber« hänge ich oberkörperfrei in einer Felsspalte. Die Überschrift lautet
Sie nennen ihn Flash Wizard
und darunter
Atlas Cruzado (19) flasht als Erstes den unbezwingbaren Perfecto Mundo.
Das war die erste Coverstory über mich und meine beste Disziplin, dem Flash Climbing, bei der man eine Wand beim ersten Mal bezwingt, ohne die Route jemals geklettert zu sein. Nach dem Free Solo, bei der man komplett ohne Hilfsmittel klettert, ist es die intensivste Art, eine Kletterroute zu erleben.
Der Roast von Lex und Sam wegen meiner Einrichtung ist endlich vorbei und wir machen das, wofür die beiden eigentlich hier sind. Sam überträgt das Videomaterial von heute Morgen auf Lex’ Laptop.
»Das Hauptvideo ist nicht einmal online, aber die Petition kommt jetzt schon ins Rollen«, stellt Lex fest. »Die Petition war gestern bei etwa 900 Unterstützer*innen und gerade haben wir die 10.000 geknackt.«
Tatsächlich. Ich kann mir das Grinsen nicht verkneifen, als alle paar Sekunden ein neuer Name im Live-Feed der Petition auftaucht. Lex’ Augen funkeln. Es ist eine Seltenheit, Lex so zufrieden zu sehen. Meistens runzelt dey die Stirn, als wäre dey immer in tiefgründigen Gedanken versunken – was durchaus sein kann. Es gibt niemanden, den ich so respektiere wie Lex. In wenigen Jahren hat dey es geschafft, Green Vanguard neben dem Studium und ohne Mittel aus dem Boden zu stampfen. Gerade setzen wir uns dafür ein, dass das Fracking Projekt im Naturschutzgebiet Lincolnshire von der Firma Terra Drill gestoppt wird. Wenn es eine Person gibt, die das erreichen kann, dann ist es Lex. Und wenn dey selbst dort hinfahren muss, um den Bohrkopf eigenhändig aus der Erde zu ziehen.
Sam und ich klettern seit einigen Monaten für Green Vanguard und haben an den unmöglichsten Stellen unsere Message an Wände gesprayt. Manchmal fühle ich mich wie Spiderman, nur ohne den arschbeißenden Ganzkörperanzug und mit einer schöneren Kinnpartie.
»Was macht dein Fuß?«, erkundigt sich Lex und deren Augen wandern zu meinem geschwollenen Knöchel.
»Woher weißt du davon?«, frage ich ausweichend.
»Hast du die Videos auf Twitter nicht gesehen? Dein Themsensprung hat uns die meisten Unterstützer gebracht.«
»Tut weh«, sage ich und will eigentlich nicht darüber nachdenken, was dieser verdammte Polizist heute Morgen angerichtet hat.
»Ich hoffe, die Seelöwen zeigen sich etwas dankbar für unseren Einsatz«, wirft Sam ein.
»Kegelrobben«, verbessert ihn Lex. Das Fracking-Gebiet, welches Terra Drill im Auge hat, ist eins der letzten Reservate für Kegelrobben in Großbritannien. Wir setzen uns dafür ein, dass die Politik einen Deal unterschreibt, der das Gebiet auf unbestimmte Zeit unantastbar für Scheißvereine wie Terra Drill macht.
»Was auch immer«, sagt Sam und wuschelt sich durch die blonden Haare. »Die viel wichtigere Frage ist, ob du mit der Verletzung klettern kannst.«
Ich rotiere demonstrativ den Fuß. Ein spitzer Stich schießt mein Bein entlang. Ibuprofen wird es richten.
»Alles bestens«, gebe ich zurück und zeige mit beiden Daumen auf mich selbst. »Dieses Aschenputtel wird problemlos auf dem nächsten Ball tanzen.«
»Dann hoffen wir mal, dass du nicht deine Glasschuhe verlierst«, brummt Sam.
»Wo wir gerade von Bällen und Tanzen reden. Wann hättet ihr denn Zeit, um was Neues zu starten?«, fragt Lex.
»Vor unserer Klettertour sieht es schlecht aus«, antwortet Sam und bemüht sich, bedauernd zu klingen, doch ich kann sehen, dass er es alles andere als schade findet, erstmal nicht mehr bei Green Vanguard dabei zu sein.
»Spätestens im Sommer«, spezifiziere ich seine Aussage.
»Echt schade. Trotzdem danke, dass ihr das für uns gemacht habt. Vor allem heute.« Lex spielt auf die Gedenkfeier an, die am Abend stattfindet.
Denn es ist ein Jahr her, seit wir Forest verloren haben.
Nachdem Lex gegangen ist und Sam unter meiner Dusche steht, erlaube ich mir ein paar Minuten auf Twitter. Mein Feed wird direkt mit Nachrichten über die Tower Bridge geflutet. Die Hashtags #GreenVanguard und #SealTheDeal, der offizielle Hashtag für die Rettung der Robben, trenden. Es gibt ein richtig gutes Video, in dem Sam und ich das Banner hissen und dann alles im farbigen Nebel abtaucht. Es sieht episch aus und für einen kurzen Moment finde ich es schade, dass niemand erfahren wird, dass ich das war.
Wenig überraschend finde ich auch zwei Clips von meiner Flucht. Der erste ist nur wenige Sekunden lang und zeigt, wie ich springe und »Parkour!« rufe. In dem Moment habe ich mich echt cool gefühlt, aber von unten gefilmt sehe ich gehetzt und verwirrt aus. Weniger wie ein Spezialagent und mehr wie ein billiger Räuber aus einer Comedyshow. Das andere ist ein längeres Video und zeigt den Moment, in dem der Cop mich zu fassen bekommt und ich ungelenk in der Themse lande. Wie nicht anders zu erwarten, hat auch jemand diesen Videoausschnitt auf TikTok geteilt und mit dem »It was this moment he knew he fucked up«-Sound hinterlegt.
Wenn man es objektiv betrachtet, dann ist das Video wirklich witzig. Ich öffne die Kommentare und erwarte eigentlich eine Welle an guten Wortwitzen und Zuspruch für Green Vanguard. Stattdessen scrolle ich durch ein Meer aus Hass. Mir wird kalt.
Klimaleugner nennen mich einen Ökoterrorist. Andere werfen mir vor, Bill Gates hat mich gekauft. Selbsternannte Sportexperten zerreißen sich das Maul, nennen mich einen Amateur. Die meisten Kommentare bestehen aber einfach nur aus einer endlosen Reihe an Clown Emojis. Immer und immer wieder.
He is a clown.
»Hör auf, dich zum Narren zu machen, und fang endlich etwas Richtiges mit deinem Leben an.« Ich höre die Stimme meines Vaters genau so klar wie an jenem Tag. Ostern vor zwei Jahren. Wir sitzen am Esstisch von Forests Eltern, bei denen ich gewohnt habe, während ich auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung war – sehr zur Missbilligung meiner leiblichen Eltern.
Vater schmeißt mein neues Trainerzertifikat mit so viel Verachtung auf den Tisch, als wären wir eine Königsfamilie und ich hätte ihnen die Geburtsurkunde meines Bastards zugeschoben. Das Glas des Bilderrahmens, den Forest mir geschenkt hat, zerspringt. Vater sieht mich nicht mal an, als Jodie Trayl ihn bittet zu gehen. Er hat sich in ihrem Esszimmer eine Zigarette angemacht und den Kopf geschüttelt. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, nimmt der Druck in meiner Brust und das Brennen in meiner Kehle zu. Ich bin nicht wütend auf meinen Vater. Ich schäme mich.
»Atlas, Camilla ist bald da. Zieh dich an«, ruft Sam aus dem Bad und reißt mich aus den Gedanken. Immer noch befremdlich, dass Sam seine Mutter bei ihrem Namen nennt, seitdem sie unsere Agentin geworden ist. Scheiß auf die Hasskommentare. Es gibt zwei Arten von Leuten. Die, die sich was trauen, und die, die sich das Maul darüber zerreißen, und ich weiß genau, zu welcher Sorte ich gehöre.
Ich öffne den Einbauschrank in meinem Schlafzimmer. Auf der einen Seite sind meine Klamotten, die nicht einmal ein Drittel des Schranks füllen. Auf der anderen stapeln sich meine Schallplatten, Bücher, Ordner und Kisten mit Erinnerungen. Den Kram, der mich ausmacht, aber nicht in meine Wohnästhetik passt. Aus dem obersten Regal hole ich ein Stück Stoff, das so übersäht ist mit Pins, dass man nur erahnen kann, dass es sich um ein Stück Militärrucksack handelt. Forests Rucksack mit ihren selbstdesignten Buttons. Die Karikaturen und Sprüche sind so random, dass man nicht einen einzigen Button versteht, wenn man nicht dabei gewesen ist. Zehn Jahre Freundschaft reduziert auf zwei Dutzend Insider. Ich picke fünf Favoriten heraus.
Mein Lieblingspin ist neon-pink und zeigt ein aggressives Opossum auf dem
I didn't choose the rat life, the rat life chose me
steht. Eine Anspielung auf unsere erste gemeinsame Reise nach Kanada. Sam ist mit einem Opossum im Schlafsack aufgewacht. Das Tier war starr vor Schreck und hat ihn erst gebissen, als er es als Ratte beschimpft hat. Für Forest und mich war direkt klar, dass das Opossum nie vorhatte, Sam zu attackieren, bis dieser es in seiner Ehre verletzt hat.
Ich versuche die übrigen Pins wieder zurück in den Schrank zu legen, da fallen mir alte Zeitungen entgegen.
Freeclimberin stürzt 1000 Meter in den Tod
Todesberg El Capitan: Ein Traum vom Rekordversuch zerplatzt.
Schock: TikTok-Star Forest Trayl (23) ist tot.
Hunderte nehmen Abschied von Astra Vertice-Ikone in London.
›Sie ist gestorben, bei dem was sie liebt‹ – Atlas Cruzado über den Tod von Forest Trayl.
Die letzte Schlagzeile zieht an meinen Mundwinkeln und ich lächle. Ich bin genau wie Forest. Wir klettern nicht, um zu leben. Sondern wir leben, um zu klettern.
Beflügelt ziehe ich ein sonnengelbes Hemd an und stecke mir Forests Pins an die Brusttasche über meinem Herzen. Heute wird das Leben gefeiert.
Weil Sam noch nicht fertig ist, gebe ich mir einen Ruck und öffne das Carepaket meiner Mutter. Zuckerbrot und Peitsche erwarten mich. Darin sind Süßigkeiten und Snacks aus der Heimat, wie gesalzene Sonnenblumenkerne, Cheetos und geröstete Maiskörner, genauso wie Flyer und Prospekte für Unis aus Spanien, Großbritannien und Amerika. Mittlerweile frage ich mich, ob die Leute an den Unis und Colleges meine Mutter kennen, weil sie sich die Flyer jedes Semester altmodisch per Post nach Spanien schicken lässt.
Was hat Forest immer gesagt? »The Devil works hard, but your mum works harder.«
»Meine Mut– Camilla wartet unten«, sagt Sam und scheint sich daran erinnern zu müssen, dass Camilla auch sein Boss ist. Er lehnt im Türrahmen und klopft ungeduldig mit den Fingern gegen seinen Arm. Er hat das dunkle Tarnoutfit durch eine helle, gestärkte Leinenhose mit Bügelfalten und ein babyblaues Hemd mit kurzen Ärmeln und kleinen Sonnenblumen eingetauscht. Die Haare hat er weiterhin zurückgekämmt, ist aber von einem Staubsaugervertreter zu einem Geschäftsmann an der Côte d’Azur aufgestiegen. Forest hätte das Outfit an ihm gefallen.
»Kann losgehen!«, entgegne ich. Sams Blick wandert an mir herab, er presst die Lippen aufeinander, sein Ausdruck ist hart. Die einzige Regung ist ein leichtes Zucken über seiner buschigen Augenbraue.
»Warum hast du sie?«, sagt er und fixiert dabei die Buttons auf meiner Brust.
»Forests Mum hat sie mir gegeben«, antworte ich mit einem lässigen Schulterzucken, als würde er wirklich nur wissen wollen, wie ich in den Besitz der Buttons gekommen bin und nicht warum Forests Mum sie gerade mir und nicht ihm anvertraut hat. Kurz sieht er so aus, als würde er noch etwas sagen wollen, dann schüttelt er den Kopf.