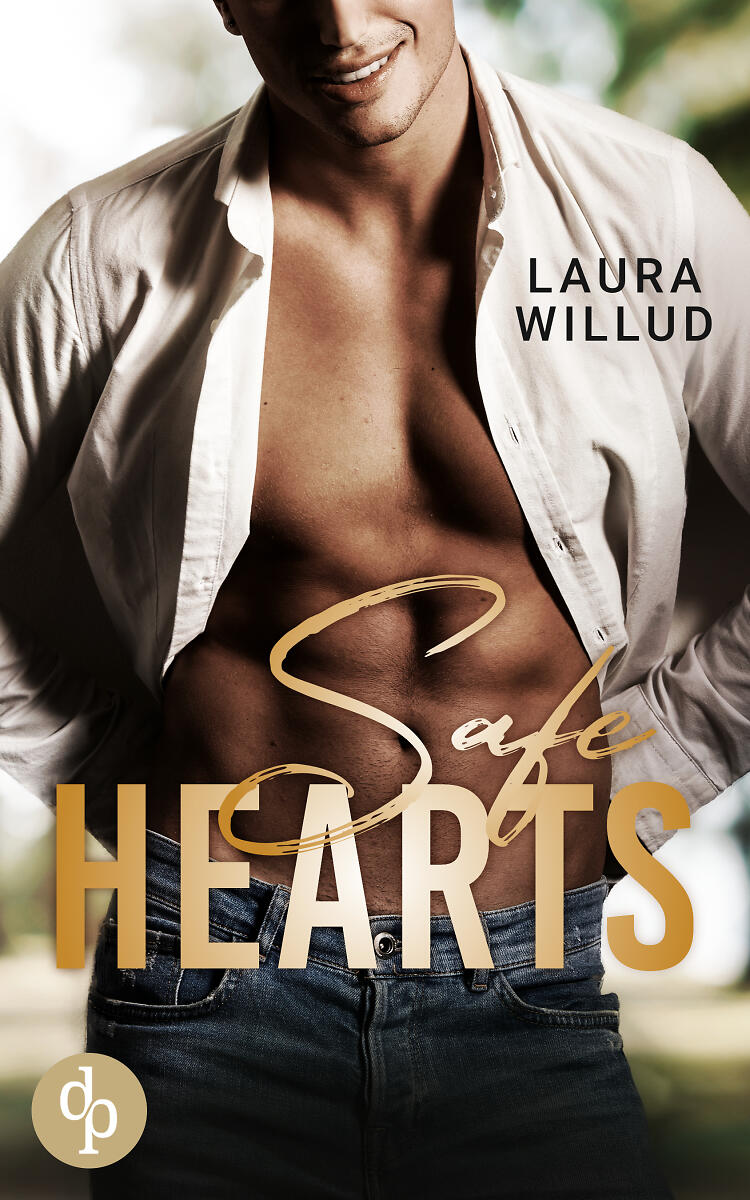Prolog – Kayla
Jeder sollte diese eine Person in seinem Leben haben, der man nahezu jedes Gefühl und jeden Gedanken vom Gesicht ablesen kann. Zu wissen, was in einem anderen Menschen vor sich geht, fühlt sich besonders und irgendwie exklusiv an. Mein großes Privileg ist es, diese Person schon mein ganzes Leben zu kennen. Ihr heimliches Grinsen und die Farbe ihrer Wangen, die jetzt den Ton des Virgin Sunrise, der vor ihr steht, angenommen haben, sagen mir alles.
„Du hast jemanden kennengelernt“, stelle ich augenbrauenwackelnd fest, woraufhin meine Schwester nervös beginnt, die Orange an ihrem Cocktailglas zu drehen. „Und es entwickelt sich zu etwas Ernstem?“, frage ich grinsend, auch wenn ich die Antwort bereits kenne. Hannah ist nicht der Typ für lose Bekanntschaften und Bettgeschichten ohne Emotionen. Sie schaut sich etwas unsicher in der Bar mit den gedimmten Lichtern um, als wolle sie sichergehen, dass uns niemand belauscht. Was unnötig ist, denn wir sind mitten in der Philadelphia Center City – sie könnte aufstehen und den Namen der mysteriösen Person in den Raum hineinrufen, es würde kaum jemand überhaupt nur den Kopf in unsere Richtung drehen.
„Du hast recht“, gibt sie zu und verbirgt ihr Gesicht etwas hinter ihren blonden Locken. „Ich habe ihn wirklich sehr gern.“
„Das ist toll, Schwesterherz!“, antworte ich und proste ihr mit meinem Glas zu, das schon fast leer ist. „Kenne ich ihn?“, frage ich weiter und versuche nebenbei mit dem Kellner Blickkontakt herzustellen. Es dauert einen Moment, bis Hannah antwortet. Wäre ich nicht mit der Bestellung meines nächsten Cocktails beschäftigt gewesen, hätte ich bemerkt, dass sich diese eine Besorgnis-Falte auf ihrer Stirn gebildet hat.
„Ja … du kennst ihn tatsächlich. Mehr oder weniger“, nuschelt sie. Ich wende mich ihr wieder ganz zu und studiere ihr Gesicht, das meinem so ähnlich und dann auch wieder ganz anders ist. Die Augen blau statt grün. Das Haar ein wenig heller, die Locken deutlicher, definierter, die Lippen etwas voller. Die Gesichtszüge dennoch fast identisch, ein Abbild unserer Mutter. Auffordernd und mit einem seltsam ungewissen Gefühl signalisiere ich ihr, weiterzureden. Meine große Schwester atmet hörbar aus und sieht mir dann fest in die Augen, als müsse sie sich zwingen, nicht wegzuschauen. Ich kann förmlich sehen, wie sie innerlich bis drei zählt, ehe sie ihren Mund öffnet.
„Es ist Manuel … Valentini“, bricht sie schließlich heraus und mein Gehirn braucht einen Moment, um diese Information zu verarbeiten, einzuordnen, bis die Erkenntnis auf mich niederschmettert, wie ein plötzlicher Hagelschauer. Mein Gesicht scheint keine Regung zu zeigen, denn sie fährt nach einer kurzen Pause fort. „Der Bruder von –“
„Matteo“, beende ich ihren Satz mit fester Stimme, die so gar nicht widerspiegelt, was wirklich in mir vorgeht. Matteo – mein erster fester Freund. Matteo – der Junge, mit dem ich mein erstes Mal haben wollte. Matteo – die erste Person außerhalb meiner Familie, der ich gesagt habe, dass ich sie liebe. Matteo – der mir das Herz gebrochen hat. In einer Welt voller Männer und Frauen sucht sich meine Schwester ausgerechnet den großen Bruder von Matteo fucking Valentini aus.
„Das war wirklich nicht geplant, Kiki.“ Sie benutzt den Spitznamen, den nur sie verwenden darf, absichtlich, um mich zu besänftigen, als wüsste sie nicht, dass ich sie immer durchschauen werde. Hörbar atme ich aus und nehme den Pappdeckel zwischen Daumen und Zeigefinger, lasse ihn auf dem Tisch drehen, während ich versuche, meine Gedanken zu sortieren.
„Er ist nicht so ein Arschloch wie sein Bruder, nehme ich an?“, frage ich, den Blick noch immer auf das quadratische Stück Pappe gerichtet.
„Das absolute Gegenteil von einem Arschloch“, antwortet Hannah, und ohne hinzusehen, erkenne ich das Lächeln in ihrer Stimme. „Außerdem hat auch Matteo sich verändert, sagt Manuel zumindest“, ergänzt sie vorsichtig.
„Einmal Arschloch, immer Arschloch“, entgegne ich bemüht kühl und trotzig.
„Es ist jetzt wie lange her? Vier Jahre? Ihr wart Kinder damals, der Charakter noch lange nicht fertig geformt. Du bist doch auch nicht mehr dieselbe Kayla, die du mit 15 Jahren warst.“
Sie hat recht, ich bin nicht mehr dieselbe. Und Matteo Valentini hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen. Er hat aus der fröhlichen, naiven Kayla, die argwöhnische Realistin mit den hohen Mauern geschaffen, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken.
Doch dies sollte das Glück meiner Schwester nicht schmälern, denn sie hat es verdient. Sie hat alles Gute auf dieser Welt verdient.
„Na ja, sehen muss ich ihn ja trotzdem nicht“, antworte ich und versuche mich an einem Lächeln.
„Das stimmt. Wahrscheinlich erst, wenn Manuel und ich irgendwann vor den Traualtar schreiten“, gibt sie lachend zurück.
„Ok, wow. Ihr seid noch nicht einmal offiziell ein Paar und du planst schon die Hochzeit – wie kann der Mensch, der mir genetisch gesehen am ähnlichsten ist, so ein Träumer sein?“
„Abwarten“, murmelt sie und beißt genüsslich in die Orangenscheibe, während meine Gedanken zu dem Sommer, in dem ich 15 Jahre alt war, abschweifen.
„Frischgepresster Orangensaft?“
„Was hast du denn erwartet, wenn ich dich zu einem Frühstück im Park einlade?“
„Saft aus einem Plastikkanister“, antworte ich grinsend und kann mein Glück wieder einmal nicht fassen. Matteo ist perfekt. Wir sind perfekt. Dieser ganze Sommer ist perfekt.
„Und ich dachte, meine Freundin würde mich besser kennen.“ Mit gespielter Empörung fasst er sich an die Brust. Meine Freundin. An den Klang dieser Worte habe ich mich auch nach sechs Monaten noch immer nicht vollständig gewöhnt. Sie treiben meinen Herzschlag nach wie vor in die Höhe. Ich lehne mich zu Matteo nach vorne, um ihn zu küssen. Sein Lächeln an meinen Lippen bringt meine Brust vor lauter Glück fast zum Platzen.
„Ich liebe dich, Matteo Valentini.“
„Und ich liebe dich, Kayla Scott.“
Die sanfte Septembersonne kitzelt auf meiner Haut und ich genieße alles. Die Wärme, unser Frühstück, die leisen Stimmen um uns herum im Park und vor allem die Anwesenheit meines Freundes. Es tut gut, sich bei jemandem so fallen lassen zu können, sich so geliebt zu fühlen. Jemandem voll und ganz zu vertrauen. Matteo war mein erstes Date, mein erster Kuss, der erste Junge, dem ich gesagt habe, dass ich ihn liebe. Schon eine Weile denke ich darüber nach, was der nächste Schritt wäre.
„Matteo?“
„Mhm“, nuschelt er und schluckt den Rest seines Bagels hinunter. Im Anschluss setzt er das Glas mit dem köstlichen Orangensaft an seine Lippen. Den nächsten Satz auszusprechen, kostet eine Menge Überwindung, doch ich will es endlich loswerden.
„Ich … ähm … mein erstes Mal … es soll mit dir sein. Natürlich nicht genau jetzt und hier. Aber … bald?“ Matteo hat scheinbar mit vielem gerechnet – damit jedoch nicht. Er verschluckt sich an dem Saft und beginnt zu husten. Für einen Moment denke ich, er würde tatsächlich ersticken und ich hätte ihn auf dem Gewissen. Todesursache: meine Direktheit. Doch dann fängt er sich schließlich. Seine Augen mustern mich überrascht und ich halte die Luft an. War es dumm, das zu sagen?
„Das wünsche ich mir auch“, erlöst er mich endlich und ich atme erleichtert auf.
„Gut. Dann wird es irgendwann so sein.“
Ich habe mich geirrt.
Denn bevor es dazu kommen konnte, dass sich auch dieser Schritt in die bilderbuchartige Liste unserer ersten Male einreiht, zerstörte Matteo alles in einer einzigen Schulpause. Ich musste meine Tasche nach dem Informatik-Kurs zurück in unseren Klassenraum bringen, als ich sie sah. Genau auf meiner Strecke, nicht zu übersehen. In meiner Erinnerung scheint sogar einer dieser klinischen Lichtstrahler exakt auf die beiden. Matteo, der mitten im Schulflur, umgeben von beschmierten Schließfächern dieses Mädchen mit den schönen dunklen Haaren aus unserer Parallelklasse küsste, als wäre es das Normalste der Welt. Als wäre es etwas, das man halt so tut, wenn man doch angeblich so wahnsinnig in seine Freundin verliebt ist. Mein Herz brach nicht in diesem Moment, ich habe es verschlossen. Habe in einem rasanten Tempo hohe Mauern darum gezogen, damit der Schmerz nicht herauskann, damit ich mit diesem Schmerz nicht umgehen muss. Doch sie waren natürlich nicht hoch genug. Wer kann schon so hohe Mauern in Sekunden bauen, damit der erste echte Herzschmerz dahinter verschwindet? Ich jedenfalls nicht, vermutlich kann das keiner. Eine Szene hatte ich nicht gemacht, allerdings nur, weil ich zu schockiert, zu sprachlos war, um überhaupt irgendwas zu sagen. Wer auf so eine Aktion mit Schlagfertigkeit reagiert, verdient meinen größten Respekt. Ich lief weg – und ich glaube, in diesem Moment fing das mit mir und dem Weglaufen an.
Kapitel 1 – Kayla
5 Jahre später
Dieser verfluchte Koffer will einfach nicht zugehen, egal, wie viel Kraft ich aufwende. Zu meinen Füßen liegt noch immer mein halber Kleiderschrank – das elegante, salbeifarbige Kleid, High Heels, meine Kulturtasche, das Glätteisen und mein Laptop. Auch wenn ich den Blick auf meine Smartwatch fürchte, riskiere ich ihn. Nein, nein, nein – ich und mein bescheidenes Zeitmanagement haben mal wieder alles gegeben. Eigentlich habe ich die U-Bahn in zehn Minuten angepeilt, die ich nie im Leben bekommen werde. Ob Hannah sauer sein wird, wenn ich ein oder zwei Stunden später ankomme? Herausfinden möchte ich es lieber nicht. Zwei U-Bahnen später würde bedeuten, ich hätte noch ungefähr sechs Minuten zum Umsteigen an der 30th Street. Nicht leicht, aber machbar.
„Karlinski!“, rufe ich verzweifelt in Richtung des Flurs. Währenddessen stopfe ich planlos Klamotten und die viel zu große Kulturtasche in meine Sporttasche, die ich zusätzlich zu meinem Reisekoffer mitbekommen muss. Den Laptop schiebe ich noch schnell in die dafür vorgesehene Hülle, in die blöderweise weder das Ladekabel noch die Maus passt. Also landet das Zubehör ebenfalls in der Sporttasche, die nun auch definitiv an der Grenze ihrer Kapazitäten angelangt ist.
„Du weißt genau, dass ich den Code für die App dieser Hipster bis heute Abend fertig haben muss“, schimpft mein Kommilitone und Mitbewohner. Trotzdem höre ich anhand der schlurfenden Schritte, wie er mein Zimmer ansteuert. Wenige Sekunden später steht er auch schon im Türrahmen. Ein Zombie, denke ich und nehme die tiefen Furchen unter seinen Augen wahr, die klar und deutlich zeigen, dass er die letzten 24 Stunden nicht geschlafen und seinen Körper nur mit Kaffee und Energydrinks wachgehalten hat. Sein blondes Haar steht wild zu allen Seiten ab, auf seiner Jogginghose sind zwei kleine Kaffee-Flecken zu erkennen.
„Lieber der Zorn der Hipster als der meiner Schwester“, antworte ich gehetzt.
„Deine Schwester könnte keiner Fliege etwas zuleide tun, sie ist quasi eine Heilige.“
„Einer Fliege nicht, mir schon. Stelle dich bitte mal eben auf den Koffer“, weise ich meinen Mitbewohner an, der daraufhin zwar mit den Augen rollt, aber wirklich einen Fuß auf dem Koffer platziert. Er hält sich an meinem Kleiderschrank fest und zieht auch den zweiten Fuß hinauf. Der Deckel des Koffers senkt sich nun etwas nach unten – den Reißverschluss zuzubekommen ist aber noch immer kein Kinderspiel.
„Wieso fragst du nicht Amari? Der bringt mit seinen ganzen Muskeln sicher etwas mehr Gewicht auf dein Gepäck.“
Ich schüttle den Kopf, während ich bemüht an dem Zipper ziehe – die erste Hälfte ist bereits geschafft. „Du hast die letzten Stunden wirklich nicht besonders viel mitbekommen, oder? Amari ist schon seit heute Morgen bei einem Fotoshooting.“
Amari ist das dritte Mitglied unserer Wohngemeinschaft. Er ist nicht wie wir beide Informatikstudent, sondern versucht sich als Model. Perfektionistisch wie er ist, ist er mit seiner Karriere noch kein Stück zufrieden, obwohl seine Aufträge zumindest schon lukrativ genug sind, um seinen Anteil der Miete zu zahlen, was ich als Erfolg betrachten würde. Seine nigerianischen Eltern wollten, dass er eine Ausbildung im Handwerk macht, doch er hatte andere Pläne. Durch diese Entscheidung ist er jetzt allerdings dem mentalen Druck ausgesetzt, nicht Scheitern zu dürfen.
„Ja!“, rufe ich laut, als ich den letzten Zentimeter überbrücke. Daniel bewegt seinen schlaksigen Körper von meinem Koffer runter und begutachtet das Chaos, das noch immer unverpackt ist.
„Scheint, als müsstest du Abstriche machen“, stellt er unnötigerweise fest und erntet dafür einen vernichtenden Blick.
„Ach was“, murmle ich und binde die High Heels am Riemen an die Träger meiner Sporttasche. Sollte ich als Trauzeugin meiner Schwester in Sneakers bei der Trauung auftauchen, würde sie mich wirklich umbringen, ganz sicher. Skeptisch mustere ich die restlichen Klamotten und das Glätteisen – scheiß drauf, ich werde schon irgendwie ohne den Kram auskommen.
***
Mich und mein Gepäck in die U-Bahn zu bekommen, ist deutlich anstrengender als der Acht-Kilometer-Lauf, den ich heute früh hinter mich gebracht habe. Und dies, obwohl es maximal fünf Minuten Fußweg waren. Meine Sporttasche habe ich mir auf den Rücken gesetzt, was wirklich dämlich aussieht und sich auch genauso anfühlt. Die Heels meiner Schuhe stechen mir ständig in die Schulter, über die ich mir zusätzlich meine Laptoptasche gehängt habe. Mein Reisekoffer steht vor mir und ist der Grund, warum ich das erste Mal den Aufzug zum U-Bahn-Gleis genommen habe. Für die zwölf Minuten bis zur 30th Street mache ich mir gar nicht erst die Mühe, alles abzusetzen, sondern bleibe einfach so stehen und lasse den Schweiß meine Haut hinabrinnen. Ich bin so bepackt, dass ich nicht einmal an mein Handy herankomme, das in meiner Gesäßtasche verstaut ist. Völlig fertig drehe ich die Uhr an meinem Handgelenk. Ich werde keine Minute zu früh ankommen, hoffentlich aber auch nicht zu spät. Die Stationen ziehen nicht schnell genug an mir vorbei, dafür drängen sich immer mehr Menschen in die Market-Frankford-Line. Als die Bahn die 34th Street erreicht, bringe ich mich in Position. Der nächste Halt wird das erste Zwischenziel meiner Reise sein und das Rennen wird beginnen. Ein junger Typ mit nur einem Schuh bittet mich um etwas Kleingeld. Selbst, wenn ich ihm etwas geben wollen würde, käme ich gar nicht an mein Portemonnaie heran. Vermutlich ist darin aber sowieso kein Bargeld zu finden, also schüttle ich nur kurz den Kopf und widme mich wieder meiner Startposition. Die Türen gehen auf und ich bin die Erste, die den Wagen verlässt, auch wenn ich dabei wohl alle anderen aufhalte, weil ich meinen Koffer herausmanövrieren muss. Egal, denke ich und steuere die Rolltreppe an. Zum Glück ist diese ausnahmsweise mal nicht gesperrt. Die Kühle des Bahnhofes tut nach der schwülen Hitze in der U-Bahn gut und beflügelt meine Ambitionen, es rechtzeitig zu schaffen. Hinter mir höre ich eine Frau fluchen, weil sie an meinem Koffer nicht vorbeikommt. Dann nimm doch die normale Treppe, wenn du laufen willst, du faule Nervensäge, schreie ich innerlich, sage aber nichts. Im leichten Laufschritt schlängle ich mich durch die Menschenmasse, die mir entgegenkommt, auf die nächste Treppe zu. Bereits ein paar Meter vor der Rolltreppe bemerke ich das rot-weiße Absperrband und stöhne genervt auf. Ich sollte dringend mehr Upper-Body-Workouts machen, nicht immer nur laufen gehen, gestehe ich mir ein und hieve meinen Rollkoffer Stufe für Stufe hoch. Oben angekommen, verdichtet sich die Ansammlung verschiedenster Menschen, Koffer und Hunde noch weiter. Der typische Bahnhofsgeruch schlägt mir entgegen. Ein abartiges Gemisch aus Urin, Rauch, frischen Bagels und Pommes. Normalerweise beherrsche ich das Slalom-durch-den-Bahnhof-Laufen wirklich – doch heute bin ich mit Übergröße unterwegs und verzweifle. Ich fasle eine Entschuldigung nach der nächsten, wenn ich wieder mal jemanden versehentlich angerempelt habe, und ernte einen bösen Blick nach dem anderen. Die große blaue Anzeigetafel ist endlich in Sichtweite und ich scanne sie mit meinen Augen nach dem Acela-Express Richtung Boston ab. Da der Zug planmäßig in drei Minuten abfahren soll, ist die Bahn schon fast nach ganz oben gerutscht. Bis zum richtigen Gleis ist es noch ein ganzes Stück. Gerade als ich meine Schritte beschleunigen möchte, bemerke ich am rechten Rand der Anzeige, auf weißem Hintergrund, eine Banderole, die Zusatzinfos angibt.
Heute circa 20 Minuten später.
Ernsthaft jetzt? Da hetze ich mich wie eine Verrückte über den gesamten Bahnhof, um dann festzustellen, ich hätte auch einfach ganz gemütlich mit dem Aufzug fahren und noch einen Kaffee trinken können!? Ich bewege mich ein Stück zur Seite, atme ein paar Mal tief durch und frage mich, was dieser Tag wohl noch alles für mich bereithält.
***
Als ich eine halbe Stunde später endlich in der Bahn sitze, ist der Stoff meines T-Shirts am Rücken durchgeschwitzt und die Jeansshorts kleben an meinen Beinen. Die Klimaanlage im Acela scheint tatsächlich zu funktionieren und pustet kalte Luft auf die Passagiere. Glücklicherweise konnte ich sogar einen Vierer-Platz für meinen Kram und mich ergattern. Bisher hat auch noch niemand gefragt, ob er sich zu mir setzen kann. Ein Glück. Nach diesem Horror-Weg möchte ich einfach nur meine Ruhe haben. Wäre ich Hannah, hätte ich schon lange Gesellschaft gehabt. Sie strahlt so viel Freundlichkeit aus, dass sie immer angesprochen wird. Egal, ob jemand nach dem Weg fragen möchte, nicht weiß, in welche Richtung die Bahn fährt oder ihr einfach nur von seiner Familie erzählen möchte. Mir passiert das mit meinem ausgeprägten Resting-Bitch-Face so ziemlich nie, worüber ich gar nicht mal traurig bin. Zwar bin ich kein sonderlich introvertierter Mensch und auf Partys quatsche ich auch regelmäßig mit Fremden, doch in gewissen Situationen schätze ich Privatsphäre und Ruhe. Ein Auto wäre für solche Anlässe wie heute wirklich ein Traum. Allerdings habe ich weder einen Führerschein noch Geld, um mir ein Auto zu kaufen. In Philadelphia habe ich dafür auch keine Verwendung, meistens ist man mit dem Fahrrad oder der Bahn sowieso schneller. Hannah und Manuel sind gestern Abend bereits mit dem Auto vorgefahren, hatten jedoch keinen Platz mich und meine Sachen mitzunehmen. Schließlich haben sie zusätzlich noch ihren Hund Taco im Schlepptau und noch deutlich mehr Gepäck, als ich mit mir herumtrage. Ein wenig neidisch bin ich dennoch.
Die Bahn fährt jetzt endlich los, tippe ich an meine Schwester und lege mein Handy auf dem blauen Tisch vor mir ab. Dann greife ich nach der Laptoptasche und befreie mein Notebook. Hannah hat mich zwar gebeten, in den zwei Wochen vor der Hochzeit nicht ständig am Laptop zu hängen, doch ganz werde ich darauf nicht verzichten können. Ich bin mittlerweile im Master meines Informatik-Studiums und habe noch eine ganze Menge To-dos auf meiner Liste, bevor das nächste Semester startet. Wie könnte man eine Bahnfahrt auch besser nutzen? Zu wissen, dass meine Mitstudenten den Großteil ihres Tages in den nächsten Wochen damit verbringen, den Stoff der letzten Semester zu wiederholen, zu programmieren und die ersten Vorbereitungen für ihre Masterarbeit zu treffen, macht mich unfassbar nervös und unruhig. Und was mache ich in der Zeit? Ich bereite die Traumhochzeit meiner großen Schwester vor. Routiniert gebe ich mein Passwort ein und bestätige mit Enter.
Unauffällig sehe ich mich um, beobachte, was die anderen Fahrgäste zum Zeitvertreib tun. In dem Vierer neben mir sitzt sich ein Pärchen gegenüber. Sie haben beide jeweils einen großen Wanderrucksack dabei. Eine der jungen Frauen schaut auf ihr Smartphone und wischt mit ihrem Daumen immer wieder nach oben, als würde sie durch Instagram-Reels oder durch TikTok scrollen. Die Frau ihr gegenüber liest ein Buch, dessen Titel ich von hier nicht lesen kann. Das düstere Cover lässt allerdings auf einen Thriller oder einen Krimi schließen. Schräg hinter mir telefoniert ein Typ, weil es bei jeder Bahnfahrt diese eine Person geben muss, die allen mit ihrem Gequatsche auf die Nerven geht. Dabei bricht er natürlich auch immer wieder zwischendurch in schallendes Gelächter aus, weil sein Gesprächspartner sicherlich lustiger ist als fünf Comedians in einem Raum. Ich stelle den Ton meiner Kopfhörer lauter, um die Geräuschkulisse mit blink-182 zu übertönen. Während mein Laptop hochfährt, gehe ich gedanklich durch, was ich alles auf keinen Fall vergessen durfte mitzunehmen. Zum Glück nehmen meine Eltern das Brautkleid mit, wenn sie am Tag der Hochzeit hinterherkommen. Das wäre mir viel zu viel Verantwortung gewesen. Mein eigener Kram und das nötigste Equipment für den Junggesellinnenabschied machen mich schon nervös genug. Meine Zahnbürste, Make-up, mein Laptop, meine Laufschuhe, Klamotten, Sportkleidung, das Kleid, die High Heels – was noch? Jedes Mal, wenn ich wegfahre, selbst wenn es nur für ein paar Tage oder ein Wochenende ist, zermartere ich mir mein Gehirn, an was ich alles nicht gedacht haben könnte. In der Regel vergesse ich auch tatsächlich immer etwas. Aber wer weiß – vielleicht ist diese Reise die Premiere für das Organisationstalent Kayla Scott.
Kapitel 2 – Kayla
Fast vier Stunden und zwei Umstiege später steige ich aus dem Zug in Hackettstown aus. Der Bahnhof hat nur ein einziges Gleis. Ein richtiges Bahnhofsgebäude gibt es nicht, dafür aber einen überdachten Ticketautomaten und einen großen Parkplatz – immerhin. Seit die Ansage kam, dass der nächste Halt Hackettstown sei, muss ich darüber nachdenken, wie seltsam dieser Name eigentlich ist. Die Aussprache der automatischen Durchsage im Zug ist wirklich amüsant gewesen und hat mir einen Ohrwurm beschert. Ich glaube, das ist mein erster Ohrwurm, der nicht durch ein Lied hervorgerufen wurde. Hack-ett-s-town, in etwa hieß es. Keine Ahnung, ob die Trennung so überhaupt richtig ist, aber ich bekomme es einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Gibt es eigentlich noch ein anderes Wort oder einen anderen Ort, dessen Name drei „t’s“ beinhaltet, die nur durch einen einzigen Buchstaben getrennt werden? Falls ja, fällt mir keiner ein. Ich denke, das ist wirklich selten, oder mein Gehirn ist nach diesen anstrengenden letzten Stunden einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Auch nicht unrealistisch.
Mit meiner linken Hand schirme ich meine Augen etwas vor der intensiven Juli-Sonne ab, um nach dem schwarzen Honda von Hannah und Manuel Ausschau zu halten. Gerade als ich verzweifelt auf mein Handy schauen möchte, greift mir eine Hand von hinten auf die Schulter.
„Na endlich, Schwesterherz!“, höre ich Hannah rufen und werde noch ehe ich mich richtig umdrehen kann, in eine stürmische Umarmung gezogen. Sie steht eindeutig unter Strom. Wenn das jetzt schon so ist, wie soll es dann erst wenige Tage, wenige Stunden vor der Trauung sein?
„Hey, Nervenbündel“, begrüße ich sie grinsend.
„Hach, ich freue mich so, dass du da bist. Ich stehe da hinten.“ Sie deutet auf die andere Seite des Parkplatzes und schnappt sich meinen Koffer. Ihr geblümtes Sommerkleid flattert leicht im sanften Wind, genau wie ihre blonden Locken. Ihre Haut ist leicht gebräunt. Insgesamt wirkt sie eher, als wäre sie bereits seit Wochen im Urlaub auf dem Land und nicht erst seit gestern. Das steht ihr beunruhigend gut. Vielleicht muss ich mich mit dem Gedanken anfreunden, meine Schwester nicht immer so nah bei mir zu haben. Eigentlich gehört sie nicht in die Großstadt, Manuel genauso wenig. Doch das sage ich ihr nicht, dafür bin ich zu egoistisch. Sie werden schon früh genug darauf kommen, da muss ich nicht noch nachhelfen.
Wir steuern gemeinsam den schwarzen Kombi an. Die Ruhe, die hier herrscht – obwohl wir an einem Bahnhof sind – irritiert mich irgendwie. Na ja, wie viel Lärm kann ein einziges Gleis, auf dem alle paar Stunden mal ein Zug vorbeischaut, schon machen? Gemeinsam wuchten wir mein Gepäck in den Kofferraum und ich fühle mich nach fast vier Stunden endlich wieder frei und nicht eingeengt. Ich lasse meine Schulterblätter etwas kreisen und setze mich anschließend auf den Beifahrersitz. Die schwarzen Ledersitze haben sich aufgeheizt und bringen die freie Haut meiner Oberschenkel ein wenig zum Brennen. Hannah startet den Wagen und langsam verlassen wir den leeren Parkplatz.
„Ich bin gespannt, wie du Manuels Großeltern so findest. Sie sind wirklich so lieb und wunderbar. Und das Haus, das Grundstück, das alles ist einfach nur traumhaft. Es ist die perfekte Location, weißt du?“
Lächelnd drehe ich meinen Kopf zu ihr und mustere ihre Gesichtszüge. Ihre Augen strahlen, dennoch ist da eine Kleinigkeit, die nicht stimmt.
„Was ist los? Muss ich in einem Zimmer mit Taco schlafen?“, frage ich lachend.
„Du liebst Taco!“, entgegnet Hannah entsetzt und lacht kurz auf. Dann ist dieser bestimmte Ausdruck in ihrem Gesicht aber wieder zurück.
„Ja, das tue ich. Trotzdem will ich nicht mit ihm in einem Zimmer schlafen, er pupst ständig, wenn er pennt.“
„Du hast ein Einzelzimmer, keine Sorge“, gibt sie lächelnd zurück.
„Was ist es dann?“, frage ich, nun etwas ungeduldig.
Hannah scheint sich auf ihre Wangeninnenseite zu beißen, den Blick konzentriert auf die Straße gerichtet.
„Ähm, also … du bist nicht die Einzige, die heute angekommen ist.“ Mit hochgezogenen Augenbrauen bedeute ich ihr weiterzusprechen, auch wenn ich ahne, was sie sagen wird.
„Matteo ist auch schon da“, bringt sie dann hervor und sieht kurz entschuldigend zur Seite, ehe sie nach vorne blickt, den Blinker setzt und abbiegt.
„Warum?“
„Er ist Manuels Trauzeuge und will sich auch an den Vorbereitungen beteiligen. Außerdem ist es das Haus seiner Großeltern. Er möchte Zeit mit ihnen verbringen, schätze ich.“
Ich schnaufe ungläubig. Sie hätte es mir sagen müssen. Das ist ganz sicher keine spontane Entscheidung gewesen.
„Wieso, zur Hölle, hast du mir das nicht im Vorfeld gesagt? Dann hätte ich mich mental darauf vorbereiten können, meinem ersten Erzfeind in die Augen zu blicken.“
Genau genommen ist er nicht mein erster Erzfeind, sondern mein zweiter, aber das hätte jetzt wirklich blöd geklungen. Meine erste Erzfeindin war meine Nachbarin, als ich etwa zehn Jahre alt war. Jedes Mal, wenn ich auf dem Weg zum Kiosk an der Ecke war, um mir eine Süßigkeiten-Tüte für einen halben Dollar zusammenzustellen, hat sie sich vor mich gedrängelt und die besten Gummitiere weggeschnappt. Danach hat sie sich lächelnd umgedreht und dieses unschuldig-siegessichere Lächeln aufgesetzt, wie es nur 12-jährige können. Die Reinkarnation des Bösen. Fünf Jahre später hat es Matteo Valentini dann auf den zweiten Platz meiner Liste geschafft. Mittlerweile sind weitere Ränge vergeben. Nicht verwunderlich, schließlich bin ich eine junge Frau in einem MINT-Studiengang. Obwohl sich im Laufe der Zeit viel geändert hat, sind die Studentinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik noch immer in der Minderheit. Was man leider regelmäßig zu spüren bekommt.
„Ich habe es dir nicht früher gesagt, damit du dir keine Ausrede ausdenkst.“
„Das ist manipulativ“, stelle ich schmollend fest und sehe aus dem Fenster. Wir sind jetzt auf irgendeiner schmalen Straße mit zahlreichen Schlaglöchern. Links von uns nur Büsche und Bäume, rechts von uns Wiesen, die ab und an durch Wohngrundstücke unterbrochen werden.
„Du hättest eine Grippe erfunden, ganz sicher! Dabei brauche ich dich hier. Es ist alles so aufregend, so viel, so schön, so beängstigend und ich brauche meine Schwester einfach in dieser Zeit bei mir.“
Sie weiß genau, wie sie mich beruhigen kann und ich hasse es. Ich will sauer auf sie sein, weil das ein wirklich mieser Schachzug gewesen ist, doch ich kann es einfach nicht. Blödes genetisches Schwestern-Zeug.
„Ich hätte keine Grippe erfunden. Es ist weder typische Grippesaison, noch geht eine Grippewelle rum. Das wäre so offensichtlich gelogen gewesen.“ Ich lächle leicht. „Ich hätte meine Ausrede viel überzeugender und wasserdichter gewählt.“
„Natürlich hättest du das“, antwortet Hannah grinsend und wirkt erleichtert. Ich dagegen bin nervös, obwohl ich es mir am liebsten verbieten würde. Trotzdem kann ich meine Hände nicht davon abhalten, diesen kalten Schweiß zu produzieren. Genervt wische ich sie an meinem bequemen T-Shirt ab und versuche mich abzulenken. Beobachte die Landschaft, die noch immer überwiegend Bäume und Wiesen bereithält. Ab und an entdecke ich aber auch eingezäunte Ziegenherden oder bewirtschaftete Felder. Schließlich biegen wir auf eine deutlich schmalere Straße ab. Ein wenig später tauchen dort vereinzelt Häuser auf. Alles große Einfamilienhäuser, Bauernhöfe oder Backsteinhäuser mit gepflegten Gärten. Die Dichte der Bauwerke wird immer geringer. Dann kommt das erste Mal etwas, das an eine Straßenkreuzung erinnert, abgesehen davon, dass wir nicht auf eine Straße, sondern auf einen Feldweg abfahren. Eine Allee, eingerahmt von leuchtend grünen Laubbäumen. Am Ende des Weges ist langsam ein Haus zu erkennen – das einzige Haus. Dies muss das Grundstück von Manuels Großeltern sein. Das Grundstück, auf dem meine Schwester in zwei Wochen ihre Hochzeit feiern wird. Das Grundstück, auf dem ich Matteo das erste Mal wieder begegnen werde.
Das Haus sieht aus wie ein älteres Farmhaus, nur dass die Fassade zumindest auf die Entfernung eher neu und hell scheint. Hinter dem Haus sind Umrisse eines weiteren großen Gebäudes zu erahnen. Das ist bestimmt die Scheune, von der Hannah seit Monaten schwärmt.
„Wundervoll, oder?“, ertönt ihre Stimme links neben mir. Als hätte sie ihr Stichwort in meinen Gedanken gehört.
Beim Näherkommen stelle ich fest, dass ich recht habe. Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Fassade ganz sicher erneuert, sie wirkt gepflegt und trotz des fast weißen Tons sind keine Makel oder Anzeichen von Verwitterung auszumachen. Das Giebeldach ist mit rot-braunen Dachziegeln bestückt. Vor dem Haus ist eine gepflasterte Fläche, die scheinbar als Parkplatz dient. Hier finden bestimmt fünf Autos Platz. Zwei stehen bereits dort. Ein Geländewagen und ein grauer Audi A3. Das Kennzeichen ist weiß mit blauer Schrift. Washington DC steht über der Buchstaben – und Nummernfolge. Natürlich fährt Matteo ein deutsches Auto. So ein Poser. Hannah reiht ihr Auto geschickt in die Reihe ein und schaltet den Motor aus. Mein Magen flattert nervös, meine Hände schwitzen noch immer. Emsig wische ich sie dieses Mal an meinen Jeansshorts ab, in der Hoffnung, dass es besser hilft. Die Großeltern wollen mir bestimmt die Hand geben, verflucht. Ich hasse Matteo Valentini für alles, was damals war, und für all die Unannehmlichkeiten, die er mir auch jetzt beschert. Wir steigen aus und die Ruhe ist laut in meinen Ohren. Vorhin in Hackettstown dachte ich schon, es wäre ruhig. Das hier ist ein ganz anderes Kaliber. Diese Ruhe setzt andere Maßstäbe. Sie lässt mich meinen eigenen Herzschlag hören, das leise Surren einer Grille und den Wind in den Bäumen. Hannah öffnet den Kofferraum und lädt mein Gepäck aus, während ich noch immer am selben Fleck stehe und einfach nur horche.
„Ungewohnt, hm?“, unterbricht sie meine Gedanken. Ich nicke etwas resigniert und finde langsam zurück in das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt, in dem ich mich einer Vergangenheit stellen muss, die ich zu gern für immer hinter mir gelassen hätte.
„Sie sind alle im Garten. Wir können dein Gepäck einfach hier vor der Haustür abstellen und hinten rumgehen. Deinen Kram holen wir dann später rein“, schlägt meine Schwester vor.
„Ich kann meine Sachen doch nicht einfach so hier stehen lassen“, antworte ich irritiert.
„Wieso nicht? Denkst du, irgendwer begibt sich extra auf diesen zwei Kilometer langen Feldweg, um deine Klamotten zu stehlen? Einfach so, auf gut Glück?“
Touché. Dann kann ich es also wirklich nicht länger hinauszögern. Augen zu und durch. Wie bei Kilometer Nummer sieben, der mir, warum auch immer, am schwersten fällt. Wenn ich diesen überwunden habe, kann ich problemlos noch zehn weitere Kilometer laufen, aber diese verflixte Sieben, bringt mich jedes Mal wieder an meine Grenzen. Einfach weiterlaufen, Augen zu und durch, sage ich mir jedes Mal. Genau wie jetzt.
Wir gehen links an dem Haus vorbei, eine etwa zwei Meter breite Lücke zwischen zwei Zypressen signalisiert einen Durchgang. Von hier ist ein leises Stimmengewirr wahrzunehmen. Stimmen und Lachen. Hannah nimmt meine Hand und zieht mich mit sich. Das ist wahrscheinlich gut so, vielleicht wäre ich sonst wirklich umgedreht. Wäre einfach weggelaufen. Darin bin ich super.
Bevor wir einen Blick auf die zu den Stimmen gehörenden Körper werfen können, kommt ein schwanzwedelnder, hechelnder Vierbeiner auf uns zu gerannt. Taco läuft aufgeregt zwischen uns beiden hin und her, sabbert beim Vorbeigehen meine Waden an und ist immer wieder kurz davor, an uns hochzuspringen, obwohl Hannah und Manuel es ihm so ausdauernd abgewöhnt haben.
„Hey Taco-Pups“, begrüße ich den champagnerfarbigen Labrador Retriever und hocke mich etwas hin, um ihn ausgiebig begrüßen zu können. Er drückt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen mich und bringt mich so fast zu Fall. Als würde er sichergehen wollen, dass ich ja nicht aufhöre, mit meinen Händen durch sein weiches, schönes Fell zu fahren.
„Weiter geht’s, Kiki“, befiehlt meine Schwester nach einer Weile und macht so wieder einmal meine Verzögerungstaktik zunichte. Ich rolle mit den Augen und richte mich langsam, fast in Zeitlupe auf. Taco ist mindestens genau so begeistert darüber, die Kuscheleinheit zu beenden, wie ich.
Das Bild, das sich uns hinter dem Durchgang bietet, könnte auch aus einem dieser Heimat-Love-Story-Filme stammen. An einem großen Terrassentisch sitzen vier Personen, auf die Taco jetzt zuläuft. Sie haben große Kaffee- und Teebecher vor sich stehen oder in der Hand. Auf dem Tisch ist außerdem ein großes Blech mit Apfelkuchen und eine Keksdose angerichtet. Die Teller, die neben dem Blech gestapelt wurden, sind aus weißem Porzellan mit romantischen, blumigen Verzierungen. Das alles ist so unwahrscheinlich kitschig. Aber einladend, muss ich gestehen. Mit einem schnellen Rundum-Blick scanne ich die Personen ab. Manuel sieht aus wie immer – das dunkle, volle Haar, das sich ganz leicht lockt, die hellbraunen Augen, das ruhige, gelassene Lächeln auf den Lippen. Ein schlichtes, hellgraues T-Shirt und eine blaue Jeans. Neben ihm sitzt eine ältere Dame, offensichtlich die Großmutter von Manuel und Matteo. Sie hat helles, blondes Haar, das von weiß-grauen Strähnen durchzogen ist. Ihre Haut ist faltig und gebräunt, als hätte sie die letzten drei Wochen am Strand auf irgendeiner Südsee-Insel verbracht. In Wirklichkeit hat sie vermutlich einfach in ihrem Garten geschuftet, der wirklich unfassbar schön ist. Die perfekte Mischung aus naturbelassen und mühsam gepflegt. Sie schaut mich mit einem so freundlichen Lächeln an, dass man gar keine andere Wahl hat, als es zu erwidern. Ihr Ehemann ist etwas stämmiger und hat eine Glatze. Seine Haut ist ebenso sonnengebräunt und vom Alter gezeichnet. Er nimmt einen Schluck aus seinem Kaffee-Becher und sieht mich durch die silberne Brille an. Auf der anderen Seite von ihnen sitzt Matteo. Glaube ich zumindest. Er sitzt nicht ganz zu uns gerichtet, und da ich direkt wieder weggeschaue, erhasche ich nur sein Profil, ohne irgendwelche Details zu erkennen.
„Hallo zusammen, da sind wir schon“, begrüßt Hannah strahlend die Runde. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Matteo den Kopf in unsere Richtung dreht, zwinge mich jedoch wegzusehen. Ich lasse meinen Blick konzentriert auf den Gastgebern ruhen. Ein letztes Mal wische ich möglichst unauffällig den Schweiß von meinen Händen und mache ein paar Schritte auf sie zu, bis ich recht dicht vor ihnen stehe. Höflich halte ich der Großmutter die Hand entgegen. Sie nimmt meine Hand in ihre, zieht mich aber sanft zu sich heran, in eine offene Umarmung.
„Hi, ich bin Kayla“, sage ich währenddessen und stelle fest, dass sie nach Blumen und frisch gemähtem Rasen riecht.
„Freut mich so Liebes, mein Name ist Ruth, das ist mein Mann Barry“, stellt sie auch ihren Ehemann vor, der mir freundlich die Hand schüttelt. Er hat einen festen Händedruck – ich aber auch, wie er kurz darauf überrascht feststellt. Fast ein wenig anerkennend nickt er mir zu. Dann wende ich mich meinem zukünftigen Schwager zu und umarme ihn kurz. Jetzt kommt der unangenehmste Teil. Wäre es sehr unhöflich, einfach zu tun, als sei Matteo nicht da? Mich hinzusetzen, mir eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen geben zu lassen und von meiner Fahrt zu berichten, ohne ihm auch nur einen einzigen Blick zu schenken? Grundsätzlich hätte ich damit überhaupt kein Problem, aber vor seinen Großeltern fühlt es sich irgendwie falsch an. Ich schlucke schnell und schaue dann für ungefähr eine Millisekunde in seine Richtung. Dabei nuschle ich ein halbverschlucktes „Hi.“ Auch wenn ich ihn nur so kurz ansehe, brennt sich sein Bild in meine Netzhaut. Er sieht Manuel ähnlich, noch immer. Nur ist sein Gesicht etwas schmaler, die Konturen definierter, härter. Hohe Wangenknochen, eher schmale Lippen. Die Haare genauso dunkel, aber kürzer. Noch immer kein Bart, wahrscheinlich wächst ihm auch keiner, egal wie sehr er sich bemüht. Ich hoffe, ihn ärgert das sehr. Seine Augen leuchten fast, obwohl sie dunkelbraun, nahezu schwarz sind. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Seine Statur ist im Vergleich zu früher etwas weniger schlaksig, aber noch immer nicht sehr muskulös, sondern einfach nur sportlich. Vielleicht auch nicht echt-sportlich, sondern Glück in der Gen-Lotterie-sportlich. Wahrscheinlich würde ich mit dieser ganzen Situation deutlich besser zurechtkommen, hätte er sich in den letzten Jahren zu einem unattraktiven, abstoßenden Mittzwanziger verwandelt. Ich spüre seinen Blick auf mir, als er nichts als ein „Hi“ antwortet, obwohl ich schon lange nicht mehr in seine Richtung sehe. Die Art, auf die er es sagt, klingt lässig und beiläufig und ich könnte ihn dafür umbringen. Dass er nach all dem, was geschehen ist, was er mir angetan hat, einfach nur meine Begrüßung kopiert, sie aber deutlich entspannter wirken lässt, macht mich rasend.
Bilder, die fast zehn Jahre alt sind, tauchen in meinem Kopf auf. Wir waren beide gerade fünfzehn Jahre alt, als Matteo im Mathe-Unterricht einen gefalteten Zettel auf meinen Tisch warf, mitten auf mein Lehrbuch. Er hat damals Basketball gespielt, vielleicht war er dadurch so treffsicher. Meine Sitznachbarin war fast noch neugieriger als ich, doch ich habe mich von ihr weggedreht und heimlich, um nicht von unserem Lehrer erwischt zu werden, das Papier auseinandergefaltet.
Hey Kayla,
wollen wir nach der Schule ein Eis essen gehen?
Matteo
Mehr nicht, mehr hat es nicht gebraucht, um mein Herz das erste Mal stürmisch für Matteo Valentini schlagen zu lassen. Ein winziger, zusammengeknüllter Zettel mit dieser typischen, unordentlichen Handschrift eines Teenager-Jungen. Natürlich habe ich mich supercool gegeben und nur ein klar mit meinem grünen Fineliner dazugeschrieben, ehe ich den Zettel an meine rechte Sitznachbarin mit den leisen Worten „an Matteo“ weitergegeben habe. Die Zettelpost hat erstaunlich zuverlässig funktioniert damals. Es wurden keine Botschaften abgefangen, vor allen vorgelesen oder aufgemacht, bevor der Empfänger sie in die Finger bekommen konnte. Schließlich war jeder Mal darauf angewiesen, still im Unterricht zu kommunizieren. Wir waren dann jedenfalls tatsächlich Eis essen – bei einer Eisdiele in der Nähe vom Schuylkill River. Wahnsinnig romantisch für mein 15-jähriges Ich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil wir allein schüchterner und unsicherer waren als in unseren Freundesgruppen, haben wir viel geredet und gelacht. Irgendwann, nachdem wir unser Eis aufgegessen hatten und auf dem langen Steg am Fluss spazieren waren, hat er meine Hand genommen und ab diesem Moment waren wir ein Paar. So einfach war das damals. Keine ausweichenden Vorstellungen, wenn man Bekannte oder Freunde trifft, keine Sondierungsgespräche, die Monate andauern. Einfach nur eine Geste. Wir waren beide das erste Mal wirklich verliebt. Es war neu und aufregend und wahnsinnig cool. Meine Freundinnen haben mich beneidet, Matteos Freunde haben ihn beneidet. Ungefähr zwei Wochen nach unserem Eis-Date hatten wir unseren ersten Kuss. Beide von uns unbeholfen, aber bemüht. Auch wenn wir noch nicht sonderlich gut darin waren, beschlossen wir, dass uns das Gefühl trotzdem gefällt und haben es weiterversucht. Jeder Kuss wurde schöner als der vorherige und das Sich-Küssen wurde zu unserer Lieblingsbeschäftigung. Wann genau ich mich wirklich in Matteo verliebt habe, weiß ich nicht mehr, aber eines Tages wusste ich, dass ich nicht nur mit ihm zusammen war, weil ich jetzt 15 Jahre alt bin und man langsam seinen ersten Freund haben könnte, sondern, weil ich wirklich verliebt war. Matteo sagte mir, dass es ihm ebenso ginge und ich war unfassbar glücklich. So glücklich, dass ich nach unseren Verabredungen in meinem Kinderzimmer herumtanzen und singen musste, um all diese aufregenden Gefühle herauszulassen. Es war perfekt. Bis es das dann nicht mehr war. Bis er alles zerstört hat, indem er dieses Mädchen in unserem Schulflur geküsst hat. Matteo und ich haben nie darüber gesprochen und es gibt auch keinen einzigen Teil in mir, der sich ein Gespräch darüber oder über irgendwas anderes mit ihm wünscht. Mir blieben damals etwa fünfzehn Minuten bis zur nächsten Unterrichtsstunde. Ich rannte an das Ende unseres Schulhofs, der leider nicht sehr groß war, bis zu einer alten Esche. Dort ließ ich mich sinken und starrte nach oben, in die weiß-grauen Wolken, um keine Träne zu vergießen. Nicht hier, nicht vor allen anderen, nicht vor Matteo. Während ich dasaß und in den Himmel sah, vibrierte immer wieder mein Handy und mein Magen drehte sich um. Sollte Matteo Valentini wirklich die Dreistigkeit besitzen, sich jetzt per SMS zu entschuldigen? Nein – stellte ich fest. Nur meine damalige beste Freundin, die nichts als ein paar schockierte Emojis sendete. Er hat sich nie dafür entschuldigt, nicht an diesem Tag, nicht am Tag danach und auch nicht im Monat danach. Er blieb stumm, während ich laut wurde. In der nächsten Unterrichtsstunde machte ich über einen kleinen Zettel Schluss mit ihm. Das kam mir damals total bedeutungsschwer und dramatisch vor: Es so beenden, wie es angefangen hat. Ich sah nicht zu ihm, als er das Papier auseinanderfaltete und las, und auch nicht, als er kurz darauf stürmisch das Klassenzimmer verließ. Verachtung und Wut, mehr wollte ich seit diesem Tag nicht für Matteo empfinden. Darin bin ich verdammt gut geworden – und ich bin es noch heute. Ich bin es, während ich mich zu seiner Familie setze und einen Kaffee trinke. Ich bin es, während ich mein Gepäck in das Haus seiner Großeltern trage. Und ich bin es, während ich mich erschöpft auf das Bett, das für die nächsten zwei Wochen meines ist, fallen lasse.