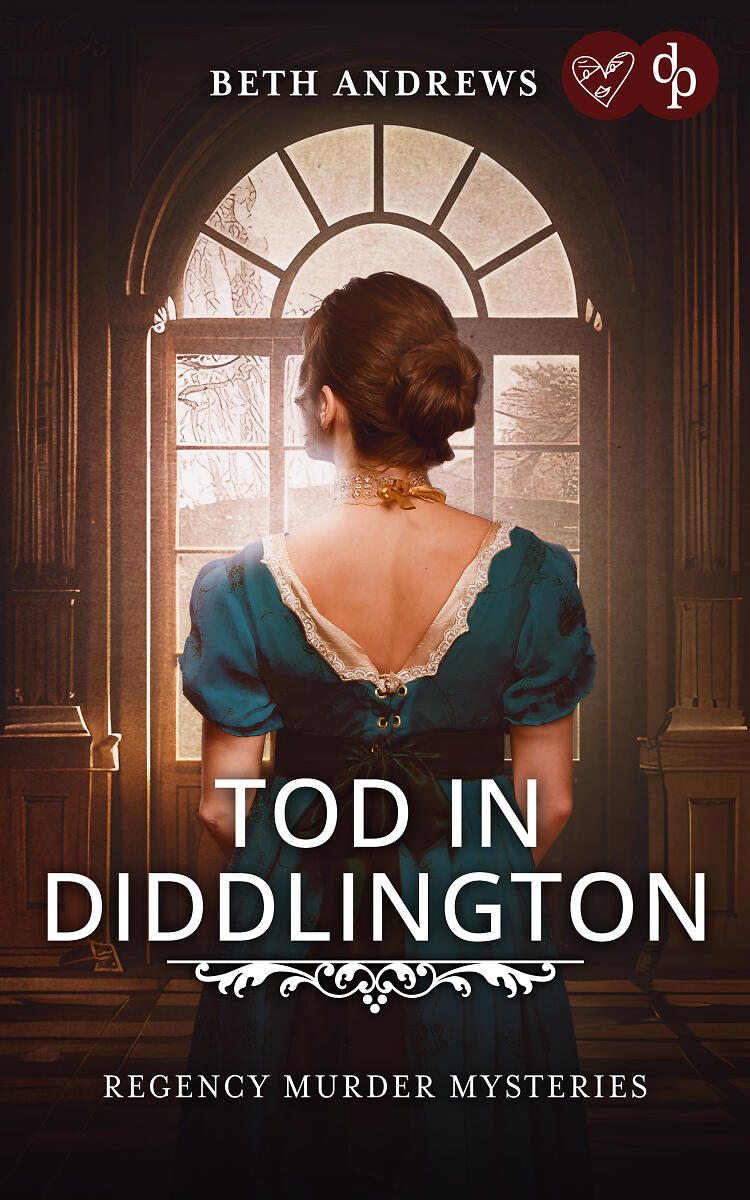KAPITEL ZWEI: EINE GEFÄHRLICHE REISE
Die Reise von London mit der schwarzkastanienbraunen Royal Mail-Kutsche bot reichlich Abenteuer für Lydia. Papa und Mama konnten sich den teuersten Sitzplatz nicht leisten, und so saß sie gefährlich hoch oben auf dem Dach und klammerte sich die meiste Zeit der Fahrt an ein praktisch platziertes Geländer, während sie holpernd und stürmisch die Straßen im Südosten Englands entlang rollten.
Sie hatte vor der Abfahrt der Kutsche eine herzhafte Mahlzeit zu sich genommen, da sie vermutlich bis zum Ende ihrer Reise keine weitere erhalten würde. Da sie strikt angewiesen worden war, sich nicht mit ihren Mitreisenden zu unterhalten, blieb ihr nicht viel anderes übrig, als diese in sturer Stille zu beobachten.
Neben ihr saß eine ältere Dame, deren Gesicht so von feinen Fältchen durchzogen war, dass es wie eine fantastische Karte der Straßen Londons aussah, mit einer Nase, die in der Mitte wie die Kuppel der St. Paul's-Kirche aufragte. Mehrmals, als sie eine besonders scharfe Kurve nahmen, hatte sie sich an Lydia geklammert, um nicht aus dem schwankenden Wagen zu fallen. Ansonsten zeigte sie kein Interesse an ihrer Begleiterin.
Ihnen gegenüber saßen zwei Herren. Einer war ein rundlicher Kerl mit kahlem Kopf und ungewöhnlich kleinen Ohren. Der andere wirkte krankhaft blass, mit großen dunklen Augen und einem ausgeprägten Schnabel, der Wellingtons in den Schatten gestellt hätte. Sie waren beide schon etwas älter – mindestens fünfzig – und im Allgemeinen zu sehr damit beschäftigt, auf ihren Sitzen zu bleiben, um Lydia mehr als ein Lächeln oder ein aufmunterndes Zwinkern zu schenken. In ihren Gedanken wurden sie einfach zu „Nase“ und „Ohren“.
Wenn die Kutsche langsamer fuhr oder sie sich auf einem geraden Straßenabschnitt befanden, bekam sie Gesprächsfetzen mit. Sie waren beide Theaterbesucher und führten mehrere Meilen lang eine lebhafte Debatte über die konkurrierenden Vorzüge von Kean und Kemble. Nase, so schien es, kannte diese beiden berühmten Schauspieler persönlich und unterhielt den entsprechend ehrfürchtigen Ohren mit Anekdoten aus dem Leben auf der Bühne, die Lydia für frei erfunden hielt.
„Es liegt so viel Adel in Mr. Kembles Art“, argumentierte Ohren an einer Stelle.
„Nun“, kommentierte Nase mit etwas Verachtung, „jeder Hund hat seinen Tag, aber ich fürchte, Kembles ist so gut wie vorüber. Haben Sie Kean bei seinem ersten Auftritt als Shylock gesehen?“
„Waren Sie da?“ Ohrens Augen weiteten sich, als die Kutsche sich drehte.
„Natürlich war ich das.“ Nase schien beleidigt über die Andeutung, dass er bei einem so bedeutsamen Anlass abwesend gewesen sein könnte. „Tatsächlich war er sehr dankbar für meine Hilfe. Er hat mir das hier gegeben.“
Hier hielt er inne, um eine vergoldete Silberuhr am Ende einer verzierten Kette hervorzuziehen. Lydias Blick wanderte zu seinem ausgestreckten Finger und sie konnte gerade noch ein Paar grotesk geschnitzter Gesichter darauf erkennen. Sehr theatralisch, dachte sie angewidert. Ohren hingegen war um einiges beeindruckter.
„Bei Gott!“, rief er. „Sie haben sich in erhabenen Kreisen bewegt, Sir.“
Nase lächelte vor Freude, solche Bewunderung erregt zu haben. Was er jedoch als Antwort sagte, ging für Lydia verloren, da ein vorbeifahrender Phaeton sie in diesem Moment fast von der Straße drängte. Nase und Ohren riefen dem beleidigenden Jehu ein paar nette Worte zu, und sogar Miss Map – wie Lydia die alte Vettel neben sich nannte – wachte auf und murmelte etwas wenig Schmeichelhaftes. Lydias Aufmerksamkeit driftete ab, und es dauerte mehrere Minuten, bis sie den Faden ihres Gesprächs wiederaufnahm, das nun in eine andere Richtung führte.
„Und Ihre Schwester ist auch mit Kean erschienen?“, fragte Ohren.
„Ja, in der Tat.“ Nase nickte heftig. „Sie war wirklich eine außergewöhnlich begabte Schauspielerin, erlangte aber leider nie den Ruhm, den sie verdiente. Dann heiratete sie natürlich Mr. Cha –“
Wieder wurde ihre Unterhaltung unterbrochen – dieses Mal durch den ohrenbetäubenden Lärm des Wachmanns auf dem Blechhaufen, der Lydia selbst erschreckte und weitere Beschwerden ihrer Mitreisenden hervorrief.
Lydia beteiligte sich nicht an ihren Protesten, da sie zu sehr damit beschäftigt war, ihren Strohhut zu verschieben, der beunruhigend nach Backbord geneigt war. Wäre sie die Heldin in einem der neuesten Liebesromane gewesen, die Louisa so liebte, so dachte sie, wäre sie ganz sicher vom Postwagen in die Arme eines gut aussehenden Aristokraten gestürzt. Er hätte sie in sein Schloss entführt und versucht, ihr ihre Tugend zu rauben. Was das eigentlich bedeuten würde, war sie sich nicht sicher. Liebesromane waren in dieser Hinsicht meist etwas vage. Natürlich hätten ihr lebhafter Witz und ihre vielfältigen Reize die wilde Bestie eines verschwenderischen Herzogs oder Viscounts besänftigt, und er hätte um ihre Hand angehalten.
Da dies jedoch kein Roman war, geschah nichts, was auch nur halb so spannend gewesen wäre. Tatsächlich kamen sie bald in Lewes an. Hier stieg Lydia mit einem innigen Seufzen der Erleichterung von der Kutsche ab. Sie war froh, dass ihr weitere Unannehmlichkeiten und Gefahren erspart blieben – besonders, da der Himmel sich bedrohlich verdunkelte und einen bevorstehenden Regenschauer ankündigte, der nichts Gutes für die drei verbleibenden Reisenden auf dem Dach der Kutsche verhieß.
Sie hoffte, dass Tante Camilla bereits da war, um sie abzuholen. Das Gasthaus sah anständig aus, aber der Gedanke, wie eine Dienerin herumzuwarten, gefiel ihr nicht.
Sie konnte die Schreie der Stallknechte hören, die sich beeilten, die Pferde zu wechseln, und das allgemeine Durcheinander, als die Passagiere sich nach einem Happen Essen umsahen, bevor die Kutsche wieder abfuhr. Glücklicherweise war sie noch keine fünf Minuten dort, als ein älterer Mann auf sie zukam, sich zögernd verbeugte und fragte: „Sind Sie Miss Bramwell?“
Lydia nickte und musterte ihn abschätzend.
„Mein Name ist Flitt, Miss. Kommen Sie bitte hierher“, wies er sie an und wandte sich erneut dem Hof des Gasthauses zu. „Ich bringe Sie zu Ihrer Tante.“
***
Lydia war schüchtern, räumte aber ein, dass sie ein leichtes Kribbeln im Bauch verspürte, als sie sich dem altmodischen Wagen näherten, der abseits des hektischen Treibens rund um die Post stand.
Als sie näherkam, öffnete sich die Kutschentür mit ihrer verblassten Farbe und eine Dame stieg aus, die so anders war als die gealterte Furie aus Lydias Vorstellung, wie sich eine Rose von einer Distel unterschied.
Sie hatte angenommen, dass Tante Camilla Mama ähnlich sehen würde. Sie irrte sich. War ihre Mutter klein und rundlich, bestach diese Dame durch das genaue Gegenteil: groß und gertenschlank. Obwohl ihre Kleidung nicht der neuesten Mode entsprach, trug sie sie mit einer Aura, die ihr einen wahren Hauch Eleganz verlieh. Ihr Gesicht war ein blasses Oval, mit dunklem Haar, das unter ihrer Haube hervorlugte, und großen blauen Augen, die voller Respekt in die Welt hinausblickten. Ihre Lippen waren im Moment zwischen ihren perlweißen Zähnen gefangen, aber Lydia zweifelte nicht daran, dass sie genauso entzückend waren wie der Rest ihres Gesichts. Sie war tatsächlich eine Schönheit. Wer hätte das gedacht?
„Tante Camilla?“, fragte Lydia zögernd und dachte plötzlich darüber nach, dass dies vielleicht ja jemand anderes sein könnte, der einfach geschickt worden war, um sie abzuholen.
„Liebste Lydia!“, rief die Dame und stieg herab, um sie zu umarmen. „Nun! Das ist ein freudiger Anlass.“
„Sie sind viel hübscher, als ich erwartet hatte“, sagte Lydia mit ihrer üblichen Offenheit.
Ihre Tante errötete und schaute weg. Es schien, als sei sie es nicht gewohnt, Komplimente zu bekommen, nicht einmal von ihren Verwandten.
„Aber wo ist dein Dienstmädchen?“, stammelte sie und ließ ihren Blick über den Hof des Gasthofs schweifen.
„Ich habe keins.“
Die großen blauen Augen wurden noch größer.
„Keine Magd!“ Tante Camilla war empört. „Was kann sich deine Mutter nur dabei gedacht haben? Du bist viel zu jung, um allein zu reisen! Ich bin erstaunt.“
Vergeblich versuchte Lydia zu erklären, dass es ihren Eltern unmöglich sei, sich die Kosten für ein Dienstmädchen für ihre Tochter zu leisten. Ihre Beteuerungen, sie sei ein vernünftiges Mädchen, stießen auf Ohren, die definitiv nicht zuhörten. Für die ältere Frau war es einfach unvorstellbar, dass man ein siebzehnjähriges Mädchen allein durch die englische Landschaft ziehen lassen konnte, ohne ihrem Ruf irreparablen Schaden zuzufügen und höchstwahrscheinlich eine nationale Katastrophe herbeizuführen.
„Es ist für mich schwer vorstellbar“, sagte Lydia schließlich, „dass mir auf der gemeinsamen Strecke zwischen London und Lewes etwas Fürchterliches hätte zustoßen können.“
„Du kennst die Bosheit dieser Welt nicht, liebes Kind“, bemerkte Tante Camilla.
Ihre dramatische Äußerung ließ Lydia glauben, sie habe Mr. Walpole oder Mrs. Radcliffe gelesen. Weitere Gespräche bestätigten diesen Verdacht. Ihre Tante hatte eine starke romantische Neigung, die ihre Nichte nicht besaß. Gleichzeitig kam es Lydia so vor, als sei sie übermäßig schüchtern und zurückhaltend. Nach ihrer anfänglichen Predigt über die Gefahr, die das Reisen für unschuldige junge Frauen mit sich brachte, verfiel sie in ein unangenehmes Schweigen, anscheinend wusste sie nichts anderes zu sagen.
„Das ist eine sehr schöne Kutsche“, sagte Lydia schließlich.
„Oh ja!“ Camilla schien erleichtert, ein Gesprächsthema gefunden zu haben. „Mrs. Wardle-Penfield war sehr großzügig, mir anzubieten, sie ausleihen zu dürfen.“
„Es ist nicht Ihre eigene?“ Lydia war überrascht.
„Oh nein!“ Ihre Tante schien schockiert. „Viel zu teuer! Außerdem ergibt es keinen Sinn, eine zu haben. Ich lebe am Rande des Dorfes und alles, was man braucht, ist leicht zu Fuß zu erreichen.“
„Mrs. Wardle-Penfield ist eine Freundin von Ihnen?“, erkundigte sich Lydia.
„Nun …“ Tante Camilla wählte ihre Worte sorgfältig. „Sie ist eine Nachbarin und eine der – der Säulen der Gesellschaft von Diddlington.“
Ein wenig mehr Überredung und Lydia schlussfolgerte, dass es sich bei der betreffenden Dame um eine geschäftstüchtige Frau handelte, die ihre Tante praktisch dazu genötigt hatte, ihre Kutsche zu benutzen, damit die großzügige Gabe von Mrs. Wardle-Penfield in der ganzen umliegenden Gegend wahrheitsgemäß verkündet wurde.
„Das war sehr nett von ihr“, bemerkte Lydia.
„Oh, sie ist immer bereit, Bedürftigen zu helfen“, sagte Camilla etwas zu schnell.
„Zweifellos ist sie dafür im Dorf gut bekannt.“
„Das ist sie in der Tat“, sagte Camilla nachdrücklich und erweckte den Eindruck, dass die Frau allein durch ihre Anwesenheit die Hauptstraße leeren könnte.
***
Als sie das Haus erreichten, hatte Lydias Fantasie ein recht gutes Bild von der Welt ihrer Tante geschaffen. Ihr Bekanntenkreis umfasste vielleicht zwei Dutzend Familien. Darüber hinaus gab es die Bediensteten und Händler, den Pfarrer und den Apotheker und deren begleitende Kinder und Verwandte. London war für sie ein Ort, den zwar jeder kannte, aber nur wenige tatsächlich gesehen hatten. Hier auf dem Land war alles gemächlich und ereignislos.
Trotzdem freute sich Lydia darauf, die verschiedenen Bewohner von Diddlington kennenzulernen, und war mit ihrem Schicksal vollkommen zufrieden. Louisas ausgelassene Partytour und ihre entschlossenen Bemühungen, die Jakobsleiter der Gesellschaft zu erklimmen, hätten ihr nicht halb so gut gefallen, und ein Mietshaus in London wäre ebenfalls wenig einladend gewesen.
Tante Camillas Cottage war zwar nicht gerade ein geräumiges Domizil, aber mit drei sehr komfortablen Schlafzimmern mehr als ausreichend für eine alte Jungfer und ihre Nichte. Zwei davon waren kaum bewohnt gewesen. Es gab ein großes Wohnzimmer, das durch zwei nach Süden ausgerichtete Fenster viel Licht einließ, und eine sehr kleine, aber saubere Küche. Ihre Tante hatte nur zwei Dienstboten: eine kurzsichtige Haushälterin, Mrs. Plumpton, und Charity, ein Dienstmädchen für alles. Letztere wohnte nicht im Haus, sondern teilte ihre Arbeitskraft zwischen Tante Camilla und Mrs. Isherwood in der nächsten Straße auf.
Lydias Bett war weich und warm und bekömmlich für eine Nacht ungestörten Schlafs. Wenn dieser Ort auch keine Aufregung bot, so würden ihre Erinnerungen an ihre Zeit hier doch wahrscheinlich angenehme sein. Kein Hauch der Gewalt konnte jemals diese ruhige englische Idylle stören.
KAPITEL DREI: DIE FREUDEN DES LANDES
Lydia stand normalerweise früh morgens auf. Das war auch gut so, denn sie stellte bald fest, dass die Öffnungszeiten auf dem Land anders waren als in den Städten und in dem Dorf Shepperton, am Rande Londons, wo ihre Familie lebte. „Früh zu Bett und früh aufstehen“ war hier wohl die Devise.
Am nächsten Morgen hatten sie bis neun Uhr gefrühstückt und sich mithilfe des Dienstmädchens ihrer Tante angezogen. Dann begleitete sie Tante Camilla auf einem Spaziergang entlang der Hauptstraße. Dies, so schien es, war ein Ritual, dem die bedeutendsten Bürger folgten.
Lydia zählte etwa zwanzig Fußgänger, als sie sich auf den Weg zum Kurzwarengeschäft machten, wo ihre Tante Bänder kaufen wollte. Sie gedachte, einen Hut zu verzieren, dem wohl das gewisse Etwas fehlte, um ihn unter den Hüten ihrer Bekannten hervorstechen zu lassen. Zwanzig Personen waren offenbar eine Menschenmenge auf den Straßen von Diddlington, nahm Lydia an.
Ihre Tante versicherte ihr jedoch eifrig, dass die Stadt dieser Tage an Bedeutung gewann. Dies lag an ihrer günstigen Lage am Ufer der Ouse zwischen Piddinghoe und Tarring Neville. Mit seiner guten Anbindung an Lewes und Brighton, wo die beliebten Pferderennen stattfanden, war das Golden Cockerel Inn zu einem beliebten Ort für Herren geworden, um bunte Vögelchen zu deponieren, deren Gefieder in den größeren Städten zu bunt waren und unerwünschte Aufmerksamkeit erregen könnten. Tante Camilla drückte es ihrem jungen Schützling gegenüber natürlich nicht ganz so grob aus. Leider war Lydia durchaus in der Lage, mit sehr wenig Aufwand genug darüber herauszufinden.
Dennoch waren die einzigen Personen, denen sie bei dieser Gelegenheit begegneten, Camilla alle sehr gut bekannt. Jeremiah Berwick, der Hufschmied, nickte und lächelte zur Begrüßung, und mehrere andere Herren zogen ihre Hüte und warfen einen anerkennenden Blick auf die schlanke Figur ihrer Tante.
Sie betraten den Kurzwarenladen, der für ein Landgeschäft eigentlich recht groß und gut ausgestattet war, und fanden bald die Bänder, die sie suchten – in einem Blauton, der zu den Augen ihrer Tante passte. Lydia interessierte sich mehr für eine kleine Auswahl an Pudern und Salben zum Polieren von Reitstiefeln.
Sie hatten ihren Einkauf gerade abgeschlossen, als das Geräusch einer sich öffnenden Tür und ein markantes „Hallo“ ihre Aufmerksamkeit erregten.
Die neue Kundin war Mrs. Wardle-Penfield höchstselbst. Sie war eine Frau mit einer ausgeprägten Präsenz. Ihre Persönlichkeit war so stark, dass sie fast greifbar war, und sie betrat nicht einfach einen Raum, sondern schien vielmehr in ihn einzudringen und seine Bewohner sofort gefangen zu nehmen.
Die arme Tante Camilla war völlig überwältigt und stammelte ihre ewige Dankbarkeit für die beispiellose Freundlichkeit und Herablassung ihrer Möchtegern-Kundin, die ihr die Nutzung ihrer Kutsche gestattete. Lydia, die vorgestellt wurde, fügte ihren eigenen, ruhigeren Dank hinzu.
„Unsinn!“, bellte Mrs. Wardle-Penfield sie an. „Wozu brauche ich eine Kutsche in diesem Dorf? Wenn ich sie nicht bräuchte, um ab und zu meinen Bruder in Hampshire zu besuchen, hätte ich sie schon vor Jahren verkauft. Mein lieber Bruder, der sich, wohlgemerkt, niemals selbst die Mühe macht, mich zu besuchen.“
„Oh, tatsächlich …“, begann Camilla, denn sie verspürte offenbar das Bedürfnis, sich zu äußern. Das hätte sie sich allerdings sparen können, denn die Dame schenkte ihr nicht die geringste Beachtung.
„Wie oft“, rief ihr Gegenüber, und ihre Stimme hallte dabei durch den Laden, als würde sie eine einsame Arie in Covent Garden einstimmen, „habe ich meinem Mann gesagt, dass die Kutsche eine ruinöse Geldverschwendung ist? Ich weiß es einfach nicht. Man kann schließlich für vereinzelte Ausflüge sehr schöne Kutschen zu sehr vernünftigen Preisen mieten. Aber der arme Kerl ist so altmodisch. Er besteht darauf, dass unsere Standards nicht auf das Allermindeste herabgesetzt werden sollten.“
„Ich denke, Sie sind sehr klug, Ma'am“, sagte Lydia freundlich, „indem Sie ihn auf Ihre gehobene Stellung aufmerksam machen. Wer würde jemals davon wissen, wenn Sie es nicht täten?“
Mrs. Wardle-Penfield runzelte die Stirn, nicht sicher, ob sie das als Kompliment auffassen sollte. Am Ende kam sie offenbar zu dem Schluss, dass es nichts anderes sein konnte, und fuhr mit ihrem Monolog fort.
„Ich bin sicher, meine liebste Miss Denton“, sagte sie mit einem eindringlichen Blick, „dass Sie möchten, dass Ihre Nichte die ehrenhaftesten Mitglieder unserer kleinen Gemeinde hier kennenlernt. Sie werden beide nächsten Freitag an meinem Kartenspiel teilnehmen.“
Dies war keine Einladung, sondern ein Befehl. Die Dame begann, die Freunde aufzuzählen, die sie in ihrem Haus erwartete. Als sie von der Qualität ihrer geplanten Erfrischungen zur exquisiten Webkunst des Teppichs in ihrem Salon übergegangen war, war Lydia völlig erschöpft und Tante Camilla machte sich nicht einmal mehr die Mühe, bei jedem Wort zustimmend zu nicken, sondern starrte ihre Peinigerin nur schweigend an und gab damit den Kampf der Höflichkeit einfach auf.
Aus diesem sozialen Purgatorium wurden sie durch die Ankunft eines großen und ziemlich unbeholfenen jungen Herrn gerettet, der seltsam unempfindlich gegenüber der hypnotisierenden Kraft der alten Frau zu sein schien. Diese Eigenschaft machte ihn Lydia sofort sympathisch.
„Guten Morgen, Ma'am!“, rief er Mrs. Wardle-Penfield fröhlich zu. „Wie geht es Ihnen, Miss Denton?“
„Du bist sehr fröhlich an diesem schönen Morgen, mein Junge!“
„Kein Grund, Trübsal zu blasen, Mrs. P“, antwortete er der alten Dame, die über diese Anrede nicht gerade erfreut zu sein schien.
„Wurden Sie bereits Miss Dentons Nichte vorgestellt?“, erkundigte sich Mrs. Wardle-Penfield.
„Nein“, antwortete er, „aber es macht mir nichts aus, wenn ich dafür jetzt ihre Bekanntschaft machen darf.“
Tante Camilla übernahm diese dankbare Aufgabe, und Lydia erhielt eine passable Verbeugung des Herren, dessen Name John Savidge war. Sie schätzte ihn als etwas älter als sie es selbst war, mit modischem Kurzhaarschnitt, sandfarbenem Haar und weit geöffneten braunen Augen. Sein Anzug war gut geschnitten, obwohl er wahrscheinlich nicht von einem Londoner Schneider stammte. Dafür sah er nämlich eine Spur zu bequem aus.
„Wie geht es deiner Großmutter?“, fragte ihn Tante Camilla. „Sie lebt doch noch in Piddinghoe, nicht?“
„Ja, durchaus, Ma'am.“ Er grinste verkniffen. „Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht droht, sich ins Jenseits zu verabschieden, aber ich sage ihr, sie wird noch auf all unseren Gräbern tanzen.“
Das abschätzige Benehmen des jungen Mannes passte Mrs. Wardle-Penfield offensichtlich nicht. Schon bald bemerkte sie ein weiteres Opfer, das vor dem Schaufenster vorbeiging, und machte sich auf die Suche nach neuem Vergnügen.
Lydia und ihre Tante folgten ihr nach draußen, doch glücklicherweise führte ihr Weg in die entgegengesetzte Richtung. Bald gesellte sich auch Mr. Savidge zu ihnen, der seinen eigenen Einkauf abgeschlossen hatte und mit mühelos langen Schritten die kurze Distanz zwischen ihnen aufholte.
Kaum war er neben ihnen aufgetaucht, fiel Lydia auf der anderen Straßenseite ein sehr markantes Gesicht auf.
„Es ist Nase!“ Die Worte platzten aus ihr heraus, bevor sie nachdenken konnte.
„Wie bitte?“ Tante Camilla drehte sich mit einem verwunderten Blick zu ihr um.
„Wessen Nase?“, fragte Mr. Savidge, ebenso überrascht, der offenbar um ihre geistige Gesundheit nicht so besorgt war, wie ihre Tante.
Lydia errötete unwillkürlich.
„Der Herr dort gegenüber“, gestand sie und achtete darauf, nicht mit dem Finger auf ihn zu zeigen oder ihn anzustarren.
Die anderen beiden richteten ihren Blick auf die gegenüberliegende Seite der Hauptstraße. Nase war in ein Gespräch mit einem anderen Mann vertieft, der deutlich besser aussah und um einige Jahre jünger war.
„Das ist Monsieur D'Almain!“ Ihre Tante errötete plötzlich ziemlich atemlos.
„Ich glaube, Ma'am“, sagte Mr. Savidge lächelnd, „dass sie den anderen Herren meint.“
„Oh.“
„Er saß mir in der Kutsche gegenüber“, informierte Lydia sie hastig. „Ich – nun, ich konnte sein Gesicht einfach nicht vergessen.“
„Das glaube ich auch!“, stimmte John Savidge zu. „Wie auch mit diesem riesigen Ding, das ihm in der Mitte dort feststeckt.“
Lydia konnte sich bei seinen Worten kaum ein Kichern verkneifen. Doch während sie darum kämpfte, die Kontrolle über sich zu behalten, verbeugte sich Nase vor dem anderen Herrn – Monsieur D'Almain, wie es schien – und ging den Bürgersteig entlang. In diesem Moment bemerkte D'Almain ihre Anwesenheit, zog seinen Hut und verbeugte sich. Er versuchte nicht, sich ihnen anzuschließen, sondern drehte sich um und ging weiter.
„Für einen Franzosen ist er gar kein so schlechter Kerl“, bemerkte Mr. Savidge. „Bleibt zwar die meiste Zeit für sich, aber ist ein aufrichtiger Gentleman.“
„Das ist er in der Tat“, sagte Tante Camilla mit einem in keinem Verhältnis zum Thema stehenden Maß an Enthusiasmus, wie Lydia fand.
„Also, ich muss los“, sagte John fröhlich. „Guten Tag, meine Damen.“
Mit diesen Worten betrat er das Gasthaus, an dem sie gerade vorbeikamen.
„Wer ist er?“, fragte Lydia, als er sie verlassen hatte.
„John?“, fragte Tante Camilla etwas abgelenkt.
„Ja.“
„Seinem Vater gehört das Gasthaus“, erklärte ihre Tante.
„Er ist sehr nett.“
„Und gutmütig“, stimmte sie zu und blickte nach links, wo die beiden Herren vor kurzem noch gestanden hatten. „Und dazu ziemlich wohlhabend. Es ist schade, dass das Vermögen seiner Familie aus dem Handel stammt.“
„Das macht doch nichts“, tat Lydia diesen gesellschaftlichen Makel mit verächtlichen Worten ab.
„Vielleicht nicht.“
Lydia musterte ihre Tante neugierig. Sie hörte kaum zu und war in seltsame Träumereien versunken. Es war nicht schwer, dies mit dem plötzlichen Erscheinen eines gewissen Monsieur D'Almain in Verbindung zu bringen.
Lydia lächelte in sich hinein und dachte, dass ihr Morgen viel ereignisreicher gewesen war als erwartet. Sie hatte eine Einladung zu einem Kartenspiel erhalten – auch wenn diese von einer alten Hexe stammte –, war einem attraktiven jungen Herrn vorgestellt worden und hatte die aufkeimende Romanze zwischen ihrer Tante und einem geheimnisvollen Franzosen entdeckt. Der Tag hätte nicht vielversprechender beginnen können!
Das Land war offensichtlich unterhaltsamer, als die meisten Leute vermuteten. Ihr Besuch würde vieles mit sich bringen, aber langweilig würde es ihr hier sicherlich nicht werden.
KAPITEL VIER: EIN BLUTIGER MORD
Alle, die Mrs. Wardle-Penfields Kartenparty besuchten, waren sich einig, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war. Nicht, dass Mrs. Wardle-Penfield etwas anderes geduldet hätte, aber dieses Mal musste sie niemanden dazu drängen, seine uneingeschränkte Zustimmung zu äußern.
Es war nicht das mittelmäßige Können der einzelnen Spieler, das zu einem so günstigen Urteil führte. Weder das Spiel Whist noch Speculation konnte die Gäste aufheitern, die erwartet hatten, etwas Fürchterliches ertragen zu müssen. Die Einsätze waren gering, aber nicht so gering wie die Erwartungen der erlesenen Gesellschaft, die sich an diesem denkwürdigen Abend im großen Salon von Fielding Place versammelte.
Was dafür sorgte, dass niemand unzufrieden mit seinem Schicksal abreiste, war ein Gerücht, das so unglaublich und entsetzlich war, dass mehrere Spiele unterbrochen wurden, um die vielen Einzelheiten zu hören. Diese wurden so ausgefeilt und mit solcher Überzeugung erzählt, dass es nicht lange dauerte, bis die Wahrheit unter einer Lawine Spekulationen unterging. Denn dies war kein gewöhnlicher Vorfall, bei dem es um Diebstähle eines Dieners ging, und auch nicht um die neuesten Eskapaden der Carlton House-Clique. Es war auch nicht das ferne Grollen der Angst, dass Napoleon Bonaparte von der Insel St. Helena entkommen sein könnte, und nun plante, erneut Chaos auf dem Kontinent auszulösen. Es war etwas, das deutlich näher an der Heimat geschehen war – tatsächlich direkt vor ihrer Haustür: ein Mord.
Lydia und Tante Camilla hatten noch keine Ahnung, was sie erwartete, als sie sich auf die Party vorbereiteten. Lydia amüsierte sich ein wenig über ihre Tante, deren Nerven bei dem Gedanken, sie könnte in Gegenwart ihrer berühmten Gastgeberin einen schrecklichen Fauxpas begehen, blank lagen. Sie zwirbelte jede einzelne Locke ihrer schlichten Frisur mehrfach, glättete jegliche Falte ihres weizenfarbenen Satinkleides mindestens ein Dutzend Mal und murmelte düstere Vorhersagen über das Wetter. Sie meinte, es war eine düstere Unvermeidlichkeit, dass sich die Schleusen des Himmels genau in dem Moment öffnen würden, in dem sie sich zu Fuß auf den Weg zu ihrem vereinbarten Ziel machen würden. Die folgende Sintflut würde sie von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedecken und sie zum Gespött der anderen Gäste machen.
Solche Ängste trübten die Stimmung ihrer Nichte aber nicht. Lydia betrachtete sich fast beiläufig im Spiegel über dem kleinen Kaminsims im Salon. Ihr Haar war von Natur aus lockig, sodass sie nie auf ein Hitzeeisen zurückgreifen musste. Abgesehen davon war an ihrem Aussehen nicht viel Bemerkenswertes. Der cremefarbene Musselin ihres Kleides ließ ihre Haut fahl erscheinen, und ihre Handschuhe waren abgenutzt, aber sie war überzeugt davon, dass die meisten im Dorf diese kleinen Mängel nicht bemerken würden. Und selbst wenn, konnte sie sowieso nichts dagegen tun. Man musste schließlich versuchen, alles philosophisch zu sehen. Sie war eben keine Schönheit.
Sie rechnete einfach damit, dass sich bei ihrem Auftritt niemand umdrehen würde, es sei denn, sie stolperte über ihre Schleppe.
Wie üblich lag sie mit ihrer Vermutung richtig. Als sie das anerkannte Haus betraten, von dem sie in den letzten drei Tagen so viel gehört hatte, wurden sie von Mrs. Wardle-Penfield mit gnädiger Herablassung begrüßt und zu einem Whist-Tisch gescheucht, wo sie ihren Partnerinnen, den beiden Digweed Ladies, vorgestellt wurden. Diese waren unverheiratete Schwestern mittleren Alters, die nicht unweit von ihrem eigenen Häuschen wohnten. Von diesen redseligen Damen erfuhren Lydia und ihre Tante die schockierende Neuigkeiten zum ersten Mal.
Sie spielten schon einige Minuten und Lydia merkte, dass ihre Tante nicht die ideale Partnerin für Whist war. Lydia war eine versierte Spielerin, die ihren Papa regelmäßig besiegte, aber Camilla schien sich nicht einmal im Klaren darüber zu sein, welches Spiel sie überhaupt spielten. Sie vergaß häufig, Karten zu setzen, und bald wurde klar, dass sie mit absoluter Wahrscheinlichkeit verlieren würden. Lydia konnte nichts anderes tun, als ihr Schicksal so würdevoll wie möglich hinzunehmen.
„Ich nehme doch an“, sagte die jüngere Miss Digweed mit einem Mal, und warf Tante Camilla über den Rand ihrer Karten hinweg einen schelmischen Blick zu, „dass Sie von dem Mord gehört haben, Miss Denton?“
„Mord?“
Lydia befürchtete, dass ihre Tante in Ohnmacht fallen würde. Sie presste ihre Karten mit einem Mal an ihre Brust, während etwas, das einem Krampf ähnelte, über ihr Gesicht huschte.
„Oh je!“, rief die andere Miss Digweed. „Sie wissen es noch nicht?“
Diese Gelegenheit war offenbar zu verlockend, um widerstehen zu können. Es gab immerhin nichts Schöneres als die Freude, wenn man als Allererster dramatische Neuigkeiten überbringen durfte. In diesem Fall hatten sie doppeltes Glück, denn sie hatten nicht nur einen, sondern gleich zwei Zuhörer, die ihrer Geschichte mit der stärksten Aufmerksamkeit lauschten, die sie sich nur hätten wünschen konnten.
Die Geschichte entwickelte sich so schnell und wurde immer wieder von der einen Miss Digweed, dann der anderen erzählt, sodass Lydia bald nicht wusste, was passiert war – und ob überhaupt etwas passiert war.
„Eine junge Frau –“, begann Miss Janet Digweed.
„Nein, nein“, korrigierte Miss Digweed sie sofort. „Ein alter Mann.“
„In Wickham Wood.“
„Oder zumindest fast.“
„Niedergestochen –“
„Geschlagen –“
„Gestern Morgen gefunden –“
„Abends –“
„Vom jungen Tom Fowle –“
„Sein Bruder, Jimmy –“
„Schrecklich!“
„Schrecklich!“
„Aber – aber stimmt es?“ Tante Camilla unterbrach schließlich diese interessante Erzählung. „Ich kann es nicht glauben!“
„Verzeihen Sie mir“, unterbrach Lydia sie und wandte sich gleichzeitig an beide Schwestern. „Wer wurde getötet?“
Die Damen Digweed wirkten ziemlich überrascht. Eine solche Frage war ihnen anscheinend nicht in den Sinn gekommen.
„Nun, um ganz ehrlich zu sein“, antwortete die Älteste, „wissen wir das nicht.“
„Niemand weiß es.“
„Aber es ist mit Sicherheit jemand tot.“
„Es erinnert mich an das andere Mal“, sagte Tante Camilla und ihre Lippen zitterten. „Ich hätte nie gedacht …“
„Ich denke“, sagte Lydia entschieden, „dass du am besten auf dem Sofa Platz nimmst, Tante. Du hast einen Schock erlitten.“
Die Schwestern lächelten ihre Nachbarin freundlich an und freuten sich sichtbar über deren Anteilnahme an den Nachrichten.
„Vielleicht irgendein Bettler“, überlegte Miss Digweed.
„Jetzt ein Glas Wein“, schlug ihre Schwester vor.
Lydia entschuldigte sich höflich und führte ihre Tante in eine leere Ecke des Zimmers. Sie gab einem Diener ein Zeichen und schaffte es, ein kleines Glas Brandy zu besorgen, das sie ihrer Tante aufdrängte. All dies erregte die Aufmerksamkeit ihrer Gastgeberin, die sich zielstrebig auf sie stürzte.
„Was ist nur los?“, fragte sie und blickte bedrohlich über die beiden, die auf dem Sofa saßen.
„Liebe Mrs. Wardle-Penfield“, flüsterte Tante Camilla, „ich habe bis heute Abend nichts davon gehört. Ich wusste nicht …“
„Was sagen Sie da, Camilla?“, fragte die ältere Frau mit berechtigter Verärgerung.
„Wir haben gerade vom entsetzlichen Todesfall in Wickham Wood erfahren“, antwortete Lydia für sie.
„Ach, das.“ Die tragische Tat wurde mit einem leichten Achselzucken und einem Verziehen ihrer Lippen abgetan, was den Eindruck erweckte, dass Mord bloß ein gesellschaftlicher Sprachfehler war, den Mrs. Wardle-Penfield definitiv nicht billigen wollte. „Ich wette, irgendein betrunkener Lümmel, der hingefallen und mit dem Kopf gegen einen Stein geschlagen ist.“
„Kennt jemand die Identität des toten … Mannes?“, erkundigte sich Lydia zögernd.
„Das glaube ich nicht!“, empörte sich die hochmütige Dame. „Solche Personen verkehren ganz sicher nicht in unseren Kreisen.“
Nachdem sie sich so von jedem distanziert hatte, der so ungezogen war, sich ermorden zu lassen, kam sie wieder auf das Thema der Nerven ihrer lieben Freundin zurück. Sie erklärte, Tante Camillas Konstitution sei viel zu empfindlich für solche Themen, und dass es ein Wunder sei, dass sie für ihr Alter noch so gut in Form war. Dann empfahl Mrs. Wardle-Penfield Dr. Humblebees Tonikum als unfehlbares Heilmittel für jeden, der zu Schwächeanfällen neigt. Mit einem kräftigen Klaps auf Camillas Schultern kehrte sie seufzend zu ihren anderen Gästen zurück.
***
Miss Camilla Dentons Kummer war jedoch von einigen interessierten Zuschauer bemerkt worden. Der französische Gentleman Monsieur D'Almain eilte zu ihnen. Er drückte echte Besorgnis aus, und seine Sanftheit und sein angenehmes Gemurmel hatten eine beruhigende Wirkung auf die betroffene Dame.
Es dauerte vielleicht eine Viertelstunde, bis sich ihre Tante so weit erholt hatte, dass sie sich wieder zu den Whist-Spielern gesellen konnte. Die Gesellschaft war inzwischen beträchtlich gewachsen, und an keinem der Tische schien es mehr viele freie Plätze für einen weiteren Partner zu geben. Schließlich fand sich dann doch einer für Camilla. Lydia blieb jedoch an der Wand. Das gefiel ihr besser, da sie schon gelernt hatte, wie schlecht ihre Tante spielte. Es war viel interessanter, ruhig dazusitzen und die versammelte Gesellschaft zu beobachten. Und für Camilla war es jedenfalls besser, wenn sie abgelenkt wurde, sodass sie keine Gelegenheit mehr hatte, über die Tragödie nachzudenken.
Innerhalb weniger Minuten erspähte Lydia einen großen Kopf, der über die anderen im Raum hinausragte. Es war der junge Herr, den sie ein paar Tage zuvor kennengelernt hatte: Mr. Savidge. Trotz seines burschikosen Aussehens war er kurz davor, volljährig zu werden. Zu ihrer Überraschung kam er auf sie zu und ließ sich neben ihr auf dem Sofa nieder.
„Sie spielen nicht, Mr. Savidge?“, fragte sie ihn, nachdem die obligatorischen Begrüßungen erledigt waren.
„Ich mag keine Karten“, gestand er. „Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen. Ich ziehe Pferderennen vor.“
„Besuchen Sie dann Lewes oft?“
„So oft ich kann.“
„Ich verstehe nicht viel von Pferden“, sagte Lydia entschuldigend. „Aber ich muss gestehen, dass es unterhaltsamer klingt als das, was wir heute Abend machen.“
„Es könnte kaum weniger unterhaltsam sein, nicht wahr, Miss?“
Sein Gesicht verzog sich zu einem ansteckenden schelmischen Lächeln.
„Sie finden das Leben in Diddlington langweilig?“, fragte sie ihn kühn.
„Oh, so schlimm ist es nicht.“ Er zuckte philosophisch die Achseln. „Ich meine, man macht doch immer das Beste aus dem, was einem geboten wird.“
„Die Digweed Ladies haben uns darüber informiert, dass es in der Nähe des Waldes hier einen ziemlich … ungewöhnlichen Todesfall gegeben hat.“
„In der Tat.“ Er nickte. „Ich zweifle nicht daran, dass sie alles wahrheitsgetreu übermittelt haben.“
Lydia kicherte. „Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelt.“
„Um die Wahrheit zu sagen“, er senkte die Stimme und neigte verschwörerisch den Kopf zu ihr, „es war schwer, viel zu erkennen. Fürchterliche Angelegenheit, das kann ich Ihnen versichern.“
„Sie haben die Leiche gesehen?“ Sie konnte den Neid nicht aus ihrer Stimme verbannen. Herren schienen immer mehr Spaß zu haben als Damen.
„Oh ja“, sagte er, nicht prahlerisch, sondern ganz selbstverständlich. „Mein Vater ist Diddlingtons Richter.“
„Ist er das?“ Sie war überrascht. „Ich dachte, Ihr Vater besäße den Goldenen Hahn.“
„Das stimmt auch“, sagte der junge Mr. Savidge. „Er ist einer der reichsten Männer der Stadt. Eigentlich sollte Sir Hector Mannington Friedensrichter sein, aber er ist fast neunzig und nicht mehr gut zu Fuß, der arme Mann.“
„Und Sie sagen, der Ermordete war nicht wiederzuerkennen?“
„Mir scheint“, sagte John Savidge langsam und bedächtig, „dass jemand sicherstellen wollte, dass er nicht erkannt werden konnte.“
„Warum das?“
„Nun, das Gesicht war mit einem großen Stein eingeschlagen worden, der in der Nähe gefunden wurde. Außerdem …“
Hier wurde ihr kleines Tête-à-Tête von Mr. Savidges Vater unterbrochen. Wie sein Sohn war Mr. Thomas Savidge ein großer Mann mit kräftigen Händen. Doch während der jüngere ein eher ruhiges Gemüt zu haben schien, war der Gastwirt ein lauter, ungestümer Kerl, dessen Stimme einem Jagdhorn ähnelte. Er übernahm sofort das Gespräch und machte Lydia einige unverschämte Komplimente. Sie beachtete sie jedoch nicht, da es sich scheinbar darum handelte, was Mr. Savidge fälschlicherweise für die richtige Etikette im Umgang mit jungen Damen hielt.
„Du darfst mit dieser schönen Dame gegenüber nicht über Pferde oder sonst etwas schwadronieren, John“, ärgerte er seinen Sohn. „Ich möchte nicht, dass sie sich mit leerem Geschwätz langweilen muss.“
„Wir haben über den Mord gesprochen“, informierte ihn Lydia offen.
Mr. Savidge runzelte die Stirn. „Was für ein Dummkopf du bist, Junge!“, rief er laut, woraufhin sich mehrere Köpfe in seine Richtung drehten. „Es schickt sich ganz und gar nicht, einer jungen Dame den Kopf mit Albträumen und dergleichen vollzustopfen. Du hast keine Ahnung, wie du mit Frauen umzugehen hast, mein Junge! Flirten: das ist die Lösung.“
„Oh, bitte, das stört mich überhaupt nicht“, beeilte sich Lydia, ihm mitzuteilen. „Ich finde das Thema absolut faszinierend. Und ich versichere Ihnen, ich weiß vom Flirten genauso wenig wie Ihr Sohn.“
Der Wirt wollte davon nichts wissen. Er fuhr fort, seinem Sohn völlig unangebrachte Umgangsformen mit dem schönen Geschlecht beizubringen, bis er schließlich von Mrs. Wardle-Penfield entführt und an einem der Kartentische eingebuchtet wurde. Lydia und John konnten ihre Unterhaltung nun ungehindert fortsetzen.
„Tut mir leid wegen meinem Vater“, murmelte John.
„Oh, das muss es nicht!“, sagte Lydia. „Ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam.“
„Er kann leider ein wenig – überwältigend sein.“
„Ich bin überrascht, dass unsere liebe Gastgeberin ihn so leicht zu kontrollieren vermag“, antwortete sie eher wahrheitsgetreu als taktvoll.
„In dieser Hinsicht gibt es keine Probleme.“ John kicherte. „Papa glaubt, dass Mrs. P nichts falsch machen kann. Er hofft, unter ihrer Schirmherrschaft in der Gesellschaft aufzusteigen.“
„Und Sie?“
„Oh, solche Ambitionen habe ich nicht.“
„Gott sei Dank!“ Lydia war sehr erfreut über die lockere, ungekünstelte Art ihres Begleiters. Er gehörte weder zur vornehmen Familie noch hielt er sich für einen solchen. Das war höchst erfrischend.
„Es hat keinen Sinn vorzutäuschen, jemand zu sein, der man nicht ist. Ich bin zwar in Harrow erzogen worden, aber ich bin der Sohn eines Gastwirts und schäme mich nicht dafür.“
„Erzählen Sie mir mehr über den Mord“, beharrte sie.
„Wer auch immer der Schuldige sein mag“, sagte John, „entweder hegte er einen Groll gegen das Opfer oder wollte nicht, dass jemand dessen Identität erfährt.“
„Aber das Opfer ist ein Mann?“
„Definitiv.“
„Allerdings wurde er durch einen Stein schrecklich entstellt …“
„Mehr als das, Miss Bramwell.“
„Du meine Güte! Was könnte noch passiert sein?“
„Der Körper war mit Öl bedeckt und angezündet –“
Lydia hielt den Atem an. Es war faszinierender, als sie es sich je hätte vorstellen können.
„Wie schrecklich!“, hauchte sie. „Kein Wunder also, dass niemand sagen kann, wer es ist.“
„Ich habe so meine Vermutungen.“
„Tatsächlich?“ Sie musterte ihn mit wachsendem Respekt.
„Ich bin fast sicher, dass es Ihr Freund Nase ist.“
Lydia errötete unwillkürlich. Trotzdem durfte sie sich den Spaß nicht durch Verlegenheit verderben lassen.
„Der Herr von der Postkutsche?“
„Genau. Ein gewisser Mr. Cole.“ John nickte nachdrücklich. „Er hat im Gasthof übernachtet, wurde aber seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Seine Tasche und seine Sachen liegen noch dort.“
„Könnte er es wirklich sein?“
„Ich würde eine gehörige Summe darauf wetten.“
Lydia blickte sich im Zimmer um und betrachtete die lächelnde, gestikulierende Gruppe. Ihr Blick fiel auf eine verzierte Uhr, die den Kaminsims auf der anderen Seite des Zimmers schmückte, und ihr kam plötzlich ein Gedanke.
„Wissen Sie, ob bei der – der Leiche eine silberne Uhr gefunden wurde?“, fragte sie.
Ein überraschter Ausdruck huschte über Mr. Savidges Gesicht. „Ja, wurde es.“
„Mit irgendwelchen grotesken Gesichtern verziert?“
„Die Masken der Komödie und der Tragödie.“ Er nickte.
„Ich habe gesehen, wie er sie auf der Reise mehrmals herausgeholt hat“, erklärte sie. „Er wollte Ohren damit beeindrucken.“
Natürlich musste sie dann die merkwürdigen Körperteile von Mr. Coles Reisegefährten erklären, was John fast einen Freudenschrei entlockte. Als er sich wieder unter Kontrolle hatte, sagte er, dass er diese Information an seinen Vater weitergeben würde. Es schien, als sei der Tote nun zweifelsfrei identifiziert worden.