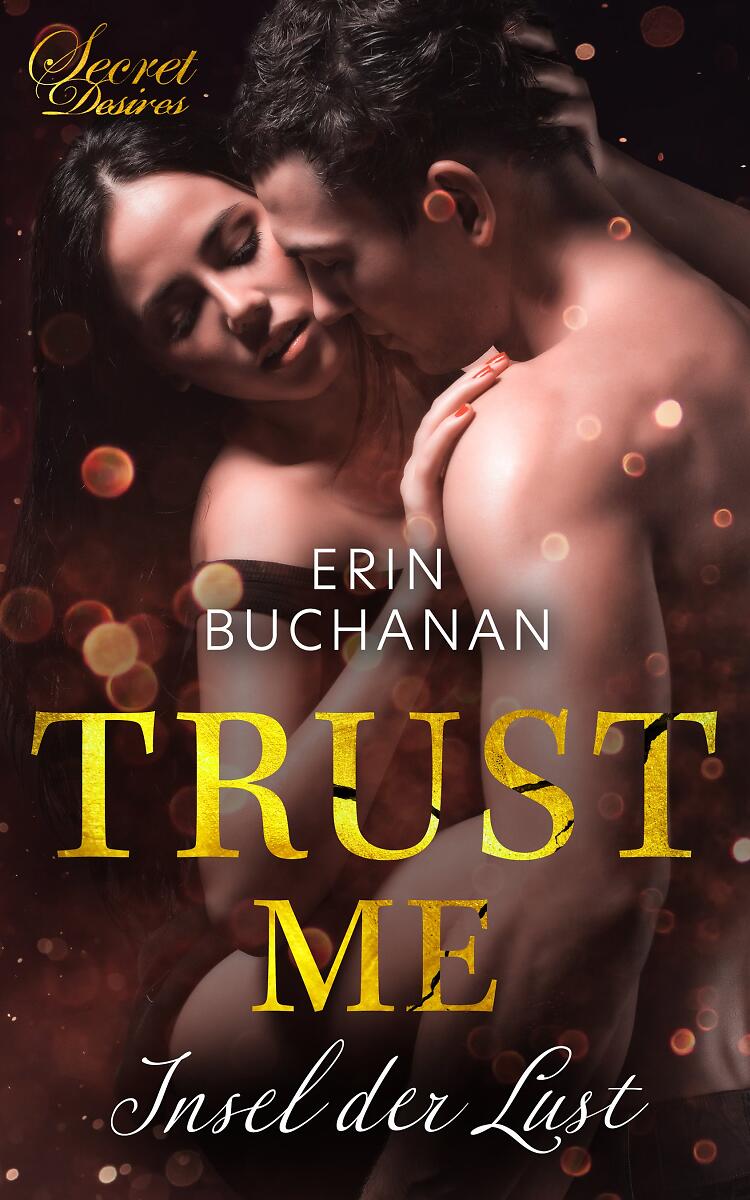Kapitel 1
„Na, Phoebe, freust du dich schon auf die nächsten Chartergäste?“, fragt mein bester Freund Jamie, der sich gerade am Steuer unserer Yacht Sunny Dreams befindet.
„Geschenkt“, erwidere ich lachend. „Ich liebe sie alle, das weißt du doch.“
Um ehrlich zu sein, bin ich bisweilen recht genervt von einigen der schwerreichen Touristen, die wir durch die Karibik schippern. Ihnen mangelt es mitunter an den einfachsten Umgangsformen, und sie verhalten sich, als gehöre ihnen die Welt. Jamie und mich behandeln sie oft wie ihre persönlichen Sklaven, was meine ohnehin schon recht karge Geduld auf eine harte Probe stellt.
„Bald ist das Boot abbezahlt“, sagt Jamie, als könne er in meinen Kopf schauen.
Der Gedanke an unsere Yacht zaubert ein Lächeln auf meine Lippen. „Dann können wir endlich mit den Preisen runtergehen und mit Individualisten reisen.“
Momentan sind wir allein, denn Jamie und ich haben uns eine kleine Auszeit genommen, um uns die Pracht der Karibik als reine Genießer zu Gemüte zu führen. Wir wollen an einer Bucht vor Anker gehen, die für ihr traumhaft klares Wasser bekannt ist und ein wenig schnorcheln. Morgen werden wir sie erreichen, worauf ich mich ebenso freue, wie auf den Strand mit dem reinweißen Sand.
Schon als kleines Kind war ich von Schiffen fasziniert. Meine Eltern besaßen ein Boot, auf dem wir jedes Jahr die Sommerferien verbrachten. Ich liebte den Geruch des Meeres, das Gefühl unendlicher Freiheit, wenn kein Land in Sicht ist. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Mom und Dad wohnen noch immer in ihrem alten Haus in Strandnähe; von dort sind sie nicht wegzubekommen. Die beiden Lehrer sind nun im Ruhestand. In regelmäßigen Abständen fliege ich sie besuchen, denn Miami ist und bleibt meine Heimat, auch wenn es mich immer wieder in die Ferne zieht.
Auf der Segelschule lernte ich Jamie kennen. Damals war ich fasziniert von seiner Ausstrahlung, die mich an einen Freibeuter erinnerte. Mit seinem braungebrannten Gesicht und den verstrubbelten, halblangen blonden Haaren bot er ein Bild der Verwegenheit. Von der ersten Sekunde an verstanden wir uns gut, doch es war von Anfang an klar, dass es keine sexuelle Anziehung zwischen uns geben würde. Als uns Jahre später die Sunny Dreams zu einem Schnäppchenpreis angeboten wurde, schlugen wir sofort zu.
Seitdem schippern wir reiche Touristen durch die Karibik, bis das Boot abbezahlt ist. Unser Ziel, mit Abenteurern und Freigeistern zu reisen, verlieren wir dabei nie aus den Augen.
Mit verträumtem Blick lehne ich mich halb über die Reling und beobachte den atemberaubenden Sonnenuntergang, der den Himmel in bunten Farben brennen lässt. Statt das Farbenspiel zu bewundern, schließe ich die Lider, inhaliere tief den Geruch nach Meer und Freiheit.
Abwesend streiche ich mir durch meine kurzen, blonden Haare. Zusammen mit meiner kleinen Nase und meinen veilchenblauen Augen sehe ich aus wie das typische Klischee eines Blondchens. Zumindest ist meine Figur sportlich, was mich ein wenig über diese Tatsache hinwegtröstet.
Ob es auch an meinem Aussehen liegt, dass ich bisher nur Probleme mit Männern gehabt habe?, frage ich mich wie so oft. Wieso konnte ich mich zum Beispiel nicht einfach in Jamie verlieben? Er wäre der perfekte Partner; einfühlsam, sieht gut aus und hat genau meinen Humor. Jamie ist einfach ein richtig netter Kerl. Dummerweise stehe ich jedoch auf finstere Typen – die klassischen Bad Guys.
Inzwischen habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass es einen Mann gibt, der mir an innerer Stärke zwar ebenbürtig ist, aber dennoch einen weichen Kern besitzt. Ich brauche einen Mann, der es mit mir aufnehmen kann. Trotz, oder vielleicht auch wegen, meines Äußeren, gebe ich mich nach außen hin gerne taff und übernehme das Kommando. Innerlich sehne ich mich nach einem Mann, der einfühlsam auf mich eingeht und mir, wenn nötig, trotzdem Paroli bieten kann. Manchmal muss man mir nämlich schon in den Hintern treten, wenn ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand will.
Jamie ist dafür viel zu nett. Er akzeptiert alle meine Macken mit einer Gelassenheit, die mich manchmal aufregt. Ihm würde es nie in den Sinn kommen, mir zu sagen, wenn ich zu weit gehe. Stattdessen schmunzelt er dann nachgiebig und geht mir eine Weile aus dem Weg. Dafür ist er mir immer ein Freund, würde mich nie im Stich lassen.
Ich seufze, bevor ich mir innerlich einen Ruck gebe. Was beschwere ich mich hier eigentlich? Immerhin lebe ich meinen Traum, indem ich mit der Sunny Dreams durch die Karibik segle. Den Duft der Freiheit immer in der Nase, kann ich tun und lassen, was ich will. Wer kann das schon von sich behaupten? Wenn ich dafür meine Träume verwirklichen kann, bin ich bereit, auf Männer zu verzichten.
***
Die Mittagshitze brennt sich durch meine Baseballkappe, als ich neugierig nach der Bucht Ausschau halte. Weit kann es nicht mehr sein.
Voller Vorfreude beobachte ich ein paar fliegende Fische bei ihren akrobatischen Übungen. Ich mache Jamie gerade darauf aufmerksam, als eine Explosion das Boot erschüttert.
In nicht einmal dem Bruchteil einer Sekunde herrscht das absolute Chaos. Aus der Kajüte schlagen Flammen. Ich renne zum Feuerlöscher, um festzustellen, dass Jamie bereits vor Ort ist. Er entsichert ihn, hält voll auf die Luke zum Unterdeck. Zunächst scheint es, als bekäme er das Feuer unter Kontrolle. Dann erschüttert eine weitere Explosion mein geliebtes Boot und ich weiß, jetzt ist alles aus.
„Aufs Beiboot!“, brülle ich aus vollem Hals.
Mit einem Fluchen wirft Jamie den Feuerlöscher beiseite, rennt zu den Rettungswesten. Ohne Federlesen werfe ich ihm eine zu und ziehe mir meine über. Eigentlich müsste ich jetzt von Bord springen, doch ich zögere, werfe einen letzten Blick auf das flammende Inferno. Meinem Baby steht eine Havarie bevor.
Die Sunny Dreams ist nicht mehr zu retten.
Mit ihr gehen meine Träume unter, schießt es mir durch den Kopf, bevor ich mit brennenden Augen ins Meer springe.
Jamie ist schneller. Er reicht mir eine Hand, zieht mich auf das Dinghi. Mit Tränen in den Augen hole ich ein Messer aus meiner Cargohose, um das Seil zu kappen, welches das kleine Schlauchboot und die Yacht miteinander verbindet. Derweil lässt Jamie den Motor an. Sobald das Beiboot frei ist, gibt er Gas. Langsam tuckern wir weg von meinem Lebenstraum. Mir blutet das Herz, meine Yacht alleine lassen zu müssen, doch mir bleibt keine Wahl. Ein Schluchzer bahnt sich seinen Weg. Ihn kann ich nicht unterdrücken, doch alle weiteren schlucke ich mühsam hinunter.
„Handbreit“, flüstere ich als letzten Abschiedsgruß, bevor mich der Schock übermannt.
Jamie übernimmt das Kommando. Geübt steuert er das Beiboot in Richtung einer Insel, die sich am Horizont abzeichnet. Obwohl ich weiß, dass es mir danach noch schlechter gehen wird, drehe ich mich zur Sunny Dreams um. Mit Tränen in den Augen sehe ich, wie der Bug untergeht. Viel zu schnell ist die Yacht komplett im Meer versunken.
Ich sitze reglos da und versuche, das Geschehene irgendwie zu verarbeiten. Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Wird die Versicherung den Schaden übernehmen oder bin ich jetzt nicht nur arbeits-, sondern auch heimatlos? Was hat das Feuer verursacht? Bestimmt ist der kleine Gastank explodiert, den wir zum Kochen benötigen. Derlei geschieht zwar sehr selten, doch es kommt vor. Typisch, dass es ausgerechnet mein Baby erwischt. Ich schlucke schwer, dränge die aufsteigenden Tränen zurück. Mühsam reiße ich mich zusammen. Zunächst geht es ums nackte Überleben. Wie Jamies und meine Zukunft aussieht, werden wir später herausfinden.
Nach einer gefühlten Ewigkeit tuckert das Dinghi in eine kleine Bucht. Jamie stellt den Motor ab.
„Schaffst du es, mir zu helfen?“, fragt er.
Ich nicke nur.
Gemeinsam ziehen wir das kleine Boot heil an Land. Weit werden wir damit zwar nicht kommen, doch es ist ein beruhigendes Gefühl, auf See zumindest ein wenig mobil zu sein.
Erschöpft lasse ich mich neben Jamie in den Sand fallen. Ich bleibe einige Zeit liegen. Mein Gehirn fühlt sich an wie in Watte gepackt, und ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Auch Jamie scheint es ähnlich zu ergehen, denn auch er schweigt. Wie zwei Leichen liegen wir nebeneinander im Sand, während die Sonne auf uns herabbrennt. Irgendwann fühle ich mich wieder in der Lage, zu sprechen.
„Wenn wir Pech haben, ist die Insel unbewohnt.“ Langsam richte ich mich auf und blicke mich zum ersten Mal bewusst um.
Das Wasser funkelt in der Sonne von Türkis bis Dunkelblau, bildet einen harmonischen Kontrast zum weißen, von Palmen gesäumten Sandstrand. Es fehlt nur noch eine Hängematte nebst Drink in einer halben Kokosnuss, um die Illusion eines Traumurlaubs perfekt zu machen.
„Wir sollten schleunigst zusehen, dass wir Trinkwasser finden“, sagt Jamie wie aufs Stichwort.
Ich nicke. Wir haben zwar ein kleines Überlebenspaket im Dinghi verstaut, doch weit werden wir damit nicht kommen. Wir sind uns einig, die kargen Vorräte für wirklich schlechte Zeiten aufzubewahren. Die bald kommen werden, da die Insel sehr wahrscheinlich unbewohnt ist. Nichts deutet bisher darauf hin, dass Menschenhand am Werk gewesen ist. Es gibt keinen Anlegesteg und ein Boot ist auch nirgends zu sehen.
Jamie und ich machen uns auf den Weg, die Insel zu erkunden. Indem wir eng nebeneinander gehen, fühle ich mich nicht ganz so schrecklich. Wenigstens bin ich hier nicht allein gestrandet.
Auf dem Sand verstreut liegen ein paar Seeigelschalen. Unter den Palmen erkenne ich überreife Mangos und Papayas. In die meisten hat irgendein Getier große Löcher hineingefressen. Über dem Meer kreischen Möwen.
„Wenn wir Pech haben, finden wir kein Wasser“, sagt Jamie mit einem Seufzen.
„Lass uns erst mal die Lage checken. In Panik verfallen können wir später immer noch. Zumindest gibt es hier Früchte, was ein gutes Zeichen für Süßwasservorkommen ist.“
Mir ist durchaus bewusst, wie schlimm unsere Situation ist. Mit dem Dinghi kommen wir auf keinen Fall zum Festland. Da die Yacht komplett zerstört ist, sind demnach auch alle Möglichkeiten ausgefallen, Hilfe zu holen. Selbst wenn ein Schiff nah genug an der Insel vorbeikommen sollte, muss es uns erst einmal gelingen, die Besatzung auf uns aufmerksam zu machen.
Langsam gehen wir durch einen Palmenhain. An dessen Ende erwartet uns dichtes Gestrüpp, bestehend aus hohen Sträuchern, durchsetzt von wildwachsenden Rosen. Ein schmaler Pfad führt hindurch.
„Es scheint hier größere Tiere zu geben“, sagt Jamie und deutet auf die Schneise.
„Hier kommen wir wenigstens durch“, antworte ich. Ungeduldig setze ich mich in Bewegung und winke ihm, mir zu folgen.
Eine Gruppe Papageien flattert kreischend auf, was mich dazu veranlasst, mich umzudrehen. Die Tiere schillern in bunten Farben. Trotz unserer misslichen Lage genieße ich kurz den Anblick dieser exotischen Pracht.
Um voranzukommen, muss ich immer wieder Äste beiseiteschieben. Schon bald sind meine bloßen Arme von den Dornen der Rosen ganz zerkratzt. Die saftigen Flüche Jamies verraten mir, dass es ihm genauso ergeht. Irgendwann lichten sich die Sträucher. Ich trete auf eine Lichtung und bleibe wie angewurzelt stehen.
Mit offenem Mund starre ich auf ein schmiedeeisernes Tor, das von einer hohen Mauer umgeben ist. Stacheldraht befindet sich darauf, was ziemlich paranoid anmutet. Wer sollte hier in der Einsamkeit schon einbrechen wollen? Doch das ist nicht die Ursache für meinen dämlichen Gesichtsausdruck.
Hinter dem Tor steht ein Mann Mitte dreißig, den ich nur als schön bezeichnen kann. Er mustert mich mit einem finsteren Gesichtsausdruck, der schon fast feindselig wirkt.