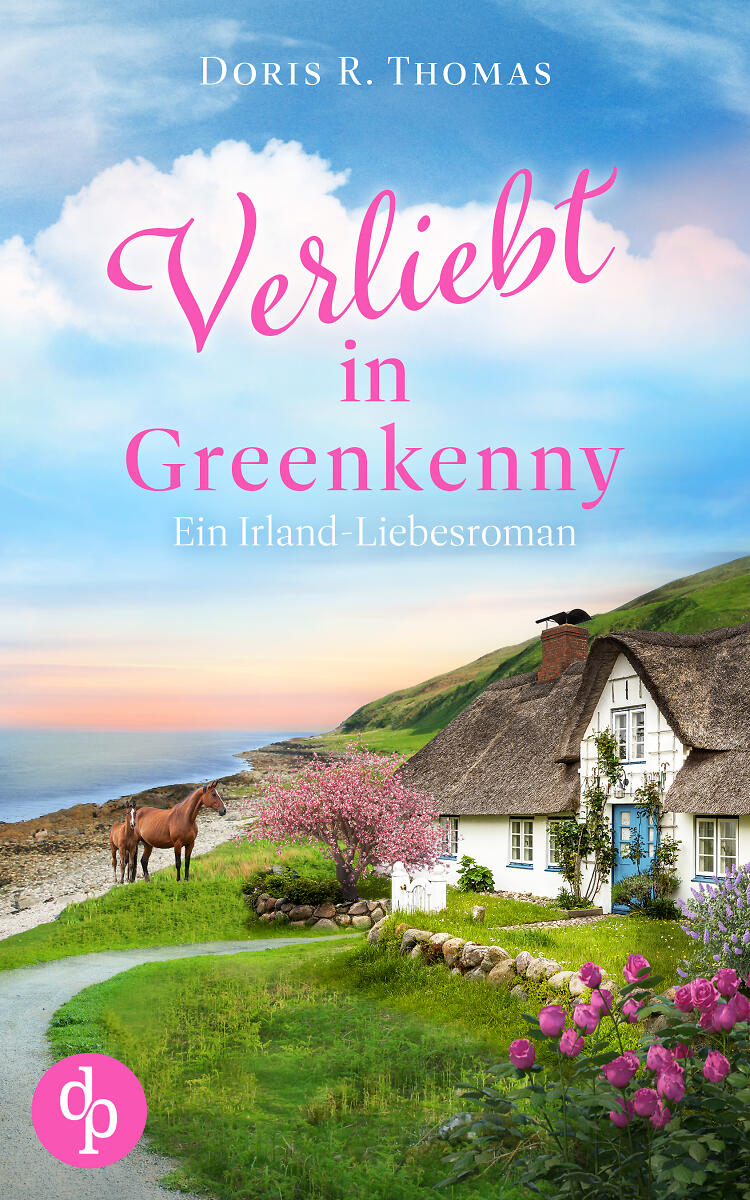1
Die Bilder sind echt amüsant und ich verkneife mir ein Grinsen. Wie soll ich mich da bitte schön auf das Online-Meeting konzentrieren? Checkt Rebecca nicht, dass sie den Monitor nach ihrer Präsentation weiterhin für alle Teilnehmer freigegeben hat und jeder sehen kann, wie sie sich durch ihr privates Fotoalbum klickt?
Aufmerksam studiere ich die Gesichter der anderen Kollegen auf dem Bildschirm, die zum Teil im Homeoffice sitzen. Ihre Mienen sind stocksteif und geben keinerlei Aufschluss darüber, was sie von Rebeccas Fotopräsentation halten. Nicht mal der Chef runzelt die Stirn, sondern spricht unbeirrt über unsere vergangene Marktanalyse für Nordmanneis.
Eine Haarsträhne hat sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst und fällt mir ins Gesicht. Rasch schiebe ich sie mit der linken Hand hinter das Ohr und greife mit der rechten nach der Kaffeetasse vor mir auf dem Schreibtisch. Das Bild, das jetzt auf dem Bildschirm auftaucht, zeigt meine Kollegin mit einem süffisanten Grinsen auf ihren knallrot geschminkten Lippen. O Gott, wie peinlich.
War ich eben noch von ihrer Präsentation amüsiert, wird mir nun allmählich klar, dass sie sich mehr und mehr unfreiwillig zum Gespött macht, wenn sie sich weiterhin dermaßen zur Schau stellt. Ich muss sie warnen. Das verlangt der weibliche Ehrenkodex von mir. Eilig stelle ich die Kaffeetasse auf dem Schreibtisch ab und öffne das Chatfenster am rechten unteren Bildschirmrand.
In der Zwischenzeit klickt sie munter weiter durch ihre Fotos, die sie in allen möglichen und unmöglichen Posen zeigen. Auf dem Foto, das sie gerade präsentiert, steckt ihr Hintern ‒ der mit Sicherheit halb so breit ist wie meiner ‒ in einem knappen Bikinihöschen, das ihre braungebrannten Pobacken perfekt in Szene setzt. Die Hände hat sie auf den Knien abgestützt, während sie mit feurigem Blick nach hinten direkt in die Linse lächelt, als wolle sie dem Fotografen sagen Küss mich, Baby!
»Pass auf, Rebecca«, tippe ich flink in die Tastatur und klicke auf Senden. Dabei fällt mir auf, dass ich meine Fingernägel unbedingt mal wieder feilen sollte.
»Die Marktanalyse für Nordmanneis hat zwar verhältnismäßig gute Resultate erreicht, jedoch ist da noch viel Luft nach oben«, erläutert der Chef gerade. »Frau Bach, würden Sie bitte Ihre ausgearbeitete Marktforschungsstrategie vorstellen?« Mein Boss ist der Einzige, der mich förmlich Frau Bach nennt. Für alle anderen bin ich Simone.
Mir bleibt keine Zeit mehr, die Nachricht an Rebecca weiter zu schreiben. Rasch öffne ich die Power Point Präsentation auf meinem Laptop. Sobald ich meinen Bildschirm freigegeben habe, werden ihre Bilder nicht mehr für alle sichtbar sein. Sie wird mir auf ewig danken, wenn ich ihr später davon erzähle. Gerade will ich den entsprechenden Button anklicken, als meine Augen an ihrem nächsten Bild haften wie Sekundenkleber.
Ich erstarre. Ist das …? Mir wird heiß und ich merke, wie die Röte in meinem Gesicht aufsteigt. Das, was sich jetzt auf dem Bildschirm abspielt, will ich nicht sehen. Doch es ist wie bei einem Unfall: Ich muss einfach hinschauen. Was macht Alex auf ihren Bildern?
Verdammt!
Mein Alex!
Sein behaarter Oberkörper zieht sich über den kompletten Bildschirmausschnitt. Es folgen Fotos von ihm in knapper Badehose, beim romantischen Candle-Light-Dinner und bei der Entgegennahme seiner Auszeichnung, zu der ich nicht mitdurfte. Mir gegenüber hatte er behauptet, die Veranstaltung wäre stinklangweilig und Begleitpersonen seien unerwünscht. Jetzt ist mir klar, warum ich zu Hause bleiben musste. So ein Mistkerl! Der Gipfel ist das Foto von meinem Freund in den Boxershorts, die ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe. Was für eine bodenlose Frechheit, dass er sie in Rebeccas Bett trägt! Ich wette, dass es ihres ist.
Mit geballter Faust schlage ich auf die Schreibtischplatte. Da ich das Mikro bereits eingeschaltet hatte, zucken einige Kollegen durch den dumpfen Laut zusammen.
In meinem Hals bildet sich ein dicker Kloß. Ich schnappe nach Luft und will am liebsten nur weg. Angespannt starre ich auf den Bildschirm und habe schweißnasse Hände.
Wie konnte ich eben noch Mitleid mit Rebecca haben?
2
Das Online-Meeting endet mit betretenen Mienen meiner Kollegen, die ich kaum ertrage. Rebecca, die sonst immer irgendwo auf den Gängen herumschwirrt, ist seit dem Meeting nirgends zu sehen. Gott sei Dank! Wortlos und mit gesenktem Kopf packe ich meine abgenutzte Lederhandtasche und kämpfe mit den Tränen. Über meine Kollegin Susanne lasse ich dem Chef ausrichten, dass ich Kopfweh habe und nach Hause gehe. Sicher wird ihm sofort klar sein, weshalb ich wirklich verschwinde. Doch es ist mir völlig egal. Ich muss raus hier. Zum Glück hat Alex heute einen Kundentermin und ist nicht im Büro.
In der S-Bahn, die mich in den Münchener Stadtteil Haidhausen bringt, lehne ich den Kopf an die Scheibe und presse die Lippen aufeinander. Jetzt nur nicht losheulen!
Zu Hause, in unserer gemeinsamen Dachgeschosswohnung angekommen, streife ich meine Pumps auf dem Eschenparkett im Flur ab und stelle sie ordentlich in das stylishe Schuhregal, das die Form einer gekrümmten Schlange hat. Alex hat es von einem französischen Designer erstanden und ist mächtig stolz darauf. In dem rahmenlosen Spiegel, der direkt darüber hängt, sehe ich in zwei matte Augen. Meine Haut wirkt fast so kalkweiß wie die Wände unserer Wohnräume. Rasch wende ich den Blick ab, schlüpfe in meine warmen Hausschuhe und schleppe mich durch die Wohnung. Bei jedem Schritt begleiten mich die demütigenden Bilder von Alex und Rebecca. Ich versuche, sie aus meinem Hirn zu verbannen. Doch es gelingt mir nicht.
Wie in Trance schlurfe ich nach einer weiteren Stunde, in der ich mir die Augen ausgeheult habe, das Treppenhaus hinunter und hole ein paar Umzugskartons aus dem muffig riechenden Kellerabteil. Kalt ist es hier, doch auch in meinem Inneren ist es eisig.
Zurück in der Wohnung packe ich. Und zwar sämtliche Klamotten aus Alex’ Schrankhälfte im Schlafzimmer. Gerade als ich die Sammlung seiner Basecaps aus allen Kontinenten in einen Karton knalle und ihn schließe, vernehme ich das Umdrehen des Schlüssels im Haustürschloss. Mein Herz rast und ich halte inne. Schritte gehen beinahe lautlos über das Parkett. Sekunden später steht Alex in der Schlafzimmertür.
»Simi, was machst du?« Er runzelt die Stirn und gibt sich nichtsahnend.
Ich erkenne an seinen verengten Pupillen, dass er längst weiß, dass ich von seiner Affäre erfahren habe.
»Wonach sieht es denn aus?«, antworte ich unterkühlt und vermeide den Blickkontakt. »Ich packe! Du ziehst aus. Und zwar noch heute.«
»Aber warum …«
»Das fragst du noch?« Ich blitze ihn an. »Ich würde mich wundern, wenn du noch nicht mit Rebecca gesprochen hättest.«
Er macht einige Schritte auf mich zu und umfasst meine Ellenbogen. »Es ist nicht so, wie du denkst«, startet er in sanftem Tonfall einen kläglichen Versuch, sich zu rechtfertigen.
Spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass er ganz genau weiß, worum es hier geht.
»So?« Ich schiebe ihn von mir. »Glaub mir, eure attraktiven Fotos waren eindeutig.«
»Ja … es gibt diese Fotos.« Er reißt die Hände in die Höhe. »Aber das war doch nichts Ernstes«, spielt er die Affäre herunter.
Seine Worte prallen an mir ab, wie ein Gummiball an der Wand.
»Ich erinnere mich nicht mal mehr, wie es dazu kam. Wir haben nur ein Mal …«
»Erspar mir die Details«, entgegne ich scharf. Ohne dass ich es verhindern kann, schießen mir die Tränen in die Augen. Ich unterdrücke sie und drehe mich zum dreitürigen Kleiderschrank, den wir erst vor etwa einem Monat gemeinsam erstanden haben.
»Willst du wirklich vier gemeinsame Jahre in die Tonne werfen?«
»Ich?«, fauche ich und zerknülle eines seiner Markenhemden in der Hand. »Du willst mir allen Ernstes sagen, dass ich unsere Beziehung wegwerfe?«
***
Zwei Wochen ist unsere Trennung nun her und noch immer erscheinen mir die Geschehnisse wie ein böser Traum. Nachts, wenn ich alleine in unserem breiten, kalten Boxspringbett liege, weine ich mich in den Schlaf. Weshalb musste das alles ausgerechnet mir passieren? Unsere Beziehung war doch perfekt. Okay, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als er fremdgegangen war. Aber warum hat er unsere gemeinsame Zukunft mir nichts dir nichts weggeworfen?
Vergeblich suche ich nach Antworten. Als ich mich an seinen romantischen Heiratsantrag in Paris erinnere, füllen sich meine Augen erneut mit Tränen und ich klammere mich an das weiche Kopfkissen, als könne es verhindern, dass es mich in den Abgrund reißt. Spätestens im nächsten Jahr, in dem wir beide dreiunddreißig geworden wären, wollten wir heiraten. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich so bescheuert war, mir einzureden, dass uns diese Schnapszahl Glück bringen würde. Ich hatte mich schon als märchenhafte Braut mit hochgesteckten Haaren in einem superschicken Chiffonkleid vor den Altar gesehen, zu dem mein Vater mich geführt hätte. Alex war der Traumschwiegersohn meiner Eltern und sie sind alles andere als glücklich, dass wir nun getrennte Wege gehen.
Tagsüber schiebe ich all diese Gedanken, die mich runterziehen, beiseite. Schließlich muss ich im Job abliefern.
Zum Glück ist Alex momentan auf Geschäftsreise. Sicher mit diesem blonden Gift. Immerhin hat sie in dieser Woche Urlaub beantragt. Egal! Hauptsache, ich laufe den beiden im Büro nicht über den Weg und muss ihnen nicht in ihre verlogenen Augen sehen.
***
Ich kippe einen Schluck des abgekühlten Kaffees in meine Kehle, fahre den Computer herunter und schalte gähnend das Licht der Schreibtischlampe aus. Seit ich wieder Single bin, schufte ich nahezu jeden Tag bis in den späten Abend hinein. Was wegen ein paar fataler Fehler, die mir unterlaufen sind, auch zwingend notwendig ist. Die wieder glattzubügeln, braucht Zeit. Wiederholt hat mir der Chef klargemacht, dass ich konzentrierter arbeiten muss. Und das beabsichtige ich auch. Wirklich. Wenn ich nur nicht dauernd diese Bilder von Alex und Rebecca im Kopf hätte.
Ich seufze, starre auf die Zahl der unbearbeiteten E-Mails auf dem Bildschirm und hänge eine Weile meinen trüben Gedanken nach. Erst als es an der Tür klopft, sehe ich auf. Mein Chef steht im Türrahmen und fixiert mich mit einem Blick, der bei mir sofort ein flaues Gefühl in der Magengegend auslöst.
Natürlich lasse ich mir nichts anmerken. »So spät noch im Büro?«, frage ich übertrieben freundlich.
Er verzieht keine Miene. »Haben Sie einen Moment, Frau Bach?«
»Ja, klar. Ist alles in Ordnung?«
Er sieht sich um. Außer mir sind um diese Zeit nur noch wenige Kollegen im Haus. Lediglich im Nachbarraum und am Ende des Ganges brennt noch Licht. »Nicht hier, kommen Sie bitte kurz mit.«
Ich nicke wortlos und folge ihm zu seinem Büro, das am Ende des Flures über eine gläserne Treppe zu erreichen ist. Mein Pferdeschwanz wippt auf und ab, während mein Herz bis zum Hals klopft. Ein ungutes Gefühl breitet sich in mir aus.
Mein Chef räuspert sich. »Nehmen Sie Platz.« Er setzt sich mir gegenüber auf einen der ledernen Schwingstühle am kleinen Besuchertisch und verschränkt Arme und Beine.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Mein Herz pocht mittlerweile so heftig, dass ich Angst habe, er könnte es hören. Angespannt kralle ich die Finger in die Armlehnen des Stuhls und spanne die Zehen in meinen Lederpumps so fest an, dass es schmerzt.
Ohne lange Vorrede kommt er zur Sache. »Frau Bach, Sie sind … ähm … Sie waren jederzeit eine wertgeschätzte Marktforscherin. Doch es tut mir leid, ich muss Ihnen kündigen.« Er weicht meinem Blick aus, steht auf und geht zu seinem Schreibtisch.
Ich setze mich kerzengerade auf, öffne den Mund und schließe ihn gleich wieder. Es ist, als hätte er mir einen Faustschlag mitten ins Gesicht verpasst. Hat er mir wirklich gerade gekündigt? Sicher habe ich mich verhört. Es muss so sein.
Bevor ich die Gelegenheit habe, nachzufragen, steht er wieder neben mir, kneift die Lippen zusammen und legt das Kündigungsschreiben vor mir auf den Tisch.
Mein Selbstbewusstsein schwindet binnen einer Nanosekunde. »Das ist nicht wahr, oder?«, stammle ich mit brüchiger Stimme. Hätte ich dem Alkohol nicht abgeschworen, könnte ich jetzt echt einen Schnaps gebrauchen.
Sein Blick ist starr, als er sich wieder setzt. Er entgegnet nichts, sondern schaut mich einfach nur an.
»Aber … aber sagten Sie nicht, ich sei Mitarbeiterin des Monats?« Und jetzt kündigt er mir?
»Das war im negativen Sinne gemeint.« Er kratzt sich an der kahlen Stirn. »Ich dachte, Sie hätten das verstanden. Es sind zu viele Fehler passiert, die sich trotz Ermahnungen wiederholt haben.«
Kraftlos lehne ich mich zurück und schüttle ungläubig den Kopf.
»Die Spitze war Ihre Unachtsamkeit bezüglich der Sache mit Hansen und Jänicke. Das hat das Unternehmen eine Stange Geld gekostet.«
»Sagen Sie nicht ständig, Fehler sind da, um aus ihnen zu lernen?« Ich versuche, ihn mit seinen eigenen Worten zu schlagen.
»Das ist korrekt, doch ein Fauxpas dieses Ausmaßes …« Er macht eine Pause, als überlege er sich genau, ob er weitersprechen soll oder nicht. »Im Übrigen … Sie und Alexander in einer Firma, das funktioniert auf Dauer nicht, jetzt, wo Sie beide …«, erklärt er schließlich mit gedämpfter Stimme.
Ich fasse es nicht! Die Trennung von Alex soll allen Ernstes einer der Mitgründe für meine Kündigung sein? Spinnt der?
Unmittelbar fährt mir ein eiskalter Schauer über den Rücken, weshalb ich mit den Händen an den Armen auf und ab streiche.
»Aber das ändert doch an meiner Arbeitsleistung nichts«, protestiere ich. Allerdings kippt meine Stimme bedrohlich, denn schlagartig wird mir klar, dass mein Chef recht hat. Dank des Gefühlschaos, das Alex in mir ausgelöst hat, bringe ich beruflich nichts mehr auf die Reihe, obwohl ich Gegenteiliges behaupte. Zugeben würde ich das niemals.
Mein Chef zuckt mit den Achseln, als interessiere ihn mein liebloser Protest nicht.
Mir wird übel, weil ich realisiere, dass er es bitterernst meint. Meine Fassade bröckelt mehr und mehr. Die aufsteigenden Tränen versuche ich wegzublinzeln und wende mich rasch ab. Ich sehe aus dem Fenster und entdecke ein Flugzeug am Nachthimmel. Wieso dreht die Welt sich rücksichtslos weiter, während sich unter mir der Boden auftut? Schniefend wische ich die Tränen mit dem Handrücken weg, die nun ungehindert über meine Wangen rollen.
»Selbstverständlich halte ich die dreimonatige Kündigungsfrist ein.«
Ich nehme ihn nur noch wie durch einen Schleier wahr. »Und Sie werden natürlich freigestellt.«
Urplötzlich bin ich wieder voll da. »Ich stehe mitten in dem Projekt mit Nordmanneis!«, platzt es aus mir heraus. Will er mir das jetzt auch noch wegnehmen?
»Das übernimmt Frau Hegenbarth.«
Rebecca? Er übergibt mein Projekt an Rebecca? Ich fasse es nicht! In meinem Hirn rattert es und ich weiß, dass ich professionell bleiben muss, was mir angesichts der gegenwärtigen Situation zunehmend schwererfällt.
»Außerdem habe ich jede Menge Überstunden, plus Resturlaub!« Mir wird klar, dass er bei einer Kündigungsschutzklage schlechte Karten hätte. Immerhin hat er mich zuvor nicht mal abgemahnt. Deshalb räuspere ich mich und versuche, meine Stimme halbwegs zu festigen. »Und wenn Sie es wirklich darauf anlegen, mich loszuwerden, erwarte ich eine großzügige Abfindung.«
»Ja, sicher«, antwortet er eifrig nickend und atmet auf.
»Besser noch … ich pfeife auf das Geld. Ich bestehe auf eine längere Freistellung. Und zwar weitere drei Monate.«
Er reißt die Augen auf. »Sie fordern sechs Monate Freistellung?«
»So ist es.«
Will ich das wirklich? Immerhin liebe ich meinen Job, aber jetzt habe ich die Forderung bereits herausposaunt.
Er seufzt. »In Ordnung. Wenn wir die Sache damit einvernehmlich beenden können, bin ich einverstanden.«
Die Sache! Ich bin also eine Sache.
Mit dem Zeigefinger deutet er auf das Kündigungsschreiben. »Ich ändere das ab und sende es Ihnen postalisch zu.«
Mit gesenktem Kopf trotte ich zurück in mein Büro. Oder besser gesagt in den Raum, der sich bis vorhin so nannte. Wie in Trance werfe ich sämtlichen privaten Kleinkram, der sich über die Jahre auf dem Schreibtisch und in den Schubladen angesammelt hat, in meine Handtasche. Zum Abschluss poliere ich den Schreibtisch mit einem feuchten Tuch. Tränen kullern mir über die Wangen, während ich hektisch auf dem Holz hin und her schrubbe.
In Gedanken lasse ich das Gespräch Revue passieren. Ein halbes Jahr! Wie konnte ich nur so verrückt sein und ein halbes Jahr fordern? Was soll ich zum Kuckuck mit dieser verdammt langen Zeit anfangen? Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, das komplette Frühjahr und den Sommer zu Hause rumzusitzen.
Mein Handy vibriert und ich werfe einen Blick auf das Display. Alex! Was fällt ihm ein, mich schon wieder anzurufen? Energisch klicke ich ihn weg.
Sofort poppt eine WhatsApp-Nachricht auf.
Wie lange soll ich noch auf den Knien herumrutschen und dir versichern, dass es mir unendlich leidtut?
Idiot! Die Antwort spare ich mir. Schließlich haben wir genug geredet. Auch wenn jede Erinnerung an ihn schmerzt und ich wünschte, es wäre alles wie früher, kann ich nicht einfach so tun, als stünde nichts zwischen uns. Warum musste er mich ausgerechnet mit unserer Kollegin betrügen? Das verzeihe ich ihm im Leben nicht. Zugegeben, selbst wenn ich nicht auf Frauen stehe, habe ich logischerweise nicht übersehen, dass Rebecca der wahrgewordene Traum eines jeden Mannes ist. Lange blonde Haare, die in der Sonne wie Gold schimmern und Beine bis zum Himmel. Sympathisch ist sie zu allem Übel auch. Damit hat sie Alex um den Finger gewickelt, darauf wette ich. Es war kein einmaliger Ausrutscher, wie er behauptet hat. Die Fotos, die sie uns netterweise präsentiert hat, sprechen für sich. Möglicherweise hätte ich ihm einen einzelnen Fehltritt verziehen. Doch die Affäre der beiden läuft mindestens seit vergangenem Sommer. Über ein halbes Jahr! Das muss man sich mal vorstellen. Wie blind ich war.
3
In meiner ersten freien Woche tausche ich Businessoutfit gegen Jogginganzug und Pumps gegen Hausschuhe. Ich verbarrikadiere mich zu Hause und mache das, was ich immer tue, wenn ich Frust habe: Ich putze. Ausgiebig sogar. Ich krieche in jeden Winkel meiner Wohnung und ordne liegengebliebene Unterlagen auf dem Schreibtisch. Das sind so gut wie keine, weil ich ohnehin extrem ordentlich bin. Dann wühle ich mich durch den Kleiderschrank und werfe alles weg, was ich definitiv in meinem Leben nicht mehr brauche. Wieso kommt mir genau jetzt Alex in den Sinn? Und da ich einen Farben-Sortier-Tick habe, sortiere ich meine Kleidung danach. Während ich kopfüber im Kleiderschrank hänge, bemerke ich, dass ein nicht zu übersehender Mangel an heller Kleidung herrscht. Wenn das mal nicht die perfekte Gelegenheit zum Shoppen ist! Außerdem habe ich jetzt ja genug Platz in Alex’ Schrankhälfte.
Ich sause zur Küchenarbeitsplatte und kritzle auf die Einkaufsliste:
helle Kleidungsstücke shoppen
Ablenken ist schließlich die beste Therapie. Das habe ich in einer schlauen Fachzeitschrift gelesen. Wenn ich nur wüsste, was ich sonst noch mit meiner Freizeit anfangen könnte. Ich brauche ein Hobby. Irgendetwas, womit ich die nächsten sechs Monate füllen kann. Ich jage drei Orangen durch die Saftpresse und setze mich mit dem Getränk auf die Couch. Ich nehme einen kräftigen Schluck Vitamine und stelle das Glas auf dem Couchtisch ab. Dann schnappe ich mir den Laptop und hämmere interessante Hobbys in die Tasten. Doch zweifellos ist Mandala malen, Stricken und Improvisationstheater nicht das, was ich mir vorstelle.
Ich fische das Handy aus der Couchritze und klicke auf die Nummer meiner besten Freundin. Seit meinem ersten Tag im Kindergarten sind Nina und ich unzertrennlich.
»Hey, wie geht’s?«, begrüßt sie mich quietschvergnügt. »O nein!«, kreischt sie postwendend. Das Klirren von Geschirr dröhnt an mein Ohr. »Dass der Plunder auch immer da steht, wo man ihn nicht vermutet«, gackert sie.
»Du bist so verpeilt.« Ich muss unverzüglich schmunzeln.
»Na und? Es kann ja nicht jeder so makellos sein wie du«, kontert sie frech und ich sehe förmlich vor mir, wie sie sich durch ihre widerspenstigen blonden Locken fährt. »Aber nun sag Simi, wie geht es dir?«
»Ausgezeichnet! Ich schlafe jeden Tag aus und mache all die genialen Dinge, von denen ich mein Leben lang geträumt habe.«
»Ach ja? Und das wäre?«
Ich druckse herum. »Na ja … alles Mögliche.«
Sie lacht und ich sehe selbst durchs Telefon, wie sie mich mit ihren hübschen Kulleraugen kritisch beäugt. »Du redest Blödsinn, Simi. Ich kaufe dir kein Wort ab. Hast du vergessen, dass ich dich in- und auswendig kenne? Spucks aus. Bist du mit irgendetwas anderem beschäftigt außer mit Putzen?«
»Okay«, räume ich gedehnt ein. »Du hast mich ertappt. Um die Wahrheit zu sagen: Weder schaffe ich es auszuschlafen noch meine Tage annähernd sinnvoll zu nutzen. Auch ohne das penetrante Schrillen des Weckers bin ich jeden Morgen um sechs Uhr hellwach. Ach Nina, wieso war ich so dermaßen bescheuert, eine Freistellung zu fordern?« Mittlerweile ist mir klar, dass es weitaus klüger gewesen wäre, die Abfindung zu kassieren und möglichst zügig nach einem neuen Job zu suchen.
»Zu blöd, dass ich ab übermorgen zwei Wochen mit den Kids vom Kinderdorf im Feriencamp bin.«
»Ja, extrem schade.« Wie genial wäre es, mit Nina etwas zu unternehmen.
»Du musst dir was einfallen lassen. So eine Gelegenheit hat man maximal einmal im Leben. Wenn ich du wäre …«
»Ja, schon klar, du würdest nach Indien fliegen und einen Aschram besuchen.«
»Zum Beispiel! Oder was hältst du von Spanien? Du könntest über den Jakobsweg pilgern.«
Ich lache auf und zeige Nina einen Vogel, den sie natürlich nicht sehen kann. »Spinnst du? Allein bei der Vorstellung bekomme ich Blasen an den Füßen.«
»Okay, wie wäre es, wenn du einfach mal dein Leben genießt?«
»Ach Nina, das würde ich ja liebend gerne. Nur … wie soll ich das anstellen? Die vergangenen Jahre habe ich ausschließlich mit Alex und Arbeit verbracht.« Wehmütig werfe ich einen Blick auf die beiden Kaffeetassen im Regal mit der Aufschrift DU und ICH.
Nina hat recht, ich muss mir schleunigst etwas einfallen lassen.
»Wie fändest du es, wenn ich mit ins Feriencamp käme?«
Sie kichert. »Darauf bist du nicht wirklich scharf, glaub mir. Oder stehst du auf vorlaute Kinder, die dich mit Matsch bewerfen?«
Bloß nicht!
»Okay, ich bleibe daheim.«
»Wie wäre es, wenn du dich in einem Bootcamp anmeldest?«
»Was soll ich da?«
»Du kämst unter Menschen und könntest muskelbepackten Traumtypen zusehen, wie ihnen der Schweiß übers Sixpack rinnt.«
Ich rümpfe die Nase und betrachte mein wabbeliges Bäuchlein, das durchaus ein paar Muskeln vertragen könnte.
Nina quasselt munter weiter. »Außerdem schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe: Du stählst deinen Körper und mit Sicherheit lernst du dort ein schnuckeliges Kerlchen kennen.«
»Also wirklich, Nina, von schnuckeligen Kerlchen habe ich die Schnauze voll.«
»Du musst ihn ja nicht gleich heiraten. Gönn dir doch mal ein wenig Spaß. Du weißt schon …«
»Hast du sie noch alle?« Sofort ist mir klar, worauf sie anspielt. »Nenn mich altmodisch, aber ich bin nicht der Typ für One-Night-Stands.«
»Wieso bist du dir da so sicher? Hast du es jemals ausprobiert?«
»Nina, du bist unmöglich. Ich hatte noch nie einen und werde mich auch nie im Leben darauf einlassen. Basta!«
»Immer wenn dir die Argumente ausgehen, sagst du Basta. Mach dich mal locker, Simi.«
»Das werde ich. Verlass dich drauf. Irgendetwas fällt mir schon ein.«
»Na, da bin ich gespannt. Dank deines bescheuerten Silvestervorsatzes erstickst du von vornherein jeden Spaß im Keim. Auf solche idiotischen Ideen kommst nur du.« Sie kichert.
»Beim Gedanken an unser Besäufnis ist mir heute noch speiübel.«
»Aber das ist doch kein Grund, ein ganzes Jahr auf Alkohol zu verzichten. Wobei ich eh nicht glaube, dass du das durchhältst. Nie und nimmer. Wir haben erst Februar.«
Pah! Das wäre ja gelacht. Natürlich halte ich das durch.
»Ich werde es dir beweisen«, antworte ich trotzig.
»Setz dich doch nicht selbst unter Druck, Simi.«
»Ach Nina, manchmal habe ich das Gefühl, ich stecke in einem Korsett.«
Sie seufzt. »Es tut mir so leid, dass du das alles durchmachen musst. Ich schick dir eine feste Umarmung durchs Telefon.«
Ich schließe die Augen und schlinge meine Arme ebenfalls gedanklich um sie.
Kaum haben wir uns verabschiedet, klingelt mein Handy erneut und das geschminkte Gesicht meiner Mutter strahlt mir auf dem Display entgegen.
Ich atme tief ein. »Hallo, Mama.«
»Simone!«, grüßt sie mich mit ihrer schrillen Stimme. »Wie geht es dir?«
»Alles paletti, Mama.«
Auch wenn ich sie liebe und weiß, dass sie nur das Beste für mich will, treiben mich ihre Anrufe, die sich stets um das gleiche Thema drehen, langsam in den Wahnsinn.
»Hast du es dir mit Alex noch einmal überlegt?«, hakt sie prompt nach.
»Nein, Mama.«
»Simone, ich hatte es vielleicht bereits erwähnt, aber glaub mir, Kind, es lohnt sich, für eine Beziehung zu kämpfen.«
Ich sehe förmlich ihren erhobenen Zeigefinger durchs Telefon. »Ja, Mama, ich weiß. Hättest du nicht anno dazumal eingelenkt, als Papa …«
Die abgedroschene Geschichte kenne ich mittlerweile zu Genüge. Sie will es einfach nicht kapieren, dass Alex mich über Monate betrogen hat und es definitiv kein Zurück mehr geben wird. Manchmal wünschte ich, ich hätte noch Geschwister. Dann wäre ihr Fokus sicher nicht ständig auf mich gerichtet.
»Gib ihm noch eine Chance, Kind«, drängt sie.
4
Nach einer weiteren Woche zu Hause drehe ich fast durch. Nina ist im Feriencamp unerreichbar und ich sitze hier und habe keinen Schimmer, wie ich die Zeit sinnvoll nutzen soll.
Ich habe es mit YouTube-Yoga versucht und festgestellt, dass ich diese mörderischen Verrenkungen nicht mal fünf Minuten durchhalte. High Intensity Training schaffe ich zumindest zehn Minuten. Doch beim Auf- und Abhüpfen denke ich an Alex und an unser Power-Zirkeltraining, zu dem er mich vor Monaten mitgeschleppt hat. Damals meinte er, dass ich ruhig mal was für meine Figur tun könnte.
Ohne Vorwarnung schießen mir bei der Erinnerung die Tränen in die Augen und ich schließe daraus, dass mir Sport nicht guttut. Nicht dass ich es nicht schon früher gewusst hätte. Skeptisch begutachte ich meine zu breit geratenen Oberschenkel und rede mir ein, dass es sowieso egal ist, wie ich aussehe, jetzt, wo ich Single bin.
Ich zähle die Tage, die vor mir liegen. Hundertsiebzig! Das muss man sich mal überlegen …
***
Zum dritten Mal in dieser Woche schlendere ich antriebslos durch die Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz. Mein Bedarf an Klamotten in hellen Farben ist mittlerweile gedeckt und mein Kleiderschrank gleicht einer wohlsortierten Boutique.
Auf dem Heimweg quatscht mich ein Kerl um die zwanzig von der Seite an und mir rutscht fast die Laugenstange aus der Hand, die ich eben gekauft habe.
»Darf ich Sie zu einem Persönlichkeitstest einladen?« Sofort hält er mir eine Broschüre mit dem Titel Verändern Sie Ihr Leben – jetzt unter die Nase.
»Nein danke!«, lehne ich unmissverständlich ab und hebe abwehrend die Hand.
Doch mein Nein interessiert ihn nicht. Er macht einen weiteren Schritt auf mich zu.
Damit er mich in Ruhe lässt, stecke ich den Flyer ein. Zu Hause werfe ich einen Blick hinein und mir ist sofort klar, dass es sich um eine Sekte handeln muss. Ich öffne den Mülleimer und lasse die Broschüre fallen, doch sie segelt daneben. Wieder springt mir der prägnante Text Verändern Sie Ihr Leben – jetzt ins Auge. Hat mir irgendeiner da oben irgendwas zu sagen?
Ich starre an die Zimmerdecke. »Hallo? Ist da wer?« Beim Blick nach oben sichte ich Spinnweben. Rasch hole ich einen Besen und kehre sie ab.
Innerlich davon getrieben, etwas Sinnvolles zu tun, klappe ich den Laptop auf und durchforste die aktuellen Stellenanzeigen. Zu meinem Leidwesen gibt es ausschließlich Jobs für sofort oder spätestens in zwei Monaten. Jetzt schon eine Bewerbung zu schreiben, ist absolut sinnlos.
Auf dem Seitenfenster der Jobbörse poppt Werbung für einen Traumurlaub in der Karibik auf. Wie sarkastisch. Meinen die wirklich, jemand, der arbeitslos ist, kann sich einen Urlaub in Puerto Rico leisten? Okay, ich könnte es. Vielleicht sollte ich einfach abhauen. Ich schmunzle über meine irrsinnige Idee. Allein der Gedanke daran, als Single mutterseelenallein über einen Traumstrand zu schlendern, ist absurd. Aber wie wäre es mit einem Kurztrip? Einfach mal raus aus dem Alltag, den ich nicht habe? Vielleicht eine Städtereise, bei der man etwas lernt?
Aufgeregt tippe ich egal wann, egal wohin in die Tasten. Zu meinem Erstaunen finde ich eine Website, die sich exakt auf diese Art von Urlauben spezialisiert hat. Alle möglichen Reiseziele werden angeboten und mir springt sofort Irland ins Auge. Ein Flug nach Dublin kostet läppische achtundsiebzig Euro. Nicht zu fassen, was für ein Spottpreis! Die Grüne Insel kenne ich noch nicht. Ich googele, womit ich meine Zeit dort verbringen könnte. Das Trinity College mit der steinalten Bibliothek klingt vielversprechend. Auch die Christ Church Cathedral wäre sicher einen Besuch wert und nicht zuletzt das Guinness-Storehaus, welches als Top-Sehenswürdigkeit in Dublin gilt.
Mal sehen, was ein Hotel dort kostet. Im Handumdrehen finde ich eines im angesagten Temple Bar Bezirk, in dem es auch unzählige populäre Pubs gibt. Von der berühmten Temple Bar im gleichnamigen Bezirk habe ich tatsächlich früher schon mal gelesen. Wobei ich nicht vorhabe, die Zeit in einem Pub totzuschlagen. Sofern ich überhaupt dort hinfliege. Vielleicht sollte ich die Reise auch zusammen mit Nina ins Auge fassen, wenn sie aus dem Feriencamp zurück ist.
Es wäre nur ein einziger Klick und alles wäre gebucht. Soll ich oder soll ich nicht? Ist übermorgen nicht zu kurzfristig? Zugegeben, der Preis für zwei Nächte ist absolut unschlagbar. Unentschlossen starre ich auf den Bildschirm. Plötzlich scheinen sich meine Finger auf der Tastatur zu verselbstständigen. Ich klicke auf den Button Buchen.
Ein aufgeregtes Kribbeln jagt mir durch den Körper. Ich habs getan. Unfassbar! Ich habe gebucht. Eine Mischung aus Freude und Zweifel macht sich in mir breit. Und ich frage mich, was ich von meiner Spontanaktion halten soll. Doch für einen Rückzieher ist es nun zu spät.
Mir wird bewusst, dass ich einen durchstrukturierten Tagesplan brauche. Dann kann ich die Reise noch zu einem geplanten Trip werden lassen. Rasch laufe ich zur Schreibtischschublade, hole ein Blatt Papier heraus und liste alle bedeutsamen Sehenswürdigkeiten handschriftlich auf. So richtig Old School. Obendrein notiere ich Tag, Uhrzeit und wie lange ich vorhabe, mich jeweils dort aufzuhalten. Nach einer geschlagenen Stunde bin ich damit fertig und falte den Plan zufrieden zusammen. Jetzt ist der Kurztrip optimal vorbereitet.
***
Bereits zwei Tage später stehe ich unruhig und gleichermaßen gespannt an der Bushaltestelle am Dubliner Flughafen und warte auf den Airport Express, der mich in den Temple Bar Bezirk bringen soll.
Im Bus ergattere ich einen Platz auf dem oberen Deck. Weil mich der Gedanke an meine Wohnung nicht in Ruhe lässt, ziehe ich aus dem Seitenfach der Handtasche mein Handy hervor und wähle die Nummer meiner Nachbarin. Sie hat versprochen, während meiner Abwesenheit nach dem Rechten zu sehen und ich bitte sie, zu überprüfen, ob ich das Badfenster wirklich geschlossen habe. Nach dem Telefonat zwinge ich mich, zu entspannen. Ich lehne mich zurück und flüstere mir mantramäßig zu, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Ich werde diesen Kurztrip genießen. Dafür bin ich schließlich hier.
Mit einem Lächeln auf den Lippen lehne ich den Kopf gegen die Scheibe und schaue neugierig aus dem Fenster. Der Bus fährt an unzähligen Hochhäusern und Industriegebäuden vorbei und ich bin fast ein wenig enttäuscht, dass sie sich nicht großartig von den Münchener Bauten unterscheiden. Doch dann erreichen wir den Fluss Liffey und ich erblicke zum ersten Mal Backsteinhäuser, deren Erdgeschosse überwiegend mit knallbunt gestrichenem Holz vertäfelt sind. Die Namen der Geschäfte und Restaurants zieren mit goldenen Buchstaben die Fassaden. Besonders gut gefallen mir die zweigeteilten Sprossenfenster und die farbigen Haustüren mit ihren abgerundeten Fenstern an der Oberseite. Es gibt so viel zu entdecken. Sogar der Linksverkehr fasziniert mich. Ich glaube, ich würde mich niemals in Irland ans Steuer setzen.
Ein Glücksgefühl steigt in mir auf. Mittlerweile kann ich es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden.
Nach dem Early Check-in im Hotel und ein paar knusprigen Fish & Chips auf die Hand ist gegen Mittag Sightseeing angesagt. Bestens ausgerüstet mit einer dicken Wollmütze, Handschuhen und einem kuscheligen Mantel, bin ich mit meinem Tagesplan im Schlepptau auf dem Weg zur Christ Church Cathedral, der ersten Sehenswürdigkeit, die ich mir notiert habe. Vor der ältesten mittelalterlichen Kathedrale der Stadt bleibe ich ehrfürchtig stehen und bin überwältigt. Ein derart imposantes, wuchtiges Gebäude aus Stein habe ich noch nie im Leben gesehen. Dummerweise habe ich bei der Recherche übersehen, dass man die Kathedrale auch von innen besichtigen kann. Rasch werfe ich einen Blick in meine Notizen. Heute klappt das zeitlich nicht mehr. Vielleicht schiebe ich es morgen in der Mittagspause ein.
Der Wind pfeift und ein paar Schneeflocken fallen vom Himmel. Ich ziehe meinen Schal enger und marschiere zum Guinness-Storehouse am St. James’s Gate. Dort angekommen zeige ich mein Ticket für die Brauereiführung vor, das ich vorsorglich online erstanden habe.
Der Reiseführer hat nicht gelogen, als er das Guinness-Storehouse als must-see gekennzeichnet hat. Die verschiedenen Schritte des Bierbrauens sind definitiv sehenswert.
Am Ende der Führung ist eine Bierverköstigung dran. Der Barkeeper streckt mir ein Glas des rubinroten Getränks entgegen, das fast schwarz wirkt. Der süßliche Geruch des Bieres steigt mir in die Nase und ich nehme eine Mischung aus Kaffee und Malz wahr.
»Nein danke. Ich trinke keinen Alkohol«, lehne ich höflich auf Englisch ab und schüttle den Kopf.
Der Barkeeper lacht, als hätte ich den besten Witz aller Zeiten gerissen. »Bist du sicher? Du bist in Irland.«
Ob allein die Tatsache, dass ich in Irland bin, genügt, um meinen Silvesterschwur einfach so zu brechen?
Er hält das Glas weiterhin in der Hand und wartet darauf, dass ich es ihm abnehme.
Okay! Sicher wird Nina mich wegen dieses einen Bieres nicht verfluchen. Wobei sie es schließlich war, die gesagt hat, dass sie nichts von meinem Vorsatz hält.
Ich greife nach dem Glas und die cremige Schaumkrone schwappt über. Rasch lecke ich mir die Finger ab und finde, dass es gar nicht übel schmeckt. Wenig später verlasse ich das Guinness-Storehouse und schlendere in Richtung Trinity College. Dass ich meinem Zeitplan zwanzig Minuten hinterherhinke, macht mich ganz nervös, sodass ich im Laufschritt gehe.
Dort angekommen besichtige ich das Book of Kells und bin von der uralten Bibliothek überwältigt. Die steinalten Bücher riechen modrig und obwohl es von Besuchern wimmelt, sind alle mucksmäuschenstill.
Nachdem mein Sightseeing-Plan für den heutigen Tag erledigt ist und die Museen geschlossen sind, ist es Zeit für das geplante Abendessen, das jetzt auf dem Zeitplan steht. Doch mir fehlt der Hunger. Das nasskalte Wetter wird von Minute zu Minute ungemütlicher und die Kälte kriecht trotz des warmen Mantels und der dicken Fellstiefel unbarmherzig von meinen Zehen bis in den Rücken hinauf.
Etwa hundert Meter entfernt entdecke ich ein imposantes Eckhaus aus Backstein, dessen Erdgeschoss mit einer rot glänzenden Holzfassade verkleidet ist. Ich lese den in Goldbuchstaben geschriebenen Namen auf schwarzem Untergrund. Das ist also die berühmt berüchtigte Temple Bar.
5
Ich trete näher und schieße ein paar Fotos vom Äußeren des eindrucksvollen Gebäudes. Dann betrachte ich eingehend die mit bunten Blechschildern gepflasterte Fassade. Ein Bronzeschild zeigt die Silhouette von Lady Martha Temple und an der Seite blinkt ein rot leuchtender Schriftzug mit den Worten Traditional Irish Music. Als ich den Aufsteller neben der Eingangstür erblicke, huscht ein Grinsen über mein Gesicht. Mit dicker Kreideschrift, die durch den Regen verwaschen ist, steht dort Soup of the day – Whiskey.
Auch wenn ich beschlossen hatte, auf meiner Reise keinen Pub zu betreten, bin ich nun viel zu neugierig und will mir die Temple Bar unbedingt von innen ansehen. Außerdem finde ich, geht sie definitiv als Sightseeing-Punkt durch, so berühmt wie sie ist.
Schon von draußen dringt Musik an mein Ohr. Ich ziehe die schwere hölzerne Eingangstür auf und gehe hinein. Obwohl es früh am Abend ist, ist der Pub brechend voll. Der Geruch von Bier, rauchigem Whiskey und abgestandener Luft schlägt mir entgegen. Die Stimmung und der irische Gesang ziehen mich magisch an. Ich schreite ehrfürchtig über die Mosaikfliesen, als würde ich die heiligen Hallen von König Charles betreten. An den Holzsäulen, die die Decke stützen, hängen in wuchtigen Rahmen Bilder von mir unbekannten Sängern. Ich schlängle mich an den in Grüppchen stehenden Pubbesuchern vorbei, die mit ihren Pints anstoßen und sich angeregt unterhalten. An einer der Bars, deren Regale vor Spirituosen beinahe überquellen, ordere ich mir ein Wasser. Mit dem Getränk in der Hand halte ich nach einem Sitzplatz Ausschau und spreche in bestem Englisch zwei Mittzwanzigerinnen an, die an einem der dunklen Holztische auf Barhockern sitzen.
»Ist hier noch frei?«
Sie nicken und ich geselle mich zu ihnen. Später verlassen ein paar Gäste den Tisch und sofort füllen sich die frei gewordenen Plätze erneut.
»Eine Runde Guinness für alle«, ruft einer der Neuankömmlinge und stellt mein leeres Wasserglas auf das Tablett des Kellners, der die Bestellung aufnimmt.
Mit seinen dunkelroten Haaren und dem karierten Holzfällerhemd verkörpert der groß gewachsene, vollbärtige Kerl für mich einen typischen Iren.
»Für mich bitte nicht«, stelle ich mit einem energischen Kopfschütteln klar, obwohl mir seine ungezwungene Art imponiert. Das Bier vorhin soll ein einziger Ausrutscher bleiben.
»Keine Widerrede!«, sagt er lachend und lässt mein Nein nicht gelten.
Okay, überredet. So übel hat es im Guinness-Storehouse nun auch wieder nicht geschmeckt.
»Ich bin übrigens John«, stellt sich der am Unterarm tätowierte Kerl vor, dessen breite Nase in einen dichten roten Bartwuchs übergeht.
»Simone Bach«, antworte ich und strecke förmlich die Hand nach ihm aus, die er mit einem Schmunzeln im Gesicht abschlägt.
Der Kellner serviert sechs Guinness auf einem Tablett und jeder am Tisch schnappt sich eins.
»Sláinte!«, prosten sich alle zu.
Steif hebe ich mein Glas. »Sláinte!«
Obwohl sich keiner hier zu kennen scheint, quasseln sie munter durcheinander und lachen wie altbekannte Freunde. Immer wieder versuchen sie, mich ins Gespräch mit einzubeziehen, was mir verdammt schwerfällt. Nicht wegen meiner Englischkenntnisse, vielmehr habe ich Probleme, mich mit diesen wildfremden Menschen zwanglos zu unterhalten.
Mann Simi, du bist nicht mal mehr fähig, stinknormalen Small Talk zu führen. Stell dich nicht so an, höre ich im Geiste Ninas Stimme.
Im Job bin ich tough, doch hier, in dieser derart gelösten Atmosphäre, habe ich allergrößte Mühe, mich locker ins Gespräch einzubringen. Fieberhaft grüble ich nach einer passenden Frage, die ich stellen könnte, und spreche schließlich die beiden Frauen, die zuerst am Tisch saßen, an. »Woher seid ihr?«
»Aus London, und du?«
»Deutschland. München, um genau zu sein.«
»Ah, Oktoberfest. Das kennen wir.«
Wieso verbindet jeder immer unmittelbar das Oktoberfest mit München?
»Warum sprichst du so akzentfrei Englisch? Man merkt gar nicht, dass du Deutsche bist.«
»Jetzt müsst ihr aufpassen«, unterbricht John das Gespräch und deutet auf die Bühne. »Der Kerl, der gleich spielt, ist ein Genie, ich schwöre es.«
Die drei Männer, die mit Geige und Mundharmonika eingängige irische Volkslieder gespielt und dazu gesungen haben, packen ihre Instrumente ein, leeren ihre Pints und räumen die Plätze für den kommenden Act.
Ein muskulöser Kerl in erdfarbenem Strickpullover mit Zopfmuster betritt mit einer zerschlissenen Gitarrenhülle im Schlepptau die Bühne. Mit seinen rötlichen Haaren und dem Dreitagebart wirkt er unglaublich sexy. Weniger wegen des Pullovers.
Mit einem breiten Grinsen sieht er ins Publikum, setzt sich auf den Barhocker und stimmt seine Westerngitarre. Dann schlägt er die ersten Töne an und erfüllt den Pub mit seiner tiefen, angenehmen Stimme.
Gebannt starre ich ihn an und nehme nur noch ihn und seinen Gesang wahr, der alle negativen Gefühle der vergangenen Tage in mir auszuradieren scheint. Flink schlagen seine Finger die Saiten der Gitarre an. Er strahlt Ruhe und Fröhlichkeit zugleich aus. Ausgeprägte Grübchen umspielen die Mundwinkel seines kantigen Gesichts und lassen ihn, selbst wenn er nicht lächelt, freundlich wirken.
Zwischendurch nippe ich am Guinness. Kaum ist es geleert, ermuntert John mich, einen Hot Whiskey zu probieren.
»Sláinte!«, wiederhole ich mein erstes gälisches Wort und stoße mit den anderen an.
Das köstlich heiße Getränk, in dem eine Orangenscheibe, gespickt mit Nelken, schwimmt, wärmt mich innerlich auf. Oder ist es der Sänger, der mein Innerstes erhitzt?
Keine Ahnung, wo mein Vorsatz geblieben ist, keinen Alkohol zu trinken. Er scheint wie weggeblasen. Das Zeug schmeckt aber auch verdammt lecker und ich merke, wie ich von Schluck zu Schluck gelöster werde.
John wippt im Takt der Musik und die beiden Ladys singen auswendig den eingängigen Text von Molly Malone mit.
Mit dem Kinn deutet John auf den Sänger und trinkt einen kräftigen Schluck von seinem Bier.
»Das ist mein bester Kumpel.« Der Stolz in seiner Stimme ist nicht zu überhören.
»Er singt wirklich genial«, rufe ich ihm über den Lärm der Musik und die plappernden Pubbesucher zu.
Die Stimmung wird von Minute zu Minute ausgelassener. Mittlerweile scheint absolut jeder hier die irischen Volkslieder aus voller Kehle mitzusingen. Gäste halten sich in den Armen, grölen und stoßen mit ihren Gläsern an. Als die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hat, spielt der Sänger seinen Schlussakkord und stellt die Gitarre beiseite.
Ich nutze die Gelegenheit und suche die Toilette im Untergeschoss auf. Beim Händewaschen betrachte ich meine geröteten Wangen im Spiegel und lächle mir zu. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach oben zu gehen. Hoffentlich ist die Pause nicht allzu lange. Denn das, was ich in der kurzen Zeit in der Temple Bar herausgefunden habe, ist, dass ich irische Volksmusik liebe. Gut, der Sänger tut sein Übriges dazu.
Vor den Toiletten herrscht ziemliches Getümmel. Ich schlängle mich zwischen einer Gruppe schwatzender Frauen hindurch, die über ihre Begleiter lästern und remple prompt jemanden. Ich schwanke bedrohlich.
»Sorry.« Ich will mich gerade an der Wand abstützen, um nicht zu fallen, da werden meine Ellenbogen von zwei starken Händen gepackt.
»Nicht hinfallen«, vernehme ich eine angenehme, tiefe Stimme.
Ich hebe den Kopf und schaue geradewegs in die leuchtend grünen Augen des Sängers.