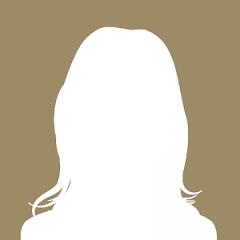Jasmin
Vorsichtig öffnete ich ein Auge. In meinem Kopf dröhnte es, als ob ein wild gewordener Bautrupp darin mit Presslufthämmern meine Schädeldecke bearbeitete. Ich richtete mich auf, was das Hämmern noch unerträglicher machte, und sah mich um. Oh Mann. Letzte Nacht …
Wie hieß der Kerl neben mir gleich noch mal? Marko? Mirko? Mike? Gestern Nacht hatte ich es noch gewusst.
Gestern Nacht hatte der Typ auch irgendwie noch besser ausgesehen. Und älter. Er war garantiert noch Student, auf dem Fußboden lagen Bücher und Zettel mit Notizen und Formeln herum und ein Kalender, auf den jemand für den kommenden Montag Referat eingetragen hatte. An der Wand prangte ein Poster mit den dicklichen Männchen von South Park. Daneben ein Herr der Ringe-Filmplakat. Wo hatte ich gestern Abend nur meinen Geschmack gelassen? Wahrscheinlich in Caipirinha ertränkt. Und meinen Verstand gleich noch mit dazu, denn diesen One-Night-Stand hätte ich mir echt sparen können.
Ich versuchte, mich vorsichtig aus der Umarmung des Typen zu befreien, der mich wie ein Affenbaby umklammert hielt und laut schnarchte. Wenn ich nicht gleich ein Glas kaltes Wasser und ein Aspirin auftrieb, würde ich sterben. Der Kerl neben mir – Mario? Moritz? Markus? – grunzte und wickelte seinen Arm im Schlaf noch fester um mich.
Ich überlegte, ob ich einfach schnell abhauen sollte.
Meine Klamotten lagen überall verstreut auf dem Boden herum, meine Stiefel umgekippt neben meiner wild verdrehten Strumpfhose, als hätten sich meine Kleidungsstücke letzte Nacht verselbstständigt und eine ausgelassene Orgie miteinander gefeiert. Mein bester BH, der teure von Prada, hing an der Türklinke. Eine komplette Verschwendung übrigens. Für diese stümperhafte Nacht hätte es auch das mausgraue Baumwollteil getan, das ich mir im Ausverkauf bei H&M gekauft hatte. Schließlich gelang es mir, mich aus der Umklammerung herauszuwinden, doch dann fiel mir der gähnend leere Kühlschrank in meiner Wohnung ein. Und meine blöde Kaffeemaschine, die sich seit Neuestem in einen zickigen, zischenden Vulkan verwandelte, sobald man sie anschaltete, eine ungenießbare körnige Brühe produzierte und dringend ersetzt werden musste. Apropos Kaffee …
Roch es hier nicht nach frisch gebrühtem Kaffee? Maurice oder Max hatte offenbar schon Kaffee für uns gekocht und war dann wieder eingeschlafen.
»Hey du«, sagte ich und rüttelte ihn leicht. Er röchelte.
Dann eben nicht. Ich stand auf. Ein Glas kaltes Wasser, einen Kaffee und dann nichts wie weg hier. Ich stieg, so wie ich war, über meine Klamotten und ging aus dem Zimmer. Im Flur war es dämmrig, wo war der blöde Lichtschalter? Egal. Benommen tappte ich dem einzigen Licht entgegen, das unter einer Tür hervorquoll, und stieß dabei gegen einen Garderobenständer.
Eine Pelzjacke segelte auf mich herunter. Eine Pelzjacke? Meine Güte, der Typ war ja noch bescheuerter, als ich geglaubt hatte. Ich öffnete die Tür, hinter der ich die Küche vermutete, und blieb wie angewurzelt stehen. Ein Mann und eine Frau Mitte fünfzig saßen dort an einem Frühstückstisch, ihre Köpfe fuhren herum und die Frau stieß einen spitzen kleinen Schrei aus.
»Wa…«, setzte ich an. Wer zum Geier war das?
»Moin, die Dame.« Der Mann grinste mich an, er trug ein rot-weiß kariertes Hemd, hatte eine Hornbrille auf und die aufgeschlagene BILD-Zeitung vor sich liegen.
»Eckbert!«, fauchte die Frau, um dann übergangslos und laut wie eine Sirene »Marcel? Marcel? Marcel?« zu rufen.
Marcel – so hieß der Typ im Schlafzimmer, schlagartig fiel es mir wieder ein. Ich verschränkte hastig die Arme vor der Brust – als ob das noch irgendwas nützte – und trat die Flucht an, zurück in das Schlafzimmer, wo dieser Marcel inzwischen aufgewacht war und sich gerade fluchend in seine Boxershorts strampelte.
»Scheiße, Mann, du kannst doch nicht einfach nackig in die Küche latschen«, zischte er mir zu. Laut rief er: »Ich kann das alles erklären, Mum, null problemo!« Er stürmte hinaus.
Mum? Ich glaubte mich verhört zu haben. Der wohnte noch bei seinen Eltern? Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ich presste die Finger an die Schläfen, um dieses Hämmern in meinem Kopf zu mildern, stieg dann wie ferngesteuert in meinen Slip und streifte mir meinen Rock über, während in der Küche eine laute Familiendiskussion entbrannte. Wo war noch mal mein BH? Ich drehte mich um und erstarrte. Im Türrahmen saß eine Dogge und hatte meinen BH im Mund, der vom Speichel des Hundes schon ganz aufgeweicht war. Zweihundert Euro. Zweihundert verdammte Euro hatte der BH gekostet, zweihundert Euro, die ich genauso gut ins Klo hätte schmeißen können. Der Hund guckte mich an, bellte einmal auf und trottete dann mit seiner Trophäe davon. Wütend zwängte ich mich in mein Top und schnappte Stiefel, Jacke und Handtasche. Die Strumpfhose ließ ich einfach liegen. Wenigstens brannte im Flur jetzt Licht und ich erkannte die Wohnungstür.
»Du machst gefälligst erst mal dein Abitur, Freundchen!«, keifte es aus der Küche.
Als ich im Treppenhaus stand, atmete ich auf. »Die war doch viel zu alt für Marcel«, war das Letzte, was ich hörte, bevor hinter mir die Tür ins Schloss fiel. Rasch schlüpfte ich in meine Stiefel und lief die Treppe hinunter.
Vor der Haustür steckte ich mir eine Zigarette an. Tief inhalierte ich den Rauch, schloss kurz die Augen und versuchte, das eben Erlebte auszublenden. »Ganz ruhig bleiben«, murmelte ich. »Passiert jedem irgendwann mal.« Aber nicht mit neunundzwanzig, höhnte eine fiese kleine Stimme in meinem Kopf. Mit neunundzwanzig, sind die meisten in einer festen Beziehung und gehen nicht mit Pennälern ins Bett.
»Ich bin erst achtundzwanzigeinhalb«, berichtigte ich laut und ignorierte die verwunderten Blicke eines Rentnerpaares, das seine Einkäufe in einem Rollator vor sich herschob. Es fing an zu nieseln. Fröstelnd sah ich mich um. Wo hatte ich nur mein Motorrad geparkt? Ach verdammt, ich war ja gestern gar nicht mit dem Motorrad gefahren, obwohl das rückblickend die bessere Entscheidung gewesen wäre. Nüchtern wäre mir das alles nie passiert. Und weil es hier weit und breit kein Taxi gab und ich sowieso fast pleite war, musste ich zur Strafe auch noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gurken. Mit wirren Haaren und verschmiertem Make-up, nackten Beinen und Minirock. Und das im November. Ich sah aus, als ob ich aus einem Party-Ufo gefallen wäre und seit dem Morgengrauen durch die Straßen irrte und meinen Heimatplaneten suchte.
Trotzig hob ich den Kopf, obwohl mich ein paar Leute unverhohlen anstarrten, und setzte mich in Bewegung.
Als ich um die Ecke bog, fuhr mir die Straßenbahn gerade vor der Nase davon, der Bus auf der anderen Straßenseite ebenfalls. Na, super. Ganz offensichtlich existierte der öffentliche Nahverkehr einzig und allein zu dem Zweck, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ich setzte mich auf die kalte Bank im Wartehäuschen, was zur Folge hatte, dass mein Rock noch höher rutschte. Gänsehaut überzog meine Beine wie Pustelausschlag. Wann kam endlich die nächste Bahn? Ich nahm mein Handy aus der Tasche, buchte ein mobiles Ticket für den Heimweg und durchsuchte meine SMS, um mich abzulenken, aber es fiel mir niemand ein, dem ich zu dieser frühen Tageszeit eine Nachricht hätte schicken können. Die meisten meiner Freunde schliefen doch noch. Ein Grüppchen von Fußballfans wartete ebenfalls an der Haltestelle, junge Männer, die sich dauernd anstießen und zu mir herübersahen, anzüglich lachten und dann in ihre Fußballtröte bliesen.
Ich wandte mich demonstrativ ab und sah in die andere Richtung. Oh Gott. Im zweiten Wartehäuschen standen ein Mann und eine Frau, die ich nur zu gut kannte. Mein Chef aus der Bank, Andreas Bergner – langweiligster Vertreter der männlichen Spezies vor dem Herrn, dessen Vorstellung von Spaß wahrscheinlich darin bestand, seine Büroklammern nach Farben zu ordnen. Und daneben meine Vorgesetzte, die blöde Schenker, die wahrscheinlich schon mit einem kleinen Aktenordner unter dem fetten Ärmchen geboren worden war und die ihre spitze Nase dauernd in meine Angelegenheiten steckte. Jetzt redete sie wie ein Wasserfall auf den Bergner ein und hielt nur hin und wieder inne, um sich einen kleinen und offensichtlich unverständlichen Heiterkeitsausbruch zu gönnen, jedenfalls lachte der Bergner nicht mit. Aber der lachte sowieso nie, fiel mir ein. Eigentlich sah er ja ganz gut aus oder besser gesagt – er hätte gut aussehen können, wenn er sich von seinen farblosen Outfits und diesem idiotisch tiefen Scheitel hätte trennen können oder sich wenigstens mal einen kleinen rebellischen Bart gestattet hätte, aber das sollte nicht mein Problem sein. Ich würde seine Feinrippunterwäsche niemals zu sehen bekommen, und das war auch gut so.
Auf jeden Fall waren diese beiden Pappnasen echt die letzten Menschen auf der Welt, denen ich an diesem Morgen über den Weg laufen wollte. Wieso standen die überhaupt zusammen an der Haltestelle? Heute war doch Samstag und keiner von uns musste zur Arbeit?
Andreas Bergner trug einen Anzug, aber vielleicht liebte er ja einfach diesen Nadelstreifenlook, genau wie die Schenker sich mit Vorliebe viel zu bunte Gewänder über den formlosen Leib warf und ihre strammen Waden in viel zu enge Stiefel rammte.
Da kam mir ein Gedanke: Hatten die etwa was miteinander? In diesem Moment blickte die Schenker zu mir herüber und ich bückte mich reflexartig, tat so, als ob mir etwas heruntergefallen wäre. Angestrengt fixierte ich einen alten Fahrschein, den jemand weggeworfen hatte, und richtete mich erst nach einer Weile vorsichtig wieder auf. Verdammt! Jetzt guckten sie alle beide neugierig zu mir her.
»Frau Ahrendt?«, rief die Schenker, ihre Stimme ungläubig und gleichzeitig voller sensationsgeiler Neugier. »Sind Sie das etwa?«
Ich ging wieder in Deckung. So ungefähr musste die Vorhölle sein. Rechts die Fußballtröte, die von Minute zu Minute lauter wurde, links Dick und Doof aus der Bank, dazu Nieselregen, Kälte, Brummschädel, blau gefrorene Beine, im Mund ein Geschmack wie toter Maulwurf und immer noch keinen Kaffee und keine verdammte Straßenbahn. Halt, da kam sie ja endlich. Ich stand rasch auf und nickte den beiden mit all der Würde zu, die ich noch aufbrachte, und sprintete sofort zum letzten Waggon, um endlich meine Ruhe zu haben.
Von wegen Ruhe. Vorne im Waggon saßen lauter junge Mütter mit Kinderwagen, aus denen Babys wie neugierige Robben herauslugten und einen Heidenlärm veranstalteten, hinten drei verliebte junge Paare mit Blumensträußen. Nur in der Mitte war Platz, gegenüber einer alten Frau mit einem dieser braunen Kartoffelsackmäntel. Instinktiv steuerte ich die Mitte an und wappnete mich gegen weitere strafende Blicke, aber die alte Frau sah nicht mal zu mir her, auch nicht, als ich aus Versehen mit meiner Handtasche ihren Mantel streifte und mich murmelnd entschuldigte. Die Frau starrte einfach nur ins Leere. Wahrscheinlich schwerhörig. Oder sehschwach. Oder beides. Umso besser. Ächzend ließ ich mich gegenüber der Alten in den Sitz fallen. Die Türen schlossen sich automatisch und weder Bergner noch die Schenker hatten mich verfolgt.
Ich atmete auf.
Geschafft.
Alma
Erhängen würde ich mich auf gar keinen Fall. Und zu Hause würde ich mich auch nicht umbringen, das stand fest. Allein schon, weil ich die Vorstellung nicht ertrug, dass die Kowalski, diese Klatschbase von Nachbarin, mich finden könnte und dann mit Grusel in der Stimme der gesamten Nachbarschaft von meiner heraushängender Zunge berichten würde.
Eine Pistole besaß ich natürlich nicht und mit Gas war nicht zu spaßen, da konnte ja das ganze Haus explodieren. Um an eine ordentliche Ladung Schlaftabletten zu kommen, hätte ich einen Termin bei Dr. Walter machen müssen, aber schon der Gedanke an das völlig überfüllte Wartezimmer, an das Husten und Niesen der Leute, an die genervte Arzthelferin hinterm Empfangstresen und nicht zuletzt an Dr. Walter, diesen fetten, arroganten Frosch, der so knauserig mit Rezepten umging, als müsste er sie von seinem Taschengeld bezahlen, hielt mich davon ab. So wollte ich meinen letzten Tag nicht verbringen. Ich wollte hinaus in die Natur, ich wollte den Himmel sehen, auch wenn er grau und kalt war, ich wollte frische Luft einatmen und als Letztes den Geruch des Waldes riechen, wenn ich mich im Steinbruch vor der Stadt von den Felsen stürzte. Das zu überleben war komplett unwahrscheinlich und ein schneller Tod garantiert.
Ich schnäuzte mich und sah mich ein letztes Mal in meiner Wohnung um. Alles war aufgeräumt, um die Blumen würde sich die Kowalski kümmern. Ich hatte ihr etwas von einer Kaffeefahrt nach Karlsbad erzählt. Sie hatte zwar misstrauisch ihre wässrig blauen Augen zusammengekniffen, schließlich fuhr ich ja niemals irgendwohin, aber aus lauter Vorfreude darauf, mal richtig in meiner Wohnung herumschnüffeln zu können, hatte sie sich offenbar weitere Fragen verkniffen.
»So, Dina.« In der Tragetasche auf dem Boden saß meine weiße Katze und döste. »Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass du nicht allzu lange im Tierheim herumsitzt. Es tut mir leid, meine Gute. Aber es geht nicht anders.« Ein dicker Kloß bildete sich in meinem Hals, als ich in ihr verwundertes kleines Katzengesicht blickte. Jetzt bloß nicht schwach werden.
»Bald bin ich bei dir, Harry«, sagte ich leise und warf einen Blick auf das Foto meines verstorbenen Mannes oben auf der Schrankwand. »Und dann wirst du mir verdammt noch mal erklären, was du mit diesen fünftausend Euro gemacht hast, sonst wirst du die Ewigkeit alleine verbringen müssen, das schwöre ich dir!« Wie hatte mein Harry mir das nur antun können? Was war nur in ihn gefahren, er war doch sein Leben lang so ein korrekter und nüchtern denkender Mensch gewesen?
Aber irgendein Teufel hatte ihn geritten, sich in seinem letzten Lebensjahr mit dem Abschaum dieser Welt einzulassen – mit einem skrupellosen Kredithai! Beim Gedanken an den gestrigen Besucher wurde mir wieder ganz übel. Es war um die Mittagszeit gewesen, als es heftig an der Tür geklingelt hatte. Ich wollte mich gerade zu einem Nickerchen hinlegen, obwohl es ehrlich gesagt nichts gab, wovon ich mich ausruhen musste, außer vielleicht von der ewigen Grübelei über Harrys plötzlichen Tod und darüber, wie leer und sinnlos mein Leben sich seitdem anfühlte. Erst wollte ich ja gar nicht aufmachen, doch dann siegte meine Neugier. Vor der Tür stand ein kompakter, bulliger Mann, dessen Muskeln seinen Anzug zu sprengen schienen.
»Frau Winter? Frau Alma Winter?« Der Mann lächelte routiniert und falsch und ließ dabei einen Goldzahn aufblitzen. Ich hatte schon immer eine gute Menschenkenntnis und ahnte sofort, dass dieser Mensch nicht hier war, um mir einen Lottogewinn zu überreichen.
»Ja?« Ich blieb auf der Hut.
»Matzke. Bin ein, nun, sagen wir – Bekannter Ihres verstorbenen Mannes Harry Winter. Mein Beileid übrigens.« Das falsche Lächeln des Mannes verwandelte sich für einen Augenblick in falsches Mitleid, seine kleinen Schweinsäuglein musterten mich dabei prüfend.
»Leider gibt es da noch, nun, sagen wir – unerledigte Geschäfte zwischen Herrn Winter und mir. Also jetzt zwischen, äh, Ihnen und mir.«
»Was?« Welche Geschäfte? Wer war dieser Mensch?
»Wovon sprechen Sie eigentlich?«
»Wenn ich kurz hereinkommen dürfte? Sie wollen ja sicher nicht, dass das ganze Haus von den Schulden Ihres Mannes erfährt.« Bei dem Wort Schulden erhob der schreckliche Kerl die Stimme und ich trat instinktiv einen Schritt zurück, was der Mann offenbar als Einladung auffasste, meine Wohnung zu betreten. Flink wie eine Kanalratte glitt er in meinen Flur und schloss die Tür hinter sich.
Mir blieb fast das Herz stehen. »Hören Sie, was soll das, ich werde gleich die Polizei rufen!« Meine Stimme versagte allerdings, ich stand da wie gelähmt und sah mich außerstande, diesem Kerl Einhalt zu gebieten.
Was hatte der vor? Erst letztens hatte in der Zeitung etwas vom »Würger von Westfalen« gestanden, der schon zwei Frauen ermordet hatte. Würde ich die dritte sein? Der Mann griff in seine Tasche und holte etwas heraus. Zu meiner grenzenlosen Erleichterung war es keine Axt und auch kein Würgestrick, sondern ein Blatt Papier.
»Bitte.« Der Mann reichte mir das Schriftstück und behielt dabei die ganze Zeit sein idiotisches Lächeln im Gesicht.
»Der Kreditvertrag. Ihr Mann, Harry Winter, hat kurz vor seinem Ableben bei mir einen Kredit von fünftausend Euro aufgenommen, zu einem Zinssatz von zwanzig Prozent im Monat, macht tausend Euro im Monat. Der Kredit hätte eigentlich schon längst zurückgezahlt werden müssen. Genau genommen spätestens im Mai. Da Herr Winter aber … äh … nicht mehr unter uns weilte und ich ein äußerst gutmütiger Mensch bin, der einer Witwe nicht auch noch finanzielle Bürden auferlegen will, habe ich mich vorerst nicht gemeldet. Jetzt ist mehr als ein halbes Jahr um und da muss der Kredit natürlich endlich zurückgezahlt werden.« Das Lächeln des Mannes steigerte sich zu einem geradezu irren Grinsen. »Mit Zinsen, versteht sich.«
»Wie …«, setzte ich an, weiter kam ich allerdings nicht, denn ich konnte keinen vernünftigen Satz formulieren und meine Gedanken wirbelten mir ohne Sinn und Verstand im Kopf herum.
»Wie viel? Kopfrechnen ist nicht so Ihre Stärke, was?«
Der Mann winkte ab. »Nichts für ungut. Mai bis … was haben wir jetzt, November – na, ich will mal nicht so sein, sagen wir Mai bis Oktober, das sind sechs Monate ä tausend Euro, das macht sechstausend Euro plus die ursprünglichen fünftausend, sind also zusammen elftausend Euro. Zahlbar bis, nun, sagen wir …« Er hielt kurz inne, als müsste er darüber nachdenken. »Bis Dienstag. Weil Sie es sind. Heute ist übrigens Freitag. Der dreizehnte.« Wieder das heimtückische Grinsen.
Ich blickte auf das Papier. Das war die Unterschrift von meinem Harry, ganz ohne Zweifel. Datiert auf den dritten April diesen Jahres, einen Monat vor seinem Tod durch Herzversagen.
»Was wollte er denn mit dem Geld?«, gelang es mir jetzt endlich zu fragen.
»Das hat er mir nicht verraten. Irgendwas wird er schon damit gemacht haben, und wenn Sie es nicht wissen, dann … äh … hatte er wahrscheinlich seine Gründe dafür.«
»Was soll das heißen?«, gab ich zurück. Eine Unverschämtheit. Langsam erwachte ich aus meiner Erstarrung.
Der schreckliche Mann hob abwehrend beide Hände.
»Gute Frau, ich mache hier nur meinen Job. Und der besteht darin, das Geld einzutreiben. Ganz einfach.«
»Aber das ist absurd«, wehrte ich mich. »Was hat er denn damit gemacht? Und wie soll ich das zurückzahlen? Ich besitze keine elftausend Euro.«
»Tja.« Er strich sich nachdenklich über das Kinn.
»Dann haben Sie ein Problem, würde ich mal sagen.«
Er sah sich neugierig um. »Gemütlich, gemütlich. Irgendwelche Antiquitäten? Ihr alten Leutchen habt doch immer noch ein paar Familienerbstücke herumliegen. Schmuck?« Er schlenderte durchs Zimmer und zog wahllos eine Schublade an meiner Kommode auf. Mit dem Finger angelte er ein Spitzendeckchen heraus wie eine Scheibe Käse. »Du lieber Himmel. Was soll das denn sein?« Er ließ das Deckchen, ein Erbstück von meiner Mutter, achtlos auf den Boden fallen.
Jetzt reichte es mir. »Lassen Sie das gefälligst!«
Der Mann ignorierte mich und öffnete ein Fenster.
»Ziemlich hoch, nicht?«, sagte er. »Was da runterfällt, ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten.« Mit diesen Worten versetzte er einem meiner Alpenveilchen einen Schubs und stieß den Blumentopf aus dem Fenster. Sekunden später klirrte es unten auf der Straße. Ich zuckte zusammen.
»Ups.« Der Mann sah mich an und aus seinem Gesicht war nun jegliche vorgetäuschte Freundlichkeit verschwunden. »So ein gefährliches Fenster. Da kann leicht mal ein Unfall passieren.« Er bückte sich und hob etwas vom Boden auf, und noch bevor mein Gehirn realisieren konnte, was um alles in der Welt er da gefunden hatte, hielt er etwas Weißes aus dem Fenster.
»Dina!«, schrie ich entsetzt und schlug die Hand vor den Mund. »Oh mein Gott, was tun Sie denn da, bitte nicht! Lassen Sie doch das arme Tier in Ruhe, ich flehe Sie an … ich … ich will ja … ich mach ja … das Geld … ich …«
»So eine dumme Katze. Wäre doch glatt beinahe rausgefallen.«
Der Mann setzte Dina auf dem Fensterbrett ab, von dem sie sofort fauchend heruntersprang und dann trotz ihres Alters wie der Blitz davonrannte.
»Nun, ich denke also, wir verstehen uns.« Er schnippte ein paar Katzenhaare von seinem Ärmel. »Seien Sie kreativ, Frau Winter. Ihren Ehering zum Beispiel, den brauchen Sie doch weiß Gott nicht mehr. Bestimmt gibt es da noch so einige andere Dinge, die Sie entbehren können. Ich nehme auch eine Anzahlung. Was braucht denn eine Frau in Ihrem Alter noch? Für die Anzahlung kann ich allerdings nicht bis Dienstag warten. Die wäre dann schon, nun, sagen wir, morgen fällig.« Er nickte mir lächelnd zu, als hätten wir uns gerade fürs Wochenende zu einem Picknick im Grünen verabredet. Dann griff er in seinen Aktenkoffer. »Ehe ich es vergesse – Ihre Kopie des Vertrags. Alles rechtens und schwarz auf weiß. Also bis morgen dann, Frau Winter.« Er hielt mir seine Hand hin und wischte sie dann, als ich nicht reagierte, an seiner Hose ab. »Tja. Auf Wiedersehen.«
Ich sah ihm nach, wie er ohne Eile zur Tür schlenderte, dabei auf das Spitzendeckchen meiner Mutter trat und mit seiner Tasche achtlos ein Foto von der Kommode fegte. Unser Hochzeitsfoto, auf dem wir beide so jung und so verliebt aussahen, wie wir es damals auch waren.
Die Tür fiel ins Schloss und ich merkte erst jetzt, dass ich am ganzen Leib bebte. Was für ein Flegel! Was für ein Unmensch, ein Widerling! Was für …
»… eine Katastrophe«, flüsterte ich. Ich goss mir zitternd einen Sherry ein, aber der half mir nicht beim Nachdenken. Immer und immer wieder betrachtete ich den Vertrag, falls man ihn so nennen wollte, denn er war sehr kurz.
Ich, Harry Winter, bestätige hiermit den Erhalt von EUR 5000,- von Herrn Bernhard Matzke. Die Rückzahlung erfolgt zu einem Zinssatz von zwanzig Prozent monatlich.
Gezeichnet Harry Winter
Gezeichnet Bernhard Matzke
Meine Augen sind schon lange nicht mehr die Besten und Haftschalen habe ich nie vertragen, deshalb rückte ich meine dicke Brille gerade, las jede Zeile dreimal und für Harrys Unterschrift holte ich sogar die Lupe heraus.
Die Unterschrift war echt. Diesen Schnörkel am W von Winter, den beherrschte nur Harry. Mein Mann hatte sich also von einem brutalen Gangster fünftausend Euro geliehen und ich musste das jetzt ausbaden. Der Kerl würde morgen wiederkommen. Wahrscheinlich würde er jeden Tag wiederkommen. Und irgendwann würde er ganz sicher nicht nur Dina aus dem Fenster halten.
Ich überlegte, ob ich zur Polizei gehen sollte. Aber was hatte ich schon in der Hand? Der Vertrag verstieß nicht gegen das Gesetz und für die Machenschaften des Mannes hatte ich keine Beweise. Außerdem hatten die bei der Polizei mich neulich erst behandelt wie eine dumme Greisin, als ich aufgeregt meinen Ausweis als gestohlen melden wollte und ihn dann ausgerechnet auf dem Polizeirevier bei der Suche nach einem Stift in meiner Handtasche fand. Dem herablassenden Benehmen der Beamten mir gegenüber war eindeutig zu entnehmen, dass sie mich für verkalkt hielten und für schwerhörig noch dazu, insgesamt eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt wiederholen musste.
Aber dieser Halunke würde gnadenlos wiederkommen, so viel war klar. So lange, bis er sein Geld zurückhatte. Oder eben auch nicht, schoss es mir plötzlich durch den Kopf. Wenn es mich nicht mehr gab, dann gab es ja auch keine Schulden mehr. Harry und ich hatten keine Kinder, keine Enkel, keine lebenden Verwandten. Ich war sozusagen der letzte Mohikaner, die letzte Abgesandte der Familie Winter, und wenn dieser … dieser Matzke sich auch auf den Kopf stellte und tobte – wenn ich nicht mehr da war, dann bekam er eben auch sein Geld nicht zurück.
»Nun, sagen wir … tschüss, Herr Matzke.« Entschlossen stand ich auf. Es war ja nicht so, dass ich diesen Gedanken zum ersten Mal dachte. Ganz im Gegenteil, in den letzten Monaten hatte es fast keinen Tag gegeben, an dem ich nicht in Betracht gezogen hatte, mir das Leben zu nehmen und diesem trübsinnigen Dasein zu entfliehen. Alle, die mir je etwas bedeutet hatten, lebten nicht mehr und es gab einfach kaum etwas, das mir noch Freude bereitete. Nur Dina, meine Katze. Und Kreuzworträtsel und vielleicht noch die Lindenstraße.
Obwohl, die wurde auch immer alberner. Dort wurden die Leute einen Kredithai ganz locker los, weil irgendjemand sie rettete. Aber mich würde niemand retten und das Leben hielt nichts mehr für mich bereit, im Gegenteil. Alles, was in den nächsten Wochen auf mich wartete, war unser gemeinsamer Hochzeitstag im Dezember, der erste ohne Harry. Ein Tag, der so traurig sein würde, dass ich ihn am liebsten aus dem Gedächtnis gestrichen hätte. Das Einzige, was mir noch geblieben war, war mein freier Wille, und wenn ich den benutzen konnte, um diesem Widerling Matzke die Suppe zu versalzen, dann sollte es eben so sein. Wenigstens ging ich dadurch als Siegerin aus der Sache hervor.
Und deswegen hatte ich gleich morgens der Kowalski etwas von einer Kaffeefahrt vorgelogen, hatte überall ordentlich sauber gemacht, die Blumen gegossen und Dina gefüttert.
Jetzt schenkte ich meiner Wohnung einen letzten Blick, dann riss ich mich los und verließ an diesem kalten Novembervormittag das Haus.
Bei der Übergabe im Tierheim musste ich dann doch weinen, woraufhin die freundliche junge Frau mir versicherte, dass sich viele ältere Leute irgendwann eben nicht mehr um ihre Tiere kümmern könnten und dass man für Dina bestimmt ein gutes Zuhause finden werde, schließlich sei sie doch pflegeleicht und verschmust und schön. Sie schlug sogar vor, dass ich Dina irgendwann besuchen könnte, aber das würde natürlich nicht gehen, wie ich wusste. Von da, wo ich dann war, führt kein Weg mehr zurück. Aber das behielt ich für mich. Wenig später stieg ich innerlich völlig dumpf und leer in die Straßenbahn ein.
Ich wollte bis zur Endhaltestelle am Rande der Stadt fahren und dort trotz meiner kaputten Knie den Wanderweg zu den Felsen hinauflaufen, den ich früher mit Harry so oft gegangen bin. Links in der Bahn glucksten ein paar fröhliche Kleinkinder mit ihren Müttern, vorn saß ein verliebtes junges Paar. Überall war Glück und Hoffnung zu sehen, nur eben nicht für mich. Ich begab mich zu einem Platz in der Mitte der Bahn und konzentrierte meine ganze Kraft darauf, fest bei meinem Entschluss zu bleiben. Hoffentlich traf ich auf meinem letzten Weg niemanden mehr, den ich kannte, und hoffentlich sprach mich keiner an. Vor allem nicht dieses zerrupfte junge Huhn mit Minirock und nackten Beinen, das sich an der nächsten Haltestelle mir gegenüber ächzend in den Sitz schmiss, in einen Schwall von Zigarettenrauch und viel zu schwerem Parfüm gehüllt, und irgendwas vor sich hin murmelte.
Jasmin
Ich sah aus dem Fenster, damit ich mir nicht das bedrückte Gesicht der alten Frau oder das Geknutsche der jungen Paare reinziehen musste. Den Babys hatte ich ja Gott sei Dank den Rücken zugekehrt, was nicht hieß, dass mir das Gezeter der nervigen Quäker erspart blieb.
In letzter Zeit kam es mir immer öfter so vor, als fände um mich herum eine heimliche Invasion von Babys statt, als schlichen sich die kleinen Biester wie Undercoveragenten in alle meine Lebensbereiche, um mich dann in irgendeinem besonders schwachen und deprimierenden Moment wie Sniper mit ihrem zahnlosen Lächeln mitten ins Herz zu treffen. Selbst meine beste Freundin Lisa zeigte seit Neuestem ein unverhohlenes Interesse an Nachwuchs, weshalb ich in letzter Zeit immer öfter versucht hatte, das Gespräch über Menschen unter einem Meter Körpergröße zu vermeiden. Babys waren absolut nichts für mich, ich kriegte ja nicht mal mein eigenes Leben auf die Reihe.
Die Straßenbahn hielt jetzt direkt vor einem Werbeplakat an, das eine makellose junge Schönheit zeigte – eine Werbung für Antifaltencreme. Na, sicher doch. Ich schnaufte verächtlich. Als ob das gefühlt vierzehnjährige Model auf dem Bild auch nur ansatzweise mit ersten Falten zu kämpfen hätte. Und überhaupt, dieser ständige Schönheitskult und Jugendzwang und Erfolgsdruck fing echt an, mir auf die Nerven zu gehen. Der dauernde Stress, gut auszusehen, perfekt und durchtrainiert und fit zu sein, geschwungene Augenbrauen und volle Lippen und rasierte Beine und als Hobby möglichst etwas Reißerisches wie Fallschirmspringen zu haben und von Beruf am besten erfolgreiche Ärztin zu sein, die Ebola bekämpfte und nebenbei Glasskuplturen blies, im Sommer alleine mit dem Mountainbike durch die Karpaten radelte und über Weihnachten vierzig rumänische Straßenhunde bei sich aufnahm! Wie sollte da jemand wie ich mithalten, wenn das der Standard war, den Männer heutzutage verlangten?
Die Straßenbahn fuhr durch einen Tunnel und ich erhaschte einen Moment lang einen viel zu detaillierten Blick auf mein Spiegelbild – meine langen blonden Haare zerzaust und strähnig, Schatten unter den Augen, meine grünen Augen blutunterlaufen, mein Gesicht, das irgendein Typ mal als herzförmig und süß bezeichnet hatte, seltsam zerknautscht. Mann, sah ich heute früh furchtbar aus. Die Straßenbahn hielt quietschend an, die Mütter mit Babys und die jüngeren Paare stiegen aus und ich fand mich unvermittelt alleine mit der alten Frau im Waggon wieder. Am liebsten wäre ich ja aufgestanden und hätte mich woanders hingesetzt, aber das hätte irgendwie unhöflich gewirkt, als ob die alte Frau unangenehm riechen würde oder so. Ich schnupperte unauffällig. Nein, tat sie definitiv nicht.
Heimlich betrachtete ich sie jetzt aus den Augenwinkeln. Graues Haar zu einer Art Nest auf dem Kopf gedreht und mit Kämmchen in Form gehalten, ebenso graue Augenbrauen, ein komplett ungeschminktes faltiges und irgendwie müdes Gesicht, ein kleiner Mund zwischen Apfelbäckchen, die fröhlich gewirkt hätten, wenn sie nicht so farblos gewesen wären. Der Rest der Frau blieb unter ihrem Kartoffelsackmantel verborgen und bot wahrscheinlich sowieso keinerlei aufregende Details mehr. Wenn ich es mir recht überlegte, hatte sie es eigentlich ziemlich gut. Die ganze Karriere und das Paarungsgedöns des Lebens lagen hinter ihr, es war völlig egal, wie sie aussah und was sie anzog – diesen Mantel hätte ich ja zum Beispiel nicht mal mit der Kneifzange angefasst, aber wahrscheinlich war er warm, und nur das zählte. Es guckte ihr ja sowieso niemand mehr hinterher. Und auch das musste irgendwie erleichternd sein, dachte ich und war zugleich verblüfft. Wenn einem niemand mehr hinterherguckte, konnte man sich hemmungslos gehenlassen. Essen, was man wollte, und tun, was man wollte – bis mittags schlafen zum Beispiel oder nachts um drei den Kühlschrank leeren und fernsehen.
Man konnte jeden anmeckern, der einen nervte, denn man musste niemandem mehr gefallen und genoss Narrenfreiheit. Man konnte die Haare an seinen Beinen sogar zu Zöpfchen flechten, wenn es einem in den Sinn kam, und niemand nahm es wahr. Man konnte sich einen gigantischen Seeadler auf den Rücken tätowieren lassen und niemand krähte: »Aber weißt du, wie blöd das aussieht, wenn du mal alt bist?« Denn man war ja alt.
»Herrlich«, rutschte es mir laut heraus.
Die alte Frau sah mich erstaunt an und dann war plötzlich etwas in ihren Augen, ein Art Verwunderung darüber, als hätte ich etwas ausgesprochen, was sie selbst gerade gedacht hatte, und in diesem Moment bremste die Straßenbahn so scharf, dass ich aus dem Sitz katapultiert und gegen die Frau geschleudert wurde. Noch bevor ich mich irgendwo festhalten konnte, flog ich mit Wucht wieder zurück. Das Licht ging aus, die Bremsen quietschten unerträglich laut, es rumpelte und krachte und ich presste schnell die Hand vor den Mund, weil ich sonst den ganzen Caipirinha der letzten Nacht auf die alte Frau gespuckt hätte. Mit letzter Kraft rappelte ich mich hoch und taumelte durch den Waggon zur Straßenbahntür, die sich auf wundersame Weise in dem Moment öffnete, als das Licht wieder anging.
Ich floh aus der Bahn und beugte mich draußen an der Haltestelle über den Abfalleimer, aber die Übelkeit war auf einmal wie weggeblasen und durch einen dumpfen Schmerz in meinen Knien ersetzt.
»Scheiß Bahn«, fluchte ich und griff fahrig in meine Jackentasche, um meine Zigaretten herauszuholen, aber an der Stelle war auf einmal keine Jackentasche mehr.
Auch nicht mehr meine Lederjacke, sondern so ein komischer kratziger Stoff. Ich schwankte leicht und sah dann ungläubig an mir hinunter.
»Was …?«