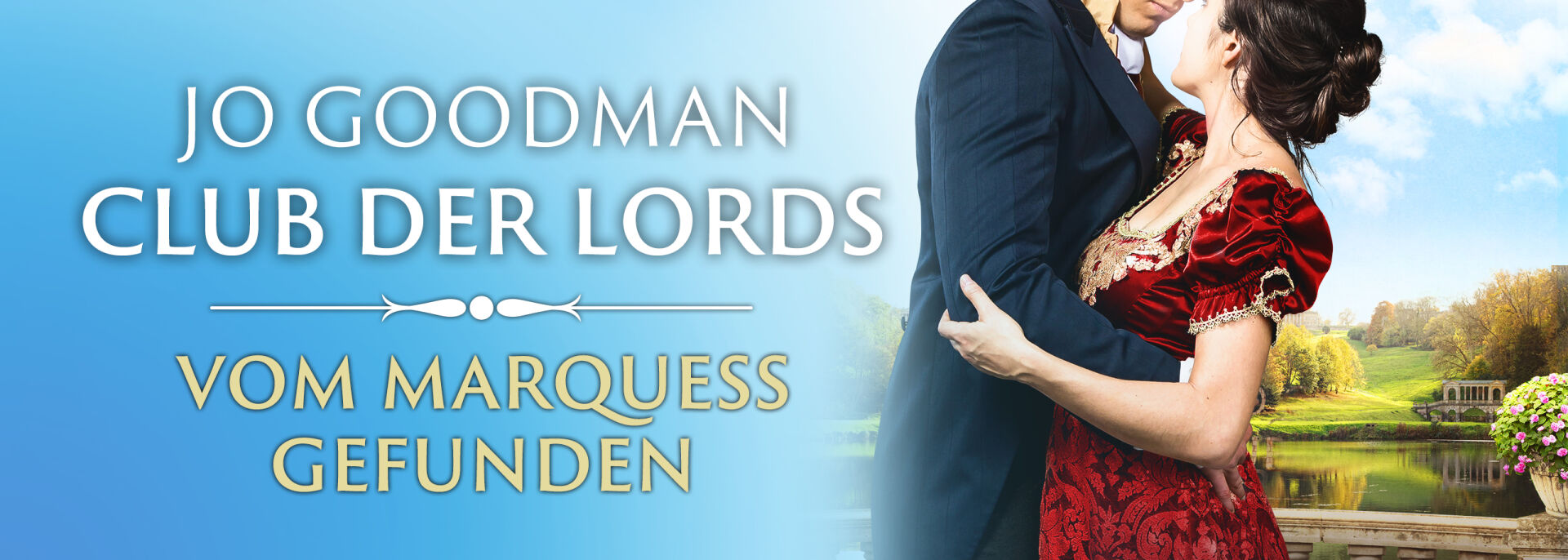Prolog
1796, Hambrick Hall, London
»Halt, es ist Zoll zu zahlen.«
Gabriel Whitney kam schlitternd zum Stehen, als ihm plötzlich ein ausgestreckter Arm den Weg versperrte. Das Kopfsteinpflaster von Hambrick Hall war immer noch rutschig vom überraschenden Regenschauer am Morgen, und Gabriel hatte Mühe, das Gleichgewicht zu wahren, zumal er das große Paket in seinen Händen nicht loslassen wollte. Teekuchen, Biskuits und Rosinenküchlein würden nicht mehr so gut munden, wenn sie erst einmal auf eine Hand voll Krümel reduziert waren.
Erstaunt sah er sein Gegenüber an. »Zoll?«
»Das sagte ich doch soeben, oder nicht?« Der junge Lord Barlough sah zu seinen beiden Freunden, die ihre Arme in Gabriels Richtung ausgestreckt hielten. Offenbar erwarteten sie, er werde den Versuch unternehmen, um sie herumzulaufen und dann davonzueilen. Barlough ließ demonstrativ unbekümmert seinen Arm sinken. »Er kann doch gar nicht weglaufen. Er hat das Paket, und wir wissen, er würde niemals riskieren, dass es Schaden erleidet. Seinen Kuchen und Puddingteilchen soll ja schließlich nichts zustoßen.«
»Teekuchen, Biskuits und Rosinenküchlein«, erwiderte Gabriel vorsichtig. »Wenn der Zoll auf Kuchen und Puddingteilchen zu entrichten ist, dann trifft er auf mein Gebäck ja nicht zu.«
»Teekuchen, Biskuits und Rosinenküchlein«, wiederholte Barlough in dem spöttischen, hohen Tonfall, in den Gabriel noch immer von Zeit zu Zeit verfiel. Seit Barlough selbst die Phase des Mannwerdens hinter sich gebracht hatte, empfand er keinerlei Mitgefühl mit denjenigen, die noch nicht so weit waren. »Der Zoll gilt für Süßes«, sagte er dann. »Für jede Art Süßes. Teekuchen, sagtest du?«
Gabriel nickte. Eine kastanienfarbene Haarlocke fiel ihm dabei ins Gesicht, die seine Nase kitzelte und die er nicht zurückstreichen konnte, weil er das Paket festhalten musste. Den Kopf in den Nacken werfen wollte er in Barloughs Gegenwart ebenfalls nicht, also versuchte er, sie aus dem Gesicht zu pusten. Das Ergebnis war jedoch, dass sie ihn nur noch mehr kitzelte.
»Du siehst aus wie ein Mädchen, wenn du das tust, Master Whitney«, meinte sein Gegenüber und wandte sich an seine Begleiter. »Sah er eben nicht aus wie ein Mädchen?«
Gabriel blickte stur zu Barlough, doch aus dem Augenwinkel sah er Harte und Pendrake nicken. Sein Gesicht lief vor Wut über diesen Vergleich rot an. Gabriel kannte Mädchen, er hatte eine ältere Schwester und vier Cousinen. Ein Mädchen war zart und rundlich und hatte rosige Wangen, dazu einen wilden Lockenkopf und einen Schmollmund. Und ein Mädchen neigte zu Wutanfällen und Tränenausbrüchen.
Ihm wurde bewusst, dass ihm selbst auch nach Weinen zumute war. Er biss sich auf die Unterlippe, und der Schmerz half ihm, die Tränen zu unterdrücken.
»Er errötet!«, sagte Pendrake und wollte Barlough mit dem Ellbogen anstoßen, doch der wich dieser vertraulichen Berührung aus. Als der Erzbischof des ›Ordens der Bischöfe‹ stand er über solch kumpelhaften Gesten, und der Respekt vor seiner Position innerhalb dieses Bundes machte es erforderlich, dass gewisse Formalitäten gewahrt wurden. Pendrake erkannte seinen Fehler und schloss die entstandene Lücke rasch, indem er mit dem Finger auf Gabriel zeigte. »Er errötet«, wiederholte er. »Wie ein Mädchen.«
Gabriel fühlte die Hitze in seinen Wangen und hätte am liebsten das Paket fallen lassen, um sich die Hände vors Gesicht zu schlagen. Es war ja so peinlich! Wenn er das Paket wirklich losließ, dann nur, um seine Fäuste gegen die anderen zu erheben. Doch wenn er sich nicht zusammenriss, dann würde er nicht nur das Gebäck seiner Mutter ruinieren, sondern auch den gesamten Plan.
Selbstverständlich gab es einen Plan. Sein Freund South hatte darauf bestanden, auch wenn er selbst lieber die Fäuste eingesetzt hätte. Aber South war ein genialer Denker, und er hatte sogar die gemeinsamen Freunde Brendan und Evan davon überzeugt, sich seiner Meinung anzuschließen. Bei einem Verhältnis von drei zu eins war Gabriel zu der Ansicht gelangt, Fausthiebe seien vielleicht nicht die beste Methode, um den Orden der Bischöfe herauszufordern.
Gabriel Richard Whitney, von seinen besten Freunden East genannt, war ein Viertel des Compass-Clubs, der noch keine etablierte Institution in Hambrick Hall darstellte. Ihrem Bund fehlte es an der ruhmreichen Vergangenheit des Ordens der Bischöfe, und seine Entstehung war auch nicht unter mysteriösen Umständen erfolgt. Genau genommen war der Compass-Club erst vor Kurzem gegründet worden. An kommende Generationen hatte niemand von ihnen einen Gedanken verschwendet, auch wenn man bereits eine Gründungsurkunde vorweisen konnte. Die war jedoch kaum mehr als ein schlechter Reim, den South geschrieben hatte. Sie alle mochten ihn, doch selbst South musste zugeben, dass es ein wirklich schlechter Reim war.
Heftig umstritten war nach wie vor das Thema des Blutschwurs. Beim Schwur an sich war man sich einig, dass man der eingeschworene Feind des Ordens der Bischöfe war. Nur die Sache mit dem Blut …
Brendan Hampton alias North und Viscount Southerton, kurz South genannt, sprachen sich für einen blutfreien
Schwur aus. Evan Marchman alias West und Gabriel dagegen hielten es für fast schon unverzichtbar, dass Blut fließen musste. Entschieden war darüber noch nicht, doch Gabriel vermutete, sich zusammen mit West durchzusetzen. North und South konnten ihre Haltung nicht allzu energisch verteidigen, wenn sie sich nicht der Feigheit verdächtig machen wollten. Er wusste, er war nicht der Einzige, der den Vergleich mit einem Mädchen scheute.
Dieser Gedanke brachte ihn zurück zu der misslichen Lage, in der er sich befand. Er hatte versprochen, gegenüber den Bischöfen nicht die Fäuste sprechen zu lassen, und auch wenn er erst zehn war, stand er zu seinem Wort. Der Duft der Backwaren aus dem Karton war zu verlockend. Besonders Puddingteilchen hatten es ihm angetan, doch Gabriel wusste, dass dieser Speise der Transport vom Landsitz in Braeden nach hierher nicht gut bekam. Die Bischöfe hätten darum einen Bogen gemacht, wäre ihnen Hufelands Buch ›Makrobiotik, oder: Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern‹ bekannt gewesen. Es gab gewisse Speisen, die man besser meiden sollte, erst recht, wenn sie bereits drei Tage alt waren.
»Wie hoch ist der Zoll?«, fragte Gabriel. Seine Wangen kühlten sich ein wenig ab, als er an seine Mission dachte und alle weiteren Überlegungen verdrängte. Sollten die anderen ihn weiter aufziehen, würde er sie ignorieren müssen. Hier war eine gewisse Diplomatie unverzichtbar, und obwohl es Gabriel manchmal wütend machte, so sachlich und kühl zu bleiben, verstand er doch, warum es notwendig war.
Barlough musterte das Paket und fragte sich, wie viele Stücke Teekuchen und Rosinenküchlein sich darin befinden mochten. Letztere sagten ihm nicht zu, weil ihn die Rosinen im Teig störten, auch wenn ihm Rosinen pur durchaus schmeckten. Vielleicht würde er die Rosinen herauspulen und sie den anderen geben, auch wenn die sicherlich dagegen protestierten. Aber er hatte das letzte Wort, und sie mussten akzeptieren, dass es im Orden keine höhere Stelle gab, bei der sie sich hätten beschweren können. »Dein Paket«, sagte Barlough zu Gabriel. »Gib es her.«
»Das ganze Paket? Ich würde sagen, das ist aber ziemlich viel Zoll.« Es überraschte ihn nicht, dass der andere ihn ausrauben wollte. Seit drei Wochen beobachtete der Compass-Club, dass die Mitglieder des Ordens der Bischöfe die Klassenkameraden aus Hambrick Hall erpressten. Vorzugsweise nahmen sie sich Jungs vor, die vom Postamt kamen. Meistens ließen sie sich von ihnen Geld aushändigen, aber es gab auch Ausnahmen von dieser Regel. So musste der junge Master Healy sich vom Kommandanten seiner Zinnsoldaten-Armee trennen, und Bentley Vancouver verlor ein Dutzend Karten an die Bischöfe, die Darstellungen von bis zu diesem Moment undenkbaren sexuellen Akten zeigten. Der arme Bentley war untröstlich, dieses Geschenk seines älteren Bruders zu seinem dreizehnten Geburtstag hergeben zu müssen.
In dem Moment hatte Gabriel entschieden, dass man etwas gegen diesen Orden unternehmen musste. Nachdem er davon überzeugt worden war, Barlough zu verprügeln sei keine kluge Strategie, bot er eines der regelmäßig von zu Hause eintreffenden Pakete an, um Rache zu üben.
»Ich glaube nicht, dass ich dir alles geben möchte«, entgegnete Gabriel. »Vielleicht genügen ja ein paar Stücke Teekuchen.«
Lord Barlough zog übertrieben eine Augenbraue hoch. »Du bist ein frecher Bengel, weißt du das?« Er sah sich auf dem Innenhof um, doch niemand sonst schien sich dort aufzuhalten. Alle hatten sie Respekt vor dem Orden der Bischöfe, der schon seit der Gründung von Hambrick Hall existierte – und der auch weiterhin existieren würde, da seine Mitglieder keine Repressalien fürchten mussten. »Verstecken sich deine Freunde in der Nähe, oder wieso bist du so mutig?«
Freunde. Gabriel musste lächeln, als er daran dachte, dass er hier Freunde hatte. Es war eine ganz neue Erfahrung für ihn, die ihm gut gefiel. Er hatte sich sehr einsam gefühlt, wenn er in seinem Zimmer saß, allein mit sich und den Kuchen, Torten und Biskuits, die er unter dem Bett, im Schreibtisch und unten im Schrank versteckte. Niemand außer seiner Mutter schien zu verstehen, wie sehr ihm Braeden fehlte. Und auch wenn Kuchen ein schaler Trost für seine Einsamkeit war, erschien es ihm immer noch besser als gar nichts.
»Meine Freunde sind nicht hier«, sagte Gabriel und wurde schnell wieder ernst. »Die haben Wichtiges zu erledigen.«
»Tatsächlich?«
»Ja.«
»Das war eine rhetorische Frage, auf die man nicht antworten muss.«
»Oh.«
»Dein Gehirn ist wohl genauso plump und fett wie du, nicht wahr?«
»Wie bitte?« Gabriel musste sich zwingen, nicht die Fäuste einzusetzen. Er wusste, dass ihm die Süßigkeiten seiner Mutter zu gut schmeckten und er durchaus etwas rundlich war, aber es ärgerte ihn, wenn sich jemand darüber lustig machte.
»Und deine Ohren hat das Fett wohl auch schon verstopft.«
Gabriel regte sich nicht, aber mit seinen wachsamen Augen, die von der gleichen Farbe waren wie sein Haar, beobachtete er die Szene ganz genau. Er hätte es mit den dreien aufgenommen, auch wenn er wusste, er würde unterliegen, doch die Erkenntnis, dass die Bischöfe womöglich mehr wollten als das, was er in seinen Armen trug, half ihm, seine Wut zu bändigen.
»Lass mich durch«, sagte er gelassen.
Barlough und die anderen streckten sofort die Arme aus, um ihm den Weg zu versperren. »Dein Paket, Biest.«
Gabriel stutzte. Hatte Barlough ihn tatsächlich Biest genannt? »East, M'lord. Meine Freunde nennen mich East.«
»Mir ist das egal, weil ich nicht dein Freund bin. Ich werde dich einfach Biest nennen. Du siehst so aus, als würdest du regelmäßig wie ein Biest fressen.« Barlough streckte die Hand aus. »Und jetzt … das Paket. Ich räume eine Vorliebe für Teekuchen ein, und so wie du aussiehst, dürften die wohl zu empfehlen sein.«
»Ich glaube nicht, dass du sie mögen wirst.«
Barlough fragte nicht nach dem Grund für diese Bemerkung. Das Hin und Her war ermüdend genug gewesen, und vor allem bedauerte er, dass Gabriel sich nicht zu einer Tätlichkeit hatte hinreißen lassen. Er nahm ihm das Paket ab und warf es Pendrake zu, dem Größten der drei, der es so hoch hielt, dass Gabriel es nicht mehr erreichen konnte.
Gabriel spielte den Geschlagenen, wischte eine Träne weg, die er förmlich hatte herauspressen müssen, während Barlough ihm den Weg freigab. Als er sich von der Gruppe entfernte, wusste er, dass er der wahre Sieger war, auch wenn es nicht danach aussah. Er hatte eine Strategie gewählt, die ganz ohne Gewalt auskam, und Gabriel fragte sich, ob er schließlich doch im Begriff war, ein Kesselflicker zu werden.
***
Alle vier Mitglieder des Compass-Clubs standen im dunkel getäfelten oberen Korridor des Yarrow House beisammen, als Barlough aus seinem Zimmer gestürmt kam und durch den Flur rannte, dicht gefolgt von Pendrake und Harte. Mit dem Problem befasst, das sie zu solcher Eile antrieb, standen sie einen Moment lang da und überlegten, was sie tun sollten. Dabei bemerkten sie nicht die kleine Gruppe, die am anderen Ende des Flurs stand – und selbst wenn, wäre ihnen so leicht nicht aufgefallen, dass es sich dabei um den Compass-Club handelte. Das Sonnenlicht, das durch die Bleiglasfenster in den Korridor fiel, tauchte die Gesichter der vier in so tiefe Schatten, dass sie nicht zu erkennen waren.
Barlough und seine Freunde drückten eine Klinke nach der anderen herunter, doch alle Türen waren verschlossen, hinter denen sie sich Erleichterung hätten verschaffen können. Pendrake und Harte konnten nicht einmal in ihre eigenen Zimmer zurückkehren. »Und jetzt?«, rief Harte den anderen zu, während er in unnatürlich verkrampfter Haltung dastand und sein Glück an einer weiteren Tür versuchte.
Pendrakes Eingeweide rumorten so erschreckend laut, dass die Mitglieder des Compass-Clubs zum ersten Mal breit grinsten, seit East am Morgen beraubt worden war. Ihre Geduld hatte sich bezahlt gemacht.
Barlough entdeckte sie als Erster, und sofort versuchte er, sich zumindest nicht ganz so würdelos zu präsentieren. Mit steifen Schritten und die Pobacken zusammengekniffen, kam er auf sie zu. »Du da!«, sagte er, als er sein Erstaunen überwunden hatte, dass East sich in den Privatgemächern der Bischöfe aufhielt. »Was hast du hier zu suchen?«
East lächelte ihn nur an.
Barlough schaute die anderen an. »Ihr da, ihr alle! Raus hier! Macht den Weg frei!«
»Ach ja?«, gab East zurück, während sich Pendrake und Harte zu Barlough stellten. »Und wohin führt dieser Weg?«
Harte stöhnte und hielt sich den Bauch. »Zum Wasserklosett«, brachte er mit Mühe heraus. »Es ist die letzte Tür links.«
»Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht.« Er ging zur Seite, und auch der Rest des Compass-Club gab den Weg frei.
Pendrake stürmte vorbei und griff nach der Klinke, doch die Tür bewegte sich nicht. Da sie kein Schloss besaß, konnte das nur eines bedeuten. »Die haben die Tür von drinnen verbarrikadiert!«, schrie er förmlich. »Wir kommen nicht rein!«
»Was wollt ihr?«, fauchte Barlough die Mitglieder des Compass-Clubs an. Ihm stand Schweiß auf der Stirn, so sehr strengte er sich an, seine Körperfunktionen unter Kontrolle zu halten. Sein wütender Blick galt vor allem Gabriel.
»Den Zoll, wenn ich bitten darf.«
Barlough biss die Zähne zusammen und zischte: »Wie viel?«
»Unterschreib das«, sagte Gabriel und hielt ihm einen Vertrag hin. »Möchtest du ihn lesen, oder soll ich ihn dir lieber vorlesen?«
Aus Angst, Gabriel könnte jedes Wort so langsam lesen, bis Barlough und die anderen sich vor Schmerzen am Boden krümmten, riss er ihm den Vertrag aus der Hand, wie er es nur Stunden zuvor mit dem Paket getan hatte. Das Paket … »Der Teekuchen«, flüsterte er, als er begriff, dass Gabriel sich das Paket hatte entreißen lassen wollen.
»Und die Biskuits«, ergänzte Gabriel hilfsbereit. Es war offensichtlich, dass Barlough nicht mehr lange durchhielt. »Und die Rosinenküchlein.«
»Du hast uns vergiftet.«
»O nein, überhaupt nicht. Was ihr habt, wird wieder vorübergehen.« Er sah zu Pendrake und Harte. »Das will ich jedenfalls hoffen. Ich habe darauf nämlich großen Wert gelegt.«
Harte stöhnte noch gequälter auf. Seine Knie knickten ein, dennoch konnte er verhindern, dass er zu Boden sank.
»Tu was, Barlough, sonst werde ich auf der Stelle explodieren!«
Barlough konnte noch klar genug denken, um seinem Freund zu glauben. Er meinte ja selbst, jeden Moment platzen zu müssen. Eine solche Demütigung würde für ihn das Ende an dieser Schule bedeuten. Damit wäre er der erste Erzbischof der Verbindung, der sie unehrenhaft verließ. Er überflog in aller Eile den Vertrag, den Gabriel mit viel Sorgfalt geschrieben hatte.
»Du erwartest aber nicht, dass ich mit Blut unterschreibe, oder?«, fragte er.
Gabriel grinste und stellte ihm Tintenfässchen und Federkiel auf die Fensterbank.
»Die Tür!«, fauchte Barlough ihn an, nachdem er seinen Namen hingekritzelt hatte. »Mach die verdammte Tür auf!«
»Das würde viel zu lange dauern«, erwiderte Gabriel. »Es gibt aber eine andere Lösung.«
Mit diesen Worten machten South und North das Fenster auf und zogen ein Seil nach oben, an dem drei Eimer hingen.
»Wie sonderbar, dass sie dort sind«, meinte Gabriel grinsend und faltete den Vertrag, um ihn einzustecken. »Nach denen hattet ihr bestimmt schon gesucht.«
Schallendes Gelächter ertönte, als die drei Mitglieder des Ordens der Bischöfe mit den Eimern in der Hand zurück in Barloughs Zimmer rannten, bevor sie tatsächlich noch mitten im Flur explodierten.
***
»Gute Arbeit«, sagte North später am Abend. »Du hast dir ein Lob verdient, East.«
West nickte und biss in ein Stück von der Kirschtorte, die nach dem Abendessen per Expresspost eingetroffen war. »Du hattest recht, dass dieser erpresserischen Bande das Handwerk gelegt werden musste. Das hast du gut gemacht.«
Viscount Southerton saß im Schneidersitz auf dem Boden und betrachtete die Auswahl an Nachspeisen im Weidenkorb vor ihm. »Darum ist er auch der Kesselflicker. East hat ein gutes Herz, und ihm liegt es im Blut, die Dinge wieder ins Lot zu bringen.«
East reichte den Korb weiter, nahm selbst aber nichts. »Kann schon sein«, erwiderte er, als er es allmählich zu akzeptieren begann. Aus der Jackentasche zog er den Vertrag, faltete ihn auseinander und legte ihn vor sich auf den Boden. Die anderen hielten den Kopf schief, um den Text noch einmal zu lesen.
Alle sollen es fortan wissen, dass der Orden der Bischöfe ab sofort auf den öffentlichen Flächen von Hambrick Hall keine Steuern, Zölle oder sonstigen Abgaben verlangen wird. Als öffentliche Fläche gellen alle Bereiche, die ohne besondere Einladung aufgesucht werden können. Der Orden der Bischöfe erklärt weiter, dass es weder sein Privileg, sein Recht noch seine Verantwortlichkeit ist, Geld, Waren oder Dienstleistungen zu fordern, um Zutritt zu einem Privatquartier zu erlangen, das nicht ausdrücklich vom Orden gemäß einem Abkommen mit Hambrick Hall kontrolliert wird.
»Der Orden hat kein Abkommen mit Hambrick«, sagte North mit vollem Mund. »Es ist ein geheimer Bund.«
»Es ist ein Bund der Geheimnisse«, entgegnete West. »Das ist ein großer Unterschied.«
Jeder von ihnen teilte diese Meinung. Ohne ein Abkommen mit Hambrick konnte der Orden keinen Teil der Schule als privaten Bereich reklamieren. Nicht einmal Yarrow House gehörte ihm wirklich. Es war eine von Gabriels besten Ideen gewesen, und Barlough hatte diese Formulierungen gar nicht verstanden, als er unterzeichnete.
Abschließend wird vereinbart, dass der Orden der Bischöfe für alle ihm überlassenen Gelder, Waren und Dienstleistungen innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung dieses Vertrags Wiedergutmachung leistet.
Gabriel ging zum Bücherregal und versteckte das Dokument in einem Band mit den Essays von William Paley, genauer gesagt: im Kapitel ›Prinzipien der Moral und der politischen Philosophien‹. Er hatte Paleys Buch noch nicht gelesen, doch er nahm sich vor, das bald nachzuholen.
Es war eines von den Dingen, mit denen sich ein Kesselflicker auskennen sollte.
Erstes Kapitel
Juni 1818, London
Sophie stellte sich vor, ihr Lachen hören zu können. Allein der Gedanke daran sorgte dafür, dass ihre Wangen rot wurden. So viel gute Laune zur Schau zu stellen, hatte etwas geradezu Respektloses an sich. Es war ein raues, spontanes Lachen, das fast immer Neid in ihr weckte, außer sie malte sich aus, dass es von ihr selbst ausging.
Ohne die Seite zu markieren, auf der sie aufgehört hatte, schloss sie ihr Tagebuch. Das Schreiben konnte heute nicht wie erhofft ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken, und Sophie hatte gelernt, dass sie besser damit aufhörte, wenn es nicht länger eine Erholung für sie war. Gedankenverloren strich sie die von ihr nachlässig auf dem Rasen ausgebreitete Decke glatt. Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch den Apfelbaum hinter ihr und bildeten Lichtflecken auf dem dunkelgrünen Ledereinband des Buchs.
Sie wandte den Blick ab und lehnte sich gegen den Baumstamm, dann schloss sie die Augen, was sie eigentlich tun wollte, seit sie in den Garten gekommen war. Eine dumme Gepflogenheit ließ sie glauben, sie solle hier draußen nicht schlafen. Wo sonst sollte sie für einige Minuten Ruhe und Erholung finden, wenn nicht in der Abgeschiedenheit dieser von Mauern umgebenen Zuflucht? Ihr eigenes Zimmer bot ihr das nicht, da die Kinder viel zu leicht eintreten konnten. Robert und Esme wurden ja sogar dazu angehalten, sich zuerst an Sophie zu wenden, ehe sie ihre Mutter mit ihren Anliegen behelligten. Es war Sophies Aufgabe, anschließend die Eltern über die Dinge zu informieren, die wirklich wichtig erschienen.
Heute mussten die Kinder in ihren Zimmern bleiben, nachdem es einen Zwischenfall mit einem Regiment Zinnsoldaten und der Haushälterin gegeben hatte, die die ganze Treppe heruntergefallen war. Natürlich war das Sophies Schuld, obwohl sie gar nicht zu Hause gewesen war, weil Lady Dunsmore sie für Migränepulver zur Apotheke geschickt hatte. Es hätte zu nichts geführt, die Lady darauf hinzuweisen, dass sie zu dem Zeitpunkt gar keine Migräne gehabt, sondern lediglich deren Ausbruch erwartet hatte.
Wie die Kinder wieder an die Zinnsoldaten gekommen waren, obwohl Sophie sie nach einem anderen Vorfall gut versteckt hatte, war gar nicht erst zur Sprache gekommen. Stattdessen hatte die Lady die Kinder auf ihre Zimmer geschickt und von einem Dienstboten den Arzt holen lassen. Nachdem sie dann Sophie die Verantwortung für alles vor die Füße geworfen hatte, hatte sie sich mit einer Migräne ins Schlafgemach zurückgezogen.
Dass die Kinder sich seit einiger Zeit darauf verlegt hatten, dem Dienstpersonal alle nur erdenklichen Streiche zu spielen, war nicht einmal allein deren Schuld. Natürlich ermutigte sie niemand dazu, aber es zeigte, dass Robert und Esme nicht immun waren gegen die wachsende Spannung in der No. 14 Bowden Street. Sie reagierten nur auf das, was sie von allen Seiten fühlten. Von einem zivilen Umgang zwischen den Erwachsenen des Hauses war nur noch wenig zu merken, und da wunderte es nicht, dass die Kinder sich auf ihre Weise entsprechend benahmen. Sophie wusste, die beiden wollten sie nicht vergraulen, sondern ihr zeigen, wie sehr sie sie brauchten – obgleich nur Sophie dieses Verhalten so nachsichtig auslegte. Für ihren Cousin Harold und dessen Frau war es lediglich ein Beweis mehr, dass sie eine jämmerliche Gouvernante war.
Harold wollte sie dazu bewegen, den Haushalt zu verlassen, doch so einfach war das nicht, schließlich konnte er wohl kaum seine dann obdachlose Cousine schutzlos wegschicken. Eine Vermählung war die logische Lösung für diese Situation, doch bis vor einer Woche hatte es nicht einmal einen Verehrer gegeben, um dergleichen überhaupt in Erwägung zu ziehen.
Das war nun anders geworden. Der Höchst Ehrenwerte Marquess of Eastlyn sollte Gerüchten zufolge eine überraschende Erklärung gemacht haben, wonach er Lady Sophia Colley als seine Zukünftige auserwählt habe.
Womit sie wieder bei dem Lachen war, das sie sich eingebildet hatte. Es war keine große Kunst, das jetzt zu wiederholen. Dass sie abermals errötete, lag nicht nur an dem Gelächter selbst. Sie wusste auch ohne jeden Zweifel, dass es ihr galt.
Es mussten wohl alle vier Freunde sein, überlegte sie. Wie sollte es auch anders sein? Es war zwar keineswegs so, dass sie getrennt voneinander nicht lachten oder sich nicht amüsiert gaben. Dennoch schien es, als sparten sie sich den größten Teil ihres Humors für die Zeit auf, wenn sie zusammensaßen und jeder von ihnen seine individuellen Beobachtungen über die Schwächen und Absurditäten der Gesellschaft zum Vergnügen der anderen zum Besten gab.
Sie selbst war zweifellos eine dieser Absurditäten. Der Marquess musste einen Lachkrampf bekommen haben, als er von diesen Gerüchten erfahren hatte. Oder einer seiner Freunde hatte sich köstlich darüber amüsiert auf seine Kosten. Hätte sie sich nicht schon selbst so leidgetan, wäre sie vielleicht in der Lage gewesen, Mitgefühl für den Marquess zu empfinden. Eastlyn hatte diese Behauptungen ganz bestimmt nicht in die Welt gesetzt, auch nicht zur Belustigung seiner Freunde. Es war ungerecht, ihm dieses ausgelassene Lachen zuzuschreiben, das ohnehin nur in ihrem Geist existierte.
Etwas huschte von ihrer Nasenspitze über ihre Wange, vielleicht eine Spinne, mit denen Robert sie immer zu ärgern versuchte. Sie war aber zu müde, die Augen zu öffnen, und so gab sie sich reflexartig einen Klaps auf die Wange, um das Ding zu erwischen.
Zwar verfehlte sie das Insekt, stattdessen jedoch hörte sie ein tiefes, kehliges Lachen, das sie innehalten ließ. Sie kannte dieses Lachen, sie konnte es immer heraushören, auch wenn er in das Gelächter seiner Freunde einstimmte.
Lady Sophia Colley blinzelte und sah nach oben – genau in das amüsierte Gesicht von Gabriel Whitney, dem achten Marquess of Eastlyn.
»Darf ich?« Er deutete auf die Decke, auf der Sophie saß. »Es ist ein recht schöner Tag, um ihn unter freiem Himmel im Herzen der Natur zu verbringen.«
Der Garten von No. 14 Bowden Street war ganz sicher nicht das Herz der Natur, doch das musste dem Marquess klar sein. Dachte er vielleicht, ihr sei das nicht bewusst? Hielt er sie in jeglicher Hinsicht für naiv? Sie richtete sich so weit auf, dass sie kniete, dann zog sie den Rocksaum nach unten, um ihre Knöchel zu bedecken. »Die Bank dort an der Mauer dürfte Ihnen wohl mehr behagen«, gab sie zurück.
East sah über die Schulter zu der massiven Steinbank. »Das glaube ich nicht. Ich finde, sie ist nicht im Mindesten bequem. Aber wenn Sie Ihre Decke nicht mit mir teilen möchten, werde ich mich im Gras niederlassen.«
Ehe Sophie etwas erwidern konnte, ließ sich der Marquess auf den Rasen sinken und nahm im Schneidersitz Platz, wobei er die Ellbogen auf seine Knie stützte.
»Bitte, M'lord«, sagte sie rasch. »Ihre Hose wird schmutzig werden.«
»Es ist gut von Ihnen, mich zu warnen, aber es ist ohne Bedeutung.«
»Sie werden Ihrem Kammerdiener gestatten, dass er diese Meinung nicht teilt.«
Lächelnd erwiderte er: »Da haben Sie natürlich recht.« Er setzte sich in der gleichen Weise zu ihr auf die Decke, dann zeigte er auf das Buch neben ihr. »Was lesen Sie?«
»Das ist mein Tagebuch.«
»Ein würdiges Unterfangen«, bemerkte er mit Blick auf Federkiel und Tintenfässchen an ihrer Seite. »Tiefschürfende Gedanken unter einem Apfelbaum sind durchaus zu empfehlen. Das sagt jedenfalls North.« Seine Baritonstimme wurde sanfter und nahm einen vertraulichen Tonfall an. »Ich glaube, er ließ sich von Sir Isaac Newtons Erfolg inspirieren.«
Sophies Blick wanderte in die Baumkrone. War es zu viel verlangt, wenn sie hoffte, ein Apfel würde dem Marquess auf den Kopf fallen? Oder zumindest auf ihren eigenen Kopf?
Eastlyn folgte ihrem Blick – und offenbar auch ihren Gedanken, als er wie beiläufig sagte: »Jetzt sind sie noch klein und grün, aber wenn Sie mich im Herbst wieder zu sich einladen, dann werden sie groß und von kräftigem Rot sein, und es ist nur ein Windhauch nötig, um sie herabfallen zu lassen. Ich kann Ihnen garantieren, einer von uns beiden wird dann am Kopf getroffen werden und damit allen verlegenen Momenten zwischen uns ein Ende setzen.«
Sophie gefiel es nicht, wenn man ihre Gedanken so leicht durchschaute. Andererseits hatte es etwas Tröstendes, dass er diese Begegnung auch als einen verlegenen Moment betrachtete. Sie drückte den Rücken wieder gegen die raue Borke des Apfelbaums und ließ die Beine zu einer Seite wegrutschen. Als sie sich bewegte, fielen ihr ein paar Strähnen ihres leicht gelockten, honigfarbenen Haars ins Gesicht.
Sie hob den Kopf und betrachtete eindringlich den Marquess.
»Ich hatte Ihren Besuch erwartet, Mylord.«
Er nickte, selbst nun auch ganz ernst. Wie typisch für Lady Sophia, dass sie ihre Karte als Erste ausspielte. Sie gab sich nicht schüchtern, wie es die meisten jungen Frauen in dieser Situation getan hätten, was sie in seiner Achtung umso mehr steigen ließ. Allerdings war sie auch nicht mehr ganz so jung, zumindest nicht nach jenen Maßstäben der Gesellschaft für das heiratsfähige Alter einer Frau. Sie mochte vielleicht dreiundzwanzig sein, was er als Erleichterung empfand. Wäre sie wesentlich jünger gewesen, hätte er viel behutsamer vorgehen müssen, um nicht einem Herzen wehzutun, das so dumm war, sich zu ihm hingezogen zu fühlen.
Lady Sophia war alles andere als dumm. Nach dem ersten kurzen Kennenlernen war es vermutlich das, was er an ihr am besten leiden konnte – vorausgesetzt, er nahm keine Notiz von diesen einzigartigen, fantastischen Augen, deren Farbe der ihrer Haare ebenbürtig war. Zutreffend wäre wohl die Bezeichnung Haselnussbraun gewesen, doch der Begriff an sich erschien ihm viel zu ausdruckslos, um dieses vielfältige Leuchten und Strahlen angemessen zu beschreiben, das aus Lady Sophias Innerstem kam.
Letzteres war auch der Grund, weshalb sie gar nicht zu ihm passte. Durch ihre allzu vollkommene Gemütsruhe besaß sie etwas Engelsgleiches. Das herzförmige Gesicht, die reizenden vollen Lippen, das kleine Kinn und die zierliche Nase, ihre großen, wunderschönen Augen und das sanft gelockte Haar, das wie der Heiligenschein einer Madonna ihr Gesicht umgab … Das war mehr Unschuld, als East bewältigen zu können glaubte. Prinzipiell begrüßte er Frauen, die Unschuld ausstrahlten, doch im Umgang mit ihnen empfand er diese Reinheit als strapaziös.
»Ich hörte die Gerüchte«, sagte sie. »Und Sie sollen wissen, mir ist klar, dass sie kein Körnchen Wahrheit enthalten, was ihre Quelle angeht. Mein Cousin gab zu, dass Sie keine Korrespondenz mit seinem Vater geführt hätten und es auch sonst kein Treffen gegeben habe, bei dem Sie um meine Hand hätten anhalten können. Der Earl würde sich zwar glücklich schätzen, könnte für mich eine solche Ehe arrangiert werden, aber wenn diese Gerüchte Sie in eine unangenehme Situation gebracht haben sollten, dann bitte ich Sie um Entschuldigung.«
Eastlyn legte die Stirn in Falten. »Sicherlich sind Sie nicht diejenige, die eine Entschuldigung aussprechen muss.«
»Nun, immerhin trage ich eine gewisse Mitschuld, M'lord, da ich den Gerüchten nicht widersprach.«
Er zupfte einen Grashalm ab und drehte ihn zwischen seinen schmalen Fingern, während er Lady Sophia nachdenklich betrachtete. »Dann hätten Sie also oft Gelegenheit dazu gehabt?«
»Ich … das heißt … ich «, stammelte Sophie, was für sie höchst ungewöhnlich war. Es gefiel ihr nicht, dass der Marquess eine solche Wirkung bei ihr auslöste. In der letzten Zeit beschränkten sich ihre Unterhaltungen auf Gespräche mit Robert und Esme, die mit ihren fünf beziehungsweise vier Jahren über einen recht beschränkten Wortschatz verfügten. Dennoch hatte sie nicht erwartet, die Fähigkeit zu verlernen, in ganzen Sätzen zu reden.
»Ich irre mich doch nicht, oder?«, fuhr East fort. »Sie verlassen nicht oft das Haus.«
Er war gnadenlos höflich, das musste Sophie ihm zugestehen. Entsprechend freundlich formulierte er die Tatsache, dass sie nur wenige Einladungen erhielt. »Ich verlasse es so oft, wie es nötig ist.«
»Ich verstehe.« Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. »Das Almack's?«
»Gelegentlich.«
»Das Theater?«
»Wenn es etwas Interessantes zu sehen gibt.«
»Der Park?«
»Wenn es jemand Interessanten zu sehen gibt.«
Er lachte. »Was nur bedeuten kann, dass Sie sich selten dort aufhalten.«
»Vielleicht«, konterte sie, »bin ich öfter in der Stadt unterwegs, als Sie für möglich halten, weil Sie davon lediglich nichts mitbekommen.«
Er wollte es abstreiten, doch sie hob die Hand, damit er schwieg. »Sie müssen sich mir gegenüber nicht galant geben, Mylord. Mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht die Sorte Frau bin, die Ihr Interesse weckt. Es wird Sie sicher beruhigen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie – abgesehen von unserem ersten Kennenlernen – nicht der Typ Mann sind, für den ich in den Park gehe, um ihn dort zu sehen.«
Es beruhigte ihn keineswegs, aber er fühlte sich auch nicht beleidigt. Und obwohl er dachte, er wolle ihre Erklärung gar nicht hören, war er in Wahrheit doch neugierig geworden. Als er am Morgen das Anwesen Battenburn verlassen hatte, war er davon ausgegangen, Lady SophiaSophie in Tränen aufgelöst zu erleben, sobald er die Gerüchte entkräftet hatte. Tatsächlich war sie den Tränen nicht einmal nahe, sondern völlig ruhig und gefasst. »Sie würden nicht in den Park gehen, wenn Sie wüssten, ich hielte mich dort auf?«, fragte er. »Nicht einmal, wenn ich in meinem neuen Landauer unterwegs wäre?«
»Sie müssen mir keine Enttäuschung vorspielen, Mylord. Es steht Ihnen nicht gut, denn Sie können nichts anderes als Erleichterung verspüren, dass ich Ihnen nicht zugetan bin.«
Er war auch erleichtert. Jedenfalls so lange, bis sie ihm diese Tatsache so unverblümt vor Augen führte. Das wiederum ließ ihn rätseln, ob sie zutreffend davon ausging, seine Enttäuschung sei nur gespielt. »Sie haben mich durchschaut«, sagte er schließlich. »Doch Sie wecken meine Neugier. Was habe ich an mir, dass ich nicht würdig bin, von Ihnen zur Kenntnis genommen zu werden?«
»O nein«, widersprach sie kopfschüttelnd. »Das verstehen Sie falsch. Es ist nicht so, dass Sie nicht würdig sind, vielmehr bewegen Sie sich außerhalb meiner Aufmerksamkeit.«
»Ich nehme an, das ist ein bedeutender Unterschied«, meinte er ironisch.
»Gewiss doch. Ich nehme sehr wohl Kenntnis von Ihnen. Ich will damit sagen, dass Sie meine Aufmerksamkeit nicht auf sich fixieren können.«
»Ihnen ist doch klar, dass das keinen Deut mitfühlender klingt. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal so direkt bis ins Mark getroffen wurde.« Eigentlich konnte er das sehr wohl, aber das war noch zu Zeiten von Hambrick Hall gewesen, und der Junge, der das getan hatte, war mit einem Fausthieb ins Gesicht belohnt worden. Natürlich konnte er bei Lady Sophia nicht auf die gleiche Weise reagieren, doch wenn ihre Worte so ins Ziel trafen wie ihre spitze Zunge, dann würde er am Ende noch mehr einstecken müssen.
Sophie suchte in seiner Miene nach einem Hinweis darauf, ob ihre Worte ihn verletzt hatten, doch sein edel geschnittenes Gesicht zeigte keine Regung. Nicht einmal ein Anflug von Belustigung war zu entdecken; trotzdem glaubte sie, dass er sie lediglich aufzog. Alles andere war völlig unvorstellbar, denn der Marquess of Eastlyn musste wissen, dass er unglaublich gut aussah. Selbst wenn er nicht über einen Spiegel verfügt hätte, wären die zahllosen anerkennenden Blicke und jedes freundliche Lächeln in seine Richtung Beweis genug dafür gewesen. Die Gesellschaft stand ihm sehr wohlwollend gegenüber, und daran würde sich wohl nichts ändern, selbst wenn er und seine Freunde immer wieder irgendwelchen Unsinn ausheckten.
Eigentlich hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Vater.
Dieser Gedanke, der ihr völlig überraschend durch den Kopf ging, traf Sophie wie ein Schlag ins Gesicht. Sie riss den Mund auf und atmete so erschrocken ein, dass sie fast keuchte.
»Fühlen Sie sich nicht wohl?«, fragte Eastlyn besorgt, als er sah, wie blass und noch ernster sie mit einem Mal geworden war. »Kann ich Ihnen etwas bringen? Ein Glas Wasser? Etwas Alkoholisches?«
Seine Hilfsbereitschaft zwang Sophie, sich zusammenzureißen, was ihr aber deutlich schwerer als erwartet fiel. »Mir geht es gut«, erklärte sie.
Skeptisch betrachtete er sie. »Sie sind sich da auch ganz sicher?«
»Ja.« Sie sah ihm zu, wie er sich durchs Haar strich. Es war offensichtlich, dass er ihre Antwort anzweifelte, dennoch blieb ihm keine andere Wahl, als ihren Worten Glauben zu schenken. Sie zwang sich, seinen ruhigen, forschenden Blick zu erwidern. Hoffentlich durchschaute er ihre Lüge nicht. Ganz bestimmt wollte er sich nicht mit der Wahrheit belasten, daher konnte es nur seine höfliche Art sein, die ihn diese echte Sorge um ihr Wohl zur Schau stellen ließ.
Sie dachte darüber nach, in welchen Punkten er sich von ihrem Vater unterschied, dem Earl of Tremont. Letzterer war blond gewesen und hatte helle Haut gehabt, während der Marquess einen dunkleren Teint besaß und Haare und Augen fast den gleichen kastanienfarbenen Ton aufwiesen. Sophies Vater hatte den Spielhöllen den Vorzug gegeben, Eastlyn dagegen wirkte wie jemand, der sich nicht nur in Clubs die Zeit vertrieb, sondern auch noch andere Interessen kannte. Eastlyn war in etwa so groß wie ihr Vater, dafür aber von einer deutlich athletischeren Gestalt. Sophie musste sich eingestehen, dass dieser Vergleich wohl ein wenig hinkte, da sie ihren Vater am besten aus der letzten Phase seines Lebens kannte, als der Alkohol ihn bereits gezeichnet hatte. Immerhin gab es da noch das Porträtgemälde in der Galerie von Tremont Park, das einen jungen Frederick Thomas Colley zeigte, der sich gar nicht so sehr von Eastlyn unterschied.
Über den Marquess wusste sie recht wenig, aber sie hätte die letzten drei Jahre im Ausland verbringen müssen, um gar nichts davon mitbekommen zu haben, was für ein Mann er war. Er spielte Karten und schloss oft mit seinen Freunden Wetten ab, er war Mitglied in verschiedenen Clubs, und im Theater war für ihn eine Loge reserviert. Im Almack's war er stets willkommen, obwohl er dort kaum hinging, außerdem wurde er zu allen gesellschaftlichen Ereignissen eingeladen, weil jede Gastgeberin ihn als ihren Gast sehen wollte. Die bekannten Fakten über sein Leben waren recht alltäglich, was auch für die Tatsache galt, dass er sich so wie viele seines Standes in der Stadt eine Geliebte hielt.
Sophie bezweifelte, dass sie Letzteres über ihn wissen sollte. Solche Dinge wurden nicht in der Anwesenheit der angeblichen Verlobten diskutiert. Aber auch wenn die Verlobung nur ein Hirngespinst war, hätte sie dennoch von der Existenz der Geliebten wissen wollen. Wenn ihr Ehemann regelmäßig Ehebruch begehen wollte, dann war das etwas, woran sie sich würde gewöhnen müssen, obwohl es ihr Schmerz bereiten würde. Sollte sie andererseits ihren Mann nicht lieben, dann schien eine Geliebte nützlich zu sein, konnte sich der Ehemann doch mit ihr beschäftigen, während die Ehefrau sich den Dingen widmete, die ihr Vergnügen schenkten.
Ein wenig irritiert musterte Eastlyn Lady Sophias vollkommene Gesichtszüge. Ihr Blick war so entrückt, dass sie seine Anwesenheit nicht länger wahrzunehmen schien. Es war so, wie sie zuvor gesagt hatte: Er war nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu fixieren.
Aber warum sollte es ihm etwas ausmachen, wenn Lady Sophia Colley nicht an ihm interessiert war? Etwas Besseres konnte ihm doch gar nicht widerfahren. Alles wurde viel einfacher dadurch, dass sie die Situation akzeptierte, ohne ihm die Schuld daran zu geben. Sie erwartete nicht von ihm, dass er ihr die Ehe anbot, und sie war offenbar nicht einmal an einer Scheinverlobung interessiert, um die Gerüchte verstummen zu lassen. Wäre dann der Punkt erreicht gewesen, sich in Würde aus der Affäre zurückzuziehen, hätte er natürlich darauf bestanden, dass sie ihm öffentlich die Schuld am Scheitern der Verlobung gab.
Doch all diese Überlegungen waren nun hinfällig. Eine Verlobung war für Sophia gar kein Thema, und Eastlyn blieben all jene langweiligen Verpflichtungen erspart, denen ein verlobtes Paar nachkommen musste. Umso mehr wunderte es ihn, als er sich fragen hörte: »Wissen Sie, Lady Sophia, in mancher Hinsicht gelte ich als ein gefragter Partner.«
Ohne mit der Wimper zu zucken, gab sie zurück: »Sie meinen beim Kartenspiel?«
»Beim Heiraten.«
»Aber Sie spielen Karten.«
»Nun … ähm, ja.« Eastlyn fragte sich ernsthaft, worauf sie hinauswollte, da ihre Bemerkungen in eine ganz andere Richtung zu gehen schienen als seine.
»Und Sie wetten.«
»Ja.«
»Sie trinken im Übermaß.«
»Es könnte sein, dass ich gleich damit anfange.«
Sie kniff die Lippen zusammen.
»Nun gut«, sagte East, der sich über ihre missbilligende Miene amüsierte, aber nicht völlig immun dagegen war. »Ich gebe zu, ich brause gelegentlich auf.«
»Sie haben Männer zum Duell herausgefordert?«
Er wurde ernst. »Einen Mann.«
Sophie ließ sich nicht anmerken, wie sie darüber dachte. »Sie haben auf ihn geschossen?«
»Ja.«
»Und ihn getötet?«
»Aus diesem Grund habe ich auf ihn geschossen, jawohl.«
Sie hielt kurz inne, weil sie sich über die Notwendigkeit ihrer nächsten Worte im Klaren sein wollte. Ihr wäre nie der Gedanke gekommen, je so etwas zu Eastlyn zu sagen, doch die Erinnerung an die Vergangenheit hatte sie zu tief getroffen. Vielleicht verdiente der Marquess es nicht, so zurechtgewiesen zu werden, aber es war, als zwinge eine fremde Macht Sophie dazu, diese Dinge zu sagen. »Also«, begann sie in sachlichem Tonfall, »geben Sie zu, ein Spieler, Trunkenbold und Mörder zu sein. Bei solchen Eigenschaften wundert es mich nicht, dass die Mütter der Gesellschaft Sie unbedingt mit ihren Töchtern verheiraten wollen. Diese Eigenschaften besitzen einen besonderen Reiz, nicht wahr? Spiellust bedeutet eine Bereitschaft, Risiken einzugehen, übermäßiger Alkoholgenuss ist ein Zeichen für Unbekümmertheit, und …«
»Und Mord?«, fiel er ihr ins Wort.
»Mord steht für die Entschlossenheit zum Handeln. In Ihrem speziellen Fall geht es um Prinzipien und darum, sie zu befolgen.«
Eastlyn gab vor, sich ihren Kommentar durch den Kopf gehen zu lassen. »Sie wollen also sagen, dass Mütter und ihre Töchter nicht meine Rechtschaffenheit und meine Vernunft, sondern das genaue Gegenteil schätzen?«
»Das, und die Tatsache, dass Sie reich wie Krösus sind.«
»Reicher.«
»Von mir aus auch das.«
Eastlyn wischte sich Gras und Erde von den Händen und lehnte sich nach hinten, bis er sich auf den Armen aufstützen und die Beine ausstrecken konnte. Seine Stiefel waren so wie seine übrige Kleidung durch den langen Ritt von Battenburn hierher von einer dünnen Staubschicht überzogen. Er hatte in seinem Stadthaus weder gebadet noch sich umgezogen, aber nicht etwa, weil Lady Sophia ihm das nicht wert gewesen wäre. Vielmehr war ihm daran gelegen, das Missverständnis schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen. Rückblickend musste er allerdings auch zugeben, dass es ihm dabei mehr um sich selbst als um Lady Sophias Gefühle gegangen war.
Es gab keinen Zweifel, Lady Sophia fühlte sich aus irgendeinem unerklärlichen Grund vor den Kopf gestoßen. Womöglich legte sie mehr Wert auf das Erscheinungsbild, als er erwartet hatte. Wenn dem so war, sprach es nur gegen sie, da seiner Meinung nach oftmals viel zu viel Aufhebens um das Erscheinungsbild gemacht wurde, anstatt nach den inneren Werten zu urteilen.
»Ich muss mich wohl für meine nachlässige Kleidung entschuldigen«, sagte er. »Ich kam direkt von Battenburn her.«
Sophie sah ihn verdutzt an, da sie Mühe hatte, seinen Gedankensprüngen zu folgen. »Mylord«, gab sie langsam und sehr betont zurück, als rede sie mit einem Begriffsstutzigen. »Es kann Ihnen nicht entgangen sein, dass ich Sie gerade eben als Spieler, Trunkenbold und Mörder bezeichnet habe. Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie jetzt glauben, ich würde mich auch nur einen Deut um Ihre Kleidung kümmern?«
Eastlyn seufzte leise und wünschte sich, er hätte diese Bemerkung nie gemacht. »Sie sind keine ruhevolle Gesprächspartnerin, Lady Sophia.«
»Das will ich auch nicht hoffen.«
»Ich hatte etwas ganz anderes erwartet«, sagte er. »Darüber sprach ich sogar noch mit South und Northam.«
»Sie sprachen mit Ihren Freunden über mich?«
Offenbar war er soeben ins nächste Fettnäpfchen getreten. »Natürlich. Ich spreche mit meinen Freunden über viele Dinge, und da stellen Sie keine Ausnahme dar. Schließlich waren es ja auch meine Freunde, die mich auf meine Verlobung aufmerksam machten, von der ich selbst gar nichts wusste. Es ist eine bemerkenswerte Erfahrung, zu etwas beglückwünscht zu werden, von dem man überhaupt nichts weiß.«
Sophie nickte langsam. Ihr war es nicht viel anders ergangen. »Mir war nicht bewusst, dass sich das Gerücht so weit verbreitet hatte.«
»Von der Stadt aufs Land«, meinte er mit einer gleichgültigen Geste. »Das ist der übliche Weg. Und da so viele Feiern zum dritten Jahrestag von Napoleons Niederlage bei Waterloo stattfanden, breitete sich das Gerücht unweigerlich aus wie die Pest.«
»Eine unschöne Metapher.«
»Aber eine zutreffende.«
Das konnte Sophie nicht abstreiten. »Aber Sie sagten ihnen, dass Sie nicht verlobt sind?«
»Selbstverständlich.«
»Hat man Ihnen geglaubt?«
»Das will ich hoffen.«
»Dann waren es nicht Ihre Freunde, die die Behauptung in die Welt gesetzt hatten, wir seien verlobt?«
Eastlyn warf ihr einen durchdringenden Blick zu. »Dachten Sie das etwa?«
»Mir war der Gedanke gekommen.« Sie hielt inne und wartete. Geduld war stets ihre große Stärke gewesen, doch der Marquess brachte sie mit seinem beharrlichen Schweigen bis an die Grenzen eben dieser Geduld. »Glauben Sie den Beteuerungen Ihrer Freunde?«, fragte sie, als sie es nicht länger aushielt.
»Sie vermuten, dass ich sie gefragt habe, ob sie das Gerücht in die Welt gesetzt haben. Das ist aber nicht der Fall. Ich meine sie gut genug zu kennen, um zu wissen, es geht nicht auf sie zurück – ob Sie es glauben oder nicht.«
»Ich glaube es.«
Verwundert zog er die Brauen hoch. »Wieso das? Haben Sie etwa Ihre Meinung über mich geändert? Bin ich nun kein Spieler, Trunkenbold und Mörder mehr?«
»Damit hat das nichts zu tun. Es ist lediglich so, dass ich mir nicht vorstellen kann, Sie könnten die Unwahrheit sagen. Hätte ich mich mit dem Gedanken getragen, wäre er schnell widerlegt worden, da Sie meine Fragen so direkt beantwortet haben.«
Wieder stöhnte er leise auf, weil er der Logik ihrer Denkweise nicht mehr so ganz folgen konnte, aber auch nicht so recht wusste, ob er das überhaupt wollte. »Sie sagen, es mache mich zu einem ehrlichen Mann, weil ich ohne Umschweife meine Charakterschwächen eingeräumt habe?«
»Ja.«
Lange und nachdenklich sah er sie an. »Sie sind ein wirklich perverses Geschöpf, Lady Sophia. Erwähnte ich das bereits?«
»Ich glaube, Sie sprachen gewissermaßen davon, ich sei keine geruhsame Person. Von Perversion war keine Rede gewesen.«
Er lächelte schief. Lady Sophia machte sich einen Spaß mit ihm, und den Marquess störte es nicht. Dennoch war da immer noch die Behauptung einer angeblichen Verlobung aus der Welt zu schaffen und sicherzustellen, dass sich das Gerücht für sie nicht zum Skandal entwickelte. Eastlyn beugte sich vor und stand auf, dann hielt er ihr seine Hand hin, die sie überrascht betrachtete. »Ein Spaziergang, wenn Sie einverstanden sind«, sagte er. »Nach einem so langen Ritt kann das meinem Gehirn nur gut tun, um klarer zu denken.«
»Es ist nur ein kleiner Garten, M'lord«, erklärte sie.
»Das macht nichts, ich habe ja auch nur ein kleines Gehirn.«
Sophie ließ sich von ihm aufhelfen und hakte sich bei ihm unter, auch wenn sie wusste, dass sie vom Haus aus beobachtet wurden. Eastlyn war sich dieser Beobachtung ebenfalls bewusst, doch die erfolgte nicht zu dem Zweck, unziemliches Verhalten zu vereiteln. Vielmehr war das Gegenteil der Fall. Im Haus hoffte man sogar inständig, dass sich die Dinge in eine höchst unanständige Richtung entwickelten, damit Sophie gezwungen werden konnte, ihre Meinung zur Ehe zu ändern.
Eastlyn und Lady Sophia betraten den schmalen, mit kleinen Steinen bedeckten Weg, der sich durch den Garten zog. Für einen Moment waren ihre Gesichter in Schatten getaucht.
»Sie werden es sagen, nicht wahr?«, fragte sie, als sie merkte, wie er langsamer wurde.
»Ich muss es sagen.«
»Es ist nicht notwendig.«
»Das glaube ich doch.« Während seiner Rückkehr nach London hatte er lange darüber nachgedacht, ohne jedoch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Als er sich zum letzten Mal damit befasst hatte, war er zu einer Meinung gelangt, die das genaue Gegenteil seiner jetzigen Position darstellte. Er fand es interessant, dass Lady Sophia vehement dagegen war, doch er wollte nicht erfahren, warum sie so dachte oder wie sie zu dieser Einstellung gelangt war. Davon würde er nur Kopfschmerzen bekommen.
Sophie atmete tief durch und sagte ruhig und gelassen: »Dann sprechen Sie es schnell aus. Anschließend werde ich uns eine Erfrischung kommen lassen, damit Sie den Geschmack herunterspülen können.«
Er blieb stehen und drehte sie zu sich, dann griff er nach ihren Händen und schüttelte sie leicht. »Sie müssen mich ansehen, Sophia. Wie wollen Sie sonst den Wahrheitsgehalt meiner Worte beurteilen?«
Sie hob das Kinn und sah ihn an. Er war einen ganzen Kopf größer als sie, und seine Schultern waren um die Hälfte breiter als die ihren. Es wäre ein Leichtes, für immer in seinen Armen zu bleiben, doch ihr wollte nicht ein einziger rechtschaffener Grund einfallen, warum sie das tun sollte. »Machen Sie schon«, forderte sie ihn auf. »Jetzt. Bringen wir es hinter uns.«
Dass sie es ihm nicht leicht machte, stand außer Zweifel. Und es war auch genau diese Taktik, die sie verfolgt hatte, um eben diesen Ausgang zu vermeiden. Es war von Anfang an ihre Strategie gewesen, wie ihm nun klar wurde, als hätte sie gewusst, dass er in die Abgeschiedenheit ihres Gartens eingedrungen war, um diese Worte auszusprechen. Wie eigenartig, dass sie geglaubt hatte, er werde diese ehrbare Geste machen, wenn er selbst doch bis zuletzt im Zweifel gewesen war.
Eastlyn konnte eben ein Räuspern verhindern, das diesen Moment völlig unnötig noch bedeutender hätte erscheinen lassen. »Lady Sophia, es ist mein dringlichster Wunsch, dass Sie mich davon lossprechen, anmaßend zu sein. Obwohl wir uns erst seit Kurzem kennen und ich nicht geglaubt hatte, wir könnten zusammenpassen, ist für mich der heutige Nachmittag Grund genug, meine Meinung zu ändern. Ich bin davon überzeugt, dass Sie mich zum glücklichsten Mann auf Erden machen werden, wenn Sie mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden.«
Sophie sah ihn nur an, ohne ein Wort herauszubringen.
Eastlyn wartete ab, während sich auf seiner Oberlippe ein dünner Film aus Schweißperlen bildete.
Sophie zog eine perfekt geformte Augenbraue hoch, schwieg aber weiter.
Obwohl er beileibe kein Feigling war, begann der Marquess allmählich zu befürchten, seine Beine könnten unter ihm wegknicken.
Schließlich sagte sie: »Ich werde mich um die Erfrischungen kümmern, Mylord. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden.« Mit diesen Worten wandte sie sich um und ging zum Hintereingang des Hauses. Auf halber Strecke hörte sie ihn rufen.
»Das ist keine Antwort! Ich möchte Ihre Antwort hören.«
Einen Augenblick lang blieb sie stehen, drehte sich aber nicht zu ihm um, sodass er nicht ihr trauriges, unsicheres Lächeln sehen konnte.
***
Harold Colley, der Viscount Dunsmore, trat in den Korridor, als er Sophie ins Haus kommen hörte. Dass er sie damit erschreckte, kümmerte ihn nicht, vielmehr kam er sofort auf den Punkt. »Und?«, fragte er. »Ist es vollbracht? Hat er sich geäußert? Ihr beide saht ja ziemlich vertraut aus.«
»Du hast uns beobachtet.« Es war keine Frage, sondern eine Feststellung, die von Enttäuschung geprägt war. Dass er ihr Treffen mit Eastlyn mitverfolgen würde, war ihr klar gewesen, doch dass er es auch noch so unumwunden zugab, zeigte nur, wie schamlos dieser Mann war.
»Natürlich. Du lebst in meinem Haus, und ich bin für dich verantwortlich. Wie soll ich sonst wissen, ob er sich anständig verhält?«
»Dann hast du ja gesehen, dass er ein wahrer Gentleman war.« Sie wollte nach unten in die Küche gehen, aber ihr Cousin packte sie am Ellbogen. Anstatt sich aus diesem Griff zu winden, sah sie Harold in die Augen und trotzte seinem verkniffenen, missbilligenden Blick, bis er losließ. Sie würde noch über Tage hinweg sehen können, wo er seine Finger in ihr Fleisch gedrückt hatte. Trotz der sommerlichen Temperaturen waren vorläufig lange Ärmel vonnöten. »Ich habe unserem Gast eine Erfrischung versprochen«, sagte sie.
»Ich mag es nicht, mein Temperament zu verlieren«, warnte er sie. »Du tust gut daran, mich nicht zu provozieren, Sophia.«
Bislang hatte sie keine Reaktion gefunden, die in derartigen Augenblicken wirklich zufriedenstellend sein konnte. Zu sehr ärgerte sich Harold darüber, dass sein Temperament mit ihm durchging, sah er sich doch als einen vernünftigen, überlegt handelnden Mann. Wenn er eine wohl durchdachte Entscheidung traf, dann hielt er sie für so vernünftig, dass er glaubte, jeder müsse sich ihr anschließen, um den eigenen gesunden Menschenverstand unter Beweis zu stellen.
»Verzeih mir bitte«, erwiderte sie und senkte den Blick. Seit sie nach dem Tod ihres Vaters vor drei Jahren bei Harold und dessen Familie eingezogen war, hatte Lady Sophia gelernt, dass ein gewisses Maß an Schuldbewusstsein nötig war, um wieder Frieden herzustellen. Meistens fiel ihr das auch nicht schwer, weil so wenig dabei auf dem Spiel stand. Es machte ihr nichts aus, sich bei ihm zu entschuldigen, um ihn zu besänftigen, selbst wenn sie sich damit völlig zu Unrecht schuldig bekannte. »Es ist nur so, dass du mich erschreckt hast.«
Mit einem Brummlaut nahm Harold ihre Entschuldigung an. Er war ein eleganter, aber ziemlich schmächtiger Mann, der sich immer recht steif und förmlich bewegte, als könne er damit wettmachen, was ihm an beeindruckender Statur mangelte. »Ich würde jetzt gern eine Antwort hören«, sagte er.
»Mylord Eastlyn würde das auch gern.«
Harold glaubte, einen Anflug von Unverfrorenheit aus ihrer Stimme herauszuhören, ließ es jedoch auf sich beruhen. Erst letzten Monat hatte er seinem Vater gegenüber noch erklärt, sie sei eine sehr vernünftige Frau, vielleicht sogar vernünftiger als die meisten anderen Vertreterinnen ihres Geschlechts. Umso mehr ärgerte er sich nun über ihren Widerwillen, was das Werben des Marquess um ihre Gunst anging. Immerhin war ihre Verweigerung nicht bloß ein Affront gegen seine Gefühle, sondern sie ließ ihn auch wie einen schlechten Menschenkenner dastehen.
Er führte sie in den rückwärtigen Salon, von wo aus er sie und Eastlyn beobachtet hatte, dann läutete er nach einem Dienstboten, damit er Zitronenlimonade für sie und ihren Gast brachte. Kaum waren sie wieder allein, fragte Harold: »Was genau hat der Marquess gesagt?«
»Er sagte, er meine es ernst und ich würde ihn zum glücklichsten Mann auf Erden machen, wenn ich seine Frau würde. Das ist doch die übliche Formulierung, nicht wahr? Es ist fast das Gleiche, was Lord Edymon zu mir sagte. Und Humphrey Bell ebenfalls. Lernen Männer diese Sätze in Eton und Harrow?«
Harold reagierte in keiner Weise amüsiert auf ihren unpassenden Versuch, witzig zu sein. »Ich wusste nicht, dass schon andere Männer um deine Hand angehalten haben, Sophie. Das hast du nie erwähnt.« Andernfalls wäre er wohl auf diese kleine Meuterei von ihrer Seite besser vorbereitet gewesen.
»Edymon kam zu mir, bevor Vater starb«, antwortete sie, während ihr klar wurde, dass sich Harold vermutlich abermals vor den Kopf gestoßen fühlen musste, denn vermutlich hatte er auf die gleiche fantasielose Weise um Abigails Hand angehalten. »Allerdings vermute ich, er wusste, dass nicht mehr viel Zeit blieb. Mr Bell wandte sich nach Vaters Tod an mich, als noch nicht sicher war, wohin ich gehen würde.« Ein Dienstmädchen kam mit einem Tablett zu ihnen, darauf standen Gläser und eine Karaffe Limonade, und wurde in den Garten zu Eastlyn vorgeschickt.
Sophie wollte ihr folgen. »Ich muss jetzt zurück in den Garten«, sagte sie zu Harold, der so stand, dass er ihr den Weg nach draußen versperrte. »Bitte, Harold. Du kannst nicht erwarten, dass ich zuerst dir sage, was ich ihm antworten werde.« Tatsächlich hatte sie ihm schon ein Dutzend Mal oder mehr gesagt, wie sie reagieren würde. Ihr Cousin wollte bloß nicht einsehen, dass er sie nicht umstimmen konnte.
Gerade wollte er zu einer Erwiderung ansetzen, da gelang es ihr, an ihm vorbei das Zimmer zu verlassen. Sie war bereits im Korridor, als er begriff, was sie da eigentlich tat, und als er zu fluchen anfing, zog sie die Tür in den Garten auf und eilte aus dem Haus; erst dann wurden ihre Schritte langsamer.
Obwohl sie sich innerlich wieder beruhigt hatte, als sie Eastlyn erreichte, waren ihre Wangen noch gerötet. Mit etwas Glück würde er glauben, ihre Begierde, zu ihm zurückzukehren, habe ihr die Farbe ins Gesicht steigen lassen, nicht aber ihr Cousin mit einem weiteren Versuch, sie einzuschüchtern. Harolds Verhalten löste bei ihr weder Angst noch Zorn aus, es war ihr vor allem peinlich.
»Mylord«, sagte sie rasch zu Eastlyn, als der sich erhob. »Bleiben Sie doch bitte sitzen.« Sie sah, er hielt ein Glas Limonade in der Hand, das zweite Glas und die Karaffe standen auf der Bank, auf der er Platz genommen hatte. »Ist die Erfrischung nach Ihrem Geschmack?«
»Wenn Sie damit meinen, ob sie den Geschmack meines Heiratsantrags weggespült hat«, entgegnete er, »dann muss ich Sie enttäuschen. Ich denke, dafür ist etwas Hochprozentiges notwendig, das zwanzig oder mehr Jahre in einem Eichenfass gelagert wurde.«
Sophie staunte über den absolut trockenen Humor in seinem Tonfall. »Meine Bemerkung hat Sie getroffen, nicht wahr?«, fragte sie ruhig. Einen Mundwinkel umspielte der Hauch eines Lächelns. »Ich kann mich nicht einmal dafür entschuldigen, weil es ja meine Absicht war, Sie zu treffen.«
»Daran habe ich nie gezweifelt.«
Langsam ließ sich Sophie auf die Bank sinken und schenkte sich ebenfalls ein Glas ein. »Ich wollte nicht, dass Sie mir diesen Antrag machen.«
»Daran haben Sie auch keinen Zweifel gelassen.«
»Und doch sahen Sie nicht davon ab.«
»Es war eine Frage der Ehre.«
Sophie wusste nicht recht, warum er so dachte, doch sie fragte auch nicht nach. Stattdessen umfasste sie mit beiden Händen das Glas und atmete einmal tief durch. »Haben Sie sich wirklich die Konsequenzen vor Augen geführt, Mylord, die Ihr Antrag nach sich zieht, sollte ich ihn annehmen?«