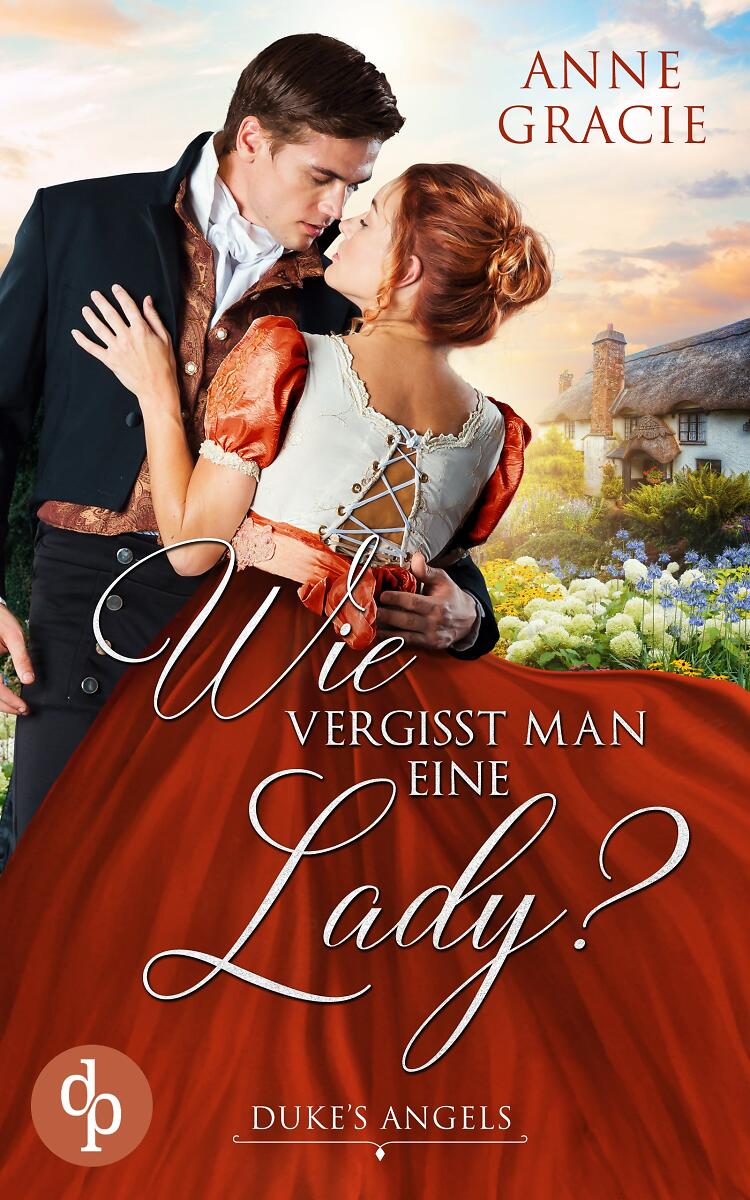Prolog
Bath, England 1819
„Ich soll eine geeignete Braut für dich finden?“ Lady Gosforth, Tante des ehrenwerten Nash Renfrew, musterte ihren Neffen mit strengem Blick durch ihr Lorgnon, das ihre Augen stark vergrößerte. Sie benutzte es gern, um ihr Gegenüber einzuschüchtern.
Bei Nash allerdings verfehlte diese Taktik ihre Wirkung. „Wenn du die Güte hättest, Tante Maude.“
Sie gab einen pikierten Laut von sich. „Ausgehend von den Gerüchten, die mir zu Ohren kamen, vermute ich, dass es dir nicht schwerfällt, Frauenbekanntschaften zu schließen, nicht einmal in St. Petersburg.“
Nash zuckte nicht einmal mit der Wimper. Woher zum Teufel wusste sie von seinem Leben in St. Petersburg, da sie doch vorwiegend in Bath residierte? Zugegeben, ihre gesellschaftlichen Kontakte waren legendär. Deshalb bat er sie ja auch um ihre Unterstützung.
„Das ist etwas anderes“, entgegnete er und winkte ab.
„Natürlich.“ Seine Tante seufzte enerviert. „Und du bittest mich überdies, einen Ball innerhalb von vier Wochen zu arrangieren? Ausgerechnet jetzt zu Beginn der Saison?“
„Wenn dir das nicht zu viel Mühe macht, liebe Tante.“
„Zu viel Mühe? Natürlich macht mir das erhebliche Mühe! Ich bin zu alt, um noch große Feste auszurichten.“ Sie setzte eine Leidensmiene auf.
„Tut mir leid, Tante Maude. Das habe ich nicht bedacht, denn du siehst so blühend und jung aus … Lass es gut sein, ich engagiere jemanden …“
„Jemanden engagieren? Ein gesellschaftliches Ereignis von Fremden organisieren lassen? Kommt nicht infrage!“ Dieser Gedanke versetzte sie in helle Empörung. „Das wäre im höchsten Maße vulgär. Ich versuche, irgendwie die Kraft aufzubringen, etwas zu arrangieren.“ Sie seufzte. „Und dir auch ein passendes Mädchen zu finden. Aber ich warne dich, Nash, in dieser kurzen Zeit, knapp vor der Saison, da alle Einladungen bereits ausgesprochen sind, kann es nichts anderes als eine bescheidene und belanglose Angelegenheit werden.“
„Ich weiß und es tut mir leid, dich damit zu behelligen.“ Nash war keineswegs beunruhigt, vielmehr war er davon überzeugt, dass sie nichts versäumen würde, um ein glanzvolles Fest auf die Beine zu stellen. Beiläufig fügte er hinzu: „Darf ich dich bitten, auch eine Einladung an die Tante des russischen Zaren zu senden, die Großfürstin Anna Petrowna Romanowa?“
Sie ließ das Lorgnon sinken. „Die Tante des russischen Zaren?“
„Sie reist wenige Tage vor dem Ball an. Und da sie in London keine gesellschaftlichen Kontakte hat, habe ich ihr meine Hilfe zugesichert. Sie wird keine Einwände gegen ein bescheidenes Fest haben.“ Die Großfürstin pflegte in Moskau ein ebenso reges Gesellschaftsleben wie seine Tante in England und liebte prunkvolle Feste.
„Eine Großfürstin?“ Tante Maude straffte die Schultern, ihre Augen glänzten vor Ehrgeiz. Und dann entrang sich ihr wieder ein tiefer Seufzer. „Du treibst mich noch an den Rand der Verzweiflung, mein Junge.“
„Ich weiß“, pflichtete er ihr mit zerknirschter Miene bei. Mit einer russischen Großfürstin als Ehrengast versprach der Ball das Ereignis der Saison zu werden und das wusste seine Tante.
Nash hatte aus zwei Gründen darum ersucht, nach England zurückzukehren: erstens, um ein Erbe anzutreten und zweitens, um eine Braut zu finden. Der britische Konsul, der um die Launenhaftigkeit der Großfürstin wusste, hatte seine Zustimmung unter der Bedingung erteilt, dass Nash die alte Dame in London unter seine Fittiche nahm.
Nash habe die Gabe, hatte der Botschafter gemeint, mit herrischen und launenhaften älteren Damen umzugehen. Und Nash hatte erwidert, er habe sein ganzes Leben mit herrischen und launenhaften Tanten und Großtanten zu tun gehabt. Eine davon beäugte ihn nun streng mit stechendem Blick durch ihr Lorgnon.
„Abgesehen von dem Ball für eine Großfürstin soll ich auch noch eine Ehefrau für dich aus dem Ärmel schütteln, wie?“
„Nicht irgendeine Ehefrau, sondern die Richtige. Sie sollte eine exzellente Partie sein.“
Sie zog eine sorgsam gezupfte Braue hoch. „Natürlich, du bist schließlich ein Renfrew. In unserer Familie ist nichts anderes denkbar. Aber was, bitteschön, ist deine Definition einer exzellenten Partie?“
Darüber hatte Nash eingehend nachgedacht.
Abgesehen von bestem familiären Hintergrund, hervorragender Bildung und Intelligenz, sollte seine Zukünftige auch glänzende gesellschaftliche Beziehungen vorweisen. Sie sollte einiges Wissen über politische Zusammenhänge haben, sich allerdings mit ihrer eigenen Meinung zurückhalten. Sie sollte versiert darin sein, große gesellschaftliche Anlässe zu organisieren und über ein gewisses Maß an Charme verfügen. In erster Linie sollte sie diskret sein, Gesellschaftsklatsch meiden und Toleranz zeigen für das extravagante Verhalten ihres Gemahls.
Was die Nachkommenschaft betraf, so brauchte er keine Erben, Kinder waren nicht seine Sache. Wenn seine Gemahlin sich ein Kind wünschte, hätte er allerdings keine Einwände dagegen.
„Und vermutlich erwartest du von dieser Traumfrau auch Schönheit und Vermögen“, sagte Tante Maude sarkastisch, nachdem er mit seiner Wunschliste geendet hatte.
Nash schenkte ihr sein strahlendstes Lächeln. „Das wäre ganz reizend, beste aller Tanten.“
Sie wurde sichtlich versöhnlicher. „Pah! Jüngere Söhne!“ Sie beäugte ihn wieder mit ihrem scharfen Vogelblick, den all ihre Neffen nur zu gut kannten. „An einer Liebesheirat bist du wohl nicht interessiert, wie?“
Nash furchte irritiert die Stirn. „Eine Liebesheirat?“
„Deine Brüder haben aus Liebe geheiratet und sind beide sehr glücklich.“
„Gabriel und Harry wuchsen nicht in Alverleigh auf und waren nicht täglich den Eifersuchtsszenen unserer Eltern ausgesetzt“, entgegnete Nash. „Andernfalls wären beide noch Junggesellen wie Marcus und ich.“
„Gabriel und Harry wurden von eurer unverheirateten Großtante großgezogen, in deren Leben Männer den Rang hinter Pferden und Hunden einnahmen, eigentlich schätzte sie Männer kaum mehr als Küchenschaben“, erklärte seine Tante in liebenswürdigem Ton. „Auf die Renfrew-Männer hielt sie allerdings große Stücke, was einen gewissen Ausgleich schaffte.“
Nash hob die Achseln. „Ich will damit nur sagen, dass meine Brüder nicht erlebt haben, wie zerstörerisch eine Liebesheirat sein kann. Ich stelle mir eine sorgfältig geplante Vernunftehe vor, die auf gemeinsamen Zielen basiert.“
Lady Gosforth stieß einen verächtlichen Laut aus. „Eine blutleere Beziehung.“
Er nickte begeistert. „Ja, genau so soll es sein.“
„Aber ein Leben ohne Liebe, ohne Leidenschaft …“
„Liebe?“, fiel Nash ihr ins Wort. „Für meine Eltern war die Ehe ein Kriegsschauplatz der Leidenschaft. Wenn sie sich nicht gegenseitig mit ihren eifersüchtigen Streitigkeiten in den Haaren lagen und damit der ganzen Familie auf die Nerven gingen, hingen sie aneinander wie die Kletten.“ Nash schüttelte sich angewidert. „Ich würde lieber in … in einem Eiskeller leben.“
„Du irrst, mein Junge, aber ich versuche nicht, deine Meinung zu ändern. Du hast schließlich den legendären Dickschädel aller Renfrew-Männer. Gut, ich finde dir deine Traumfrau, aber gib mir nicht die Schuld daran, wenn du nach sechs Monaten Ehe vor Langeweile eingehst wie eine Primel.“
„Man heiratet nicht zum Vergnügen“, meinte er mit Nachdruck.
Wehmütig sah sie ihn an. „Ach Junge, die Ehe sollte ein romantisches Abenteuer sein.“
„Mein Beruf vereint alle Abenteuer, von denen ich je geträumt habe. Aber wenn du meinst, vielleicht strebe ich genau das an, was du eine schlechte Ehe nennst.“
„Über diese Dinge scherzt man nicht!“, wies sie ihn zurecht. „Niemals!“
1. Kapitel
Auf der Hügelkuppe zeichnete sich der dunkle Umriss eines Reiters gegen den bleigrau verhangenen Himmel ab. Der Reiter verharrte kurz, schien sich zu orientieren, bevor er den Hang im verhaltenen Trab hinunterritt. Hinter ihm zerrissen grelle Blitze die düstere Wolkendecke.
„Ein apokalyptischer Reiter“, bemerkte Maddy Woodford auf der Türschwelle ihres Cottages. „Wer immer er sein mag, er versteht es, sich in Szene zu setzen.“
Lizzie Brown folgte ihrem Blick. „Ein Gentleman“, verkündete sie und knöpfte ihren Mantel zu.
Maddy lachte. „Wie willst du das wissen? Bauern und Kaufleute haben auch Pferde. Kennst du ihn etwa?“
Lizzie schmunzelte kopfschüttelnd. „Den hab ich noch nie gesehen. Aber er reitet querfeldein über Privatbesitz.“ Sie zuckte mit den Achseln und verdrehte die Augen. „So etwas erlaubt sich nur ein Gentleman. Einfache Leute wagen sich nicht unbefugt auf fremdes Land. Unsereins kommt wegen geringerer Vergehen ins Gefängnis.“
„Anzunehmen.“
„Der will vermutlich nach Fonthill oder Whitethorn Manor.“ Verschmitzt fügte Lizzie hinzu: „Vielleicht reitet er an Ihrem Cottage vorbei. Sie könnten ihm den Weg versperren, Miss. Ein Gentleman würde anhalten. Wer weiß, vielleicht angeln Sie sich einen reichen Ehemann.“
Maddy schnaubte verächtlich. „Bei meinem Glück würde er mich mit Sicherheit über den Haufen reiten und ich …“
„Und Sie liegen im Dreck!“, beendete Lizzie den Gedanken und beide lachten. „Nein, er würde mit Sicherheit anhalten, so hübsch, wie Sie heute aussehen mit Ihrer neuen Frisur.“ Lizzie betrachtete prüfend Maddys Haar. „Das habe ich ziemlich gut hingekriegt, finde ich.“
Vorsichtig strich Maddy über ihren frisch frisierten Kopf. Lizzie erprobte ihr Geschick als Friseuse gern an ihr. „Das hast du sogar sehr gut gemacht, Lizzie. Du wirst bald eine gute Zofe sein.“
„Das hoffe ich, Miss Maddy. Ich habe es satt, immer nur Kühe zu melken. Und Sie werden bald die wunderbare Ehefrau eines Gentleman sein, das hoffe ich auch.“
„So lange keiner weiß, dass ich keinen roten Heller besitze.“ Maddy lachte. „Im Übrigen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den Wunsch habe, zu heiraten.“
Lizzies Lachen erstarb. „Sie haben ganz recht.“
Maddy machte ein schuldbewusstes Gesicht. „Oh Lizzie, verzeih. Ich wollte nicht …“ Sie hatte gedankenlos drauflosgeplappert. Lizzie war gerade mal vier Monate verheiratet gewesen, als ihr Ehemann mit allen Ersparnissen in die Stadt gefahren und nie wieder aufgetaucht war.
Lizzie band sich ihr Kopftuch um und sagte bitter: „Sei‘s drum. Mit der Ehe kauft man eben die Katze im Sack. Bei Männern weiß man erst, woran man ist, wenn es zu spät ist. Aber wenn man reich ist, sind die Sorgen leichter zu ertragen.“
Maddy nickte, obgleich sie anderer Meinung war. Reichtum konnte schlimme Sorgen mit sich bringen. Um solchen Sorgen zu entfliehen, lebte Maddy hier in diesem armseligen Cottage. Aber davon hatte Lizzie keine Ahnung.
Davon hatte niemand eine Ahnung und Maddy würde niemals darüber sprechen.
„Ich muss los“, sagte Lizzie. „Es fängt jeden Moment an zu regnen. Hoffentlich schaffe ich es noch nach Hause, bevor ich bis auf die Haut nass werde. Und vielen Dank auch, Miss Maddy. Ohne Sie und Ihren Unterricht wäre ich aufgeschmissen. Onkel Bill ist Ihnen auch dankbar.“ Sie zwinkerte ihr zu. „Ich bin die schlechteste Melkerin, die er je hatte, aber seine Nichte setzt man nicht einfach vor die Tür, habe ich recht? Er hofft natürlich, dass Sie mir alles beibringen, damit er mich bald loswird. Und wenn es so weit ist, wird er Sie Ihr ganzes Leben mit Milch, Butter und Käse versorgen, schätze ich.“
Maddy lachte. „Vielleicht nehme ich deinen Onkel beim Wort. Und nenn mich nicht immer Miss M…“ Aber Lizzie rannte bereits den Weg entlang.
Maddy schüttelte den Kopf. Unzählige Male hatte sie Lizzie gebeten, sie nur Maddy zu nennen, aber Lizzie beharrte auf dem Miss, obgleich sie im gleichen Alter von zweiundzwanzig waren.
„Sie sind eine geborene Lady und ich bin nur ein einfaches Bauernmädchen. Und außerdem, wenn ich Zofe werden will, ist es besser, mir respektvollen Umgang anzugewöhnen“, pflegte Lizzie zu erklären.
Maddy fröstelte. Der Gewittersturm näherte sich rasch und sie musste ihre jungen Pflanzen retten.
In den letzten Tagen war das Wetter umgeschlagen und es hatte wieder Frost gegeben. Knospen waren an den Zweigen erfroren, Osterglocken zu Eis erstarrt und der Nachtfrost hatte mehr als ein Drittel ihres zarten Frühlingsgemüses vernichtet und das war am schlimmsten.
Sie holte Sackleinen neben dem Holzstapel an der Hintertür, breitete die Bahnen über ein Spalier aus Holzstäben auf den Beeten, um ihre kostbaren Keimlinge abzudecken.
Als Neunjährige hatte sie ihre ersten Saaten ausgebracht, voller Neugier und gespannter Erwartung verfolgt, wie daraus Keimlinge sprossen, wuchsen und gediehen, bis sie ihren ersten Salatkopf stolz ihrer Großmutter präsentiert hatte. Diese spielerischen Gartenarbeiten ihrer Kindheit hatten sich später als sehr nützlich erwiesen und sie vor dem Verhungern bewahrt.
In jenen Tagen hatte Maddy freilich nicht von einem Gemüsegarten geträumt, vielmehr von einem schönen Prinzen und festlichen Bällen, schönen Kleidern und der großen Liebe…
Allmählich war aus dem schönen Prinzen ihrer Träume ein gut aussehender Gentleman geworden und die festlichen Bälle … Darauf würde sie wohl für immer verzichten müssen. Selbst wenn sie eine Einladung erhalten würde, besaß sie kein hübsches Kleid und sie hatte auch kein Geld, um eines zu kaufen.
Heutzutage würde sie sich mit einem rechtschaffenen einfachen Mann zufriedengeben. Ein Landwirt oder Kaufmann, das war nicht wichtig, solange sie ihn gernhaben und respektieren konnte und er sie. Sie war kein Kind mehr und das Leben bestand nicht aus Traumschlössern; das Leben war ein ständiger Kampf.
Sie richtete sich auf, drückte ihren schmerzenden Rücken durch und überprüfte den Schutz ihrer zarten Pflänzchen. Sie würden die Kälte überstehen, mussten sie überstehen. Maddys kleine Familie war darauf angewiesen. Auch sie würden überleben. Es war nur eine Frage von harter Arbeit und Bescheidenheit.
Und etwas Glück. Sie hob den Blick in die dunkel brodelnde Wolkenwand.
Donnernde Hufschläge kündeten davon, dass der Reiter sich dem Cottage näherte. Und es handelte sich tatsächlich um einen Gentleman, darauf ließ seine Erscheinung schließen. Sein edles Vollblutpferd, sein eleganter brauner Pelerinenmantel, hohe Reitstiefel und der modische Biberhut. Er saß lässig zu Pferd, als wäre er im Sattel geboren.
Wen wollte er besuchen? Sir Jasper Brownrigg, der Besitzer von Whitethorn Manor, war vor drei Monaten verstorben und abgesehen vom Vikar war der Squire der einzige Gentleman im Distrikt und der war eher gentlemanlike als ein geborener Gentleman – ein feiner Unterschied, auf dem ihr Vater bestanden hätte. Ein grässlicher Snob, ihr verstorbener Herr Papa.
Und sieh nur, wohin uns dein affektiertes Gehabe gebracht hat, Papa, dachte sie in einem Anflug von Bitterkeit, in Lebensumstände, in denen ein paar alte Getreidesäcke, Gemüsesprösslinge und eine junge Melkerin mit Ambitionen zwischen deinen Kindern und der Hungersnot stehen.
Und zwischen Maddy und Fyfield Place.
Pferd und Reiter übersprangen einen breiten Graben und nahmen Kurs auf die lange niedrige Sandsteinmauer. Eine Begrenzung, die sich meilenweit den Hügeln und Mulden folgend durchs Land zog.
Seit Sir Jasper Brownrigg alt und gebrechlich geworden war, waren die Ländereien vernachlässigt, die Mauer war schadhaft geworden. Der Reiter lenkte sein Pferd seitlich an die Mauer heran, wo die Schlusssteine abbröckelten. Bei flüchtigem Hinsehen die ideale Stelle, um sie zu überspringen, aber…
„Nein, nicht dort!“, schrie Maddy. „Die Rutschbahn der Jungs …“
Ihre Worte wurden vom Wind verweht.
Unter ihren entsetzten Blicken trafen die Pferdehufe auf die glitschige Lehmbahn im selben Moment, als die Muskulatur seiner mächtigen Hinterhand sich anspannte und das Pferd zum Sprung ansetzte.
Das Tier glitt aus, die Hufe suchten verzweifelt Halt. Vergeblich. Das Pferd stürzte. Der Reiter flog durch die Luft und krachte gegen die Mauer.
In der erschrockenen Stille, die darauf folgte, schien die Welt stehen geblieben zu sein. Dann raffte das Pferd sich auf, schüttelte sich wiehernd und trabte davon, offenbar unverletzt.
Die dunkle Gestalt an der Mauer lag still da.
Maddy rannte los, ehe sie darüber nachdenken konnte, was sie tat, und stieß das verrostete Tor auf.
Der Fremde lag zusammengekrümmt im Morast, mit seltsam verdrehtem Kopf, auch ein Bein war unnatürlich nach außen gedreht. Er rührte sich nicht.
Maddy kauerte sich neben ihn, schob zwei Finger unter den Kragen seines Mantels und den dünnen Stoff seines Hemdes an seinen warmen Hals. Mit geschlossenen Augen konzentrierte sie sich, ob sie etwas an ihren Fingerkuppen spürte.
Nichts. Kein Klopfen. Keine Bewegung.
Sie entsann sich ihrer Bemerkung über den apokalyptischen Reiter.
Nein! Er durfte nicht tot sein. Bitte, lieber Gott!
Sie strich ihm das dunkle wirre Haar aus der Stirn und … spürte nichts.
Natürlich! Die Kälte hatte ihre Finger taub werden lassen. Sie rieb die Hände aneinander, bis sie brannten, schob sie erneut unter seinen Hemdkragen und schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Sie spürte seinen Puls.
Und er atmete.
Blut quoll aus einer Wunde an seinem Kopf und lief ihr warm und klebrig über die Finger.
„Sie werden nicht sterben“, befahl Maddy streng. „Hören Sie? Das lasse ich nicht zu!“
Offenbar verwirrt schlug er nach ihren Händen, bewegte Kopf und Beine rastlos. Ein gutes Zeichen. Mit einem gebrochenen Rückgrat könnte er sich nicht bewegen.
Sie faltete ihre Schürze mit der sauberen Seite nach außen zu einem notdürftigen Verband, drapierte ihn unter seinem Kopf und befestigte die Bänder über der Stirn. Dann untersuchte sie den Körper des Fremden nach Verletzungen und fand den lehmigen Abdruck eines Hufs an einem glänzend polierten schwarzen Stiefelschaft. Das Pferd hatte ihm gegen das Schienbein getreten.
Graupelschauer stachen ihr wie spitze Nadeln ins Gesicht. „Wir müssen Sie schleunigst ins Haus bringen“, erklärte Maddy ihm, als könnte er sie hören. Aber wie?
Sie legte ihm ihre Arme unter die Achseln. „Eins, zwei, drei.“ Sie versuchte, ihn hochzuhieven.
Auf dem glitschigen Lehm hätte er sich ziehen lassen sollen, das war ihre Hoffnung gewesen, aber er war ein großer Mann und schwerer, als sie vermutet hatte. Seine Kleidung war durchnässt und machte die Sache nicht leichter. Nach mehreren Versuchen, ihn wegzuschleppen, hatte sie ihn kaum einen Fußbreit von der Stelle bekommen. „Es ist hoffnungslos“, erklärte sie ihm. „Sie sind zu schwer.“
Und dann hatte sie eine Idee. „Die Schubkarre!“ Sie lief los. Die Schubkarre war alt und hatte ein eierndes Rad, aber sie funktionierte noch.
Wie sollte sie ihn aufladen? Sie versuchte, ihn hochzuheben, zuerst mit den Schultern, dann mit den Beinen zuerst. Aber alles Heben und Zerren war vergeblich, der Mann wog einfach zu viel.
„Verflixt!“, keuchte sie schließlich, als auch sie im Schlamm neben der seitlich gekippten Karre landete. Der eisige Graupelregen hatte sich verstärkt. Und dann hatte sie wieder eine Idee. Sie rollte den leblosen Körper in die umgekippte Karre, holte ein Seil und band ihn fest.
Mit einer Holzstange von der Wäscheleine über einem großen Stein als Hebel stemmte sie mit aller Kraft die Karre hoch, bis sie mitsamt ihrer Ladung wieder senkrecht stand.
Ihre Armmuskeln brannten höllisch, als sie ihn endlich durch die Haustür karrte, ohne auf die Schlammspuren zu achten, die sie dabei hinterließ.
Das Erdgeschoss des Cottages bestand aus einem Raum mit einer Feuerstelle, Tisch und Stühlen. In einer Ecke befand sich ihr breites Bett in einer Wandnische, das früher einmal für eine kranke Großmutter gebaut worden war. Nun war es Maddys Schlafstelle. Eigentlich wollte sie den Mann auf dem Bett abladen. Aber er war durchnässt, blutete und war völlig mit Lehm verschmutzt.
Sie nahm die Decken weg und breitete ein altes Öltuch über die vordere Hälfte des Bettes, damit die Laken nicht verdreckten.
Dann fuhr sie ihn neben das Bett, band ihn los, schob die Arme unter seine Achseln und zerrte ihn hoch. Die Karre kippte abermals, Maddy fiel rückwärts auf die Matratze mitsamt dem Gewicht des durchnässten verdreckten Fremden auf ihr, dessen Kopf nun an ihrem Busen lag.
„Geschafft! Wenigstens werden wir nicht mehr nass“, murmelte sie atemlos und strich ihm die nassen Locken aus der bleichen Stirn. Sie konnte kaum seine Atemzüge wahrnehmen. Er war am Leben, aber kalt, viel zu kalt.
„Wir werden Sie gleich wärmen“, sagte sie zu ihm, wand sich unter ihm hervor und bettete seinen Kopf behutsam auf das Kissen. Sie legte Brennholz nach, stellte den Wasserkessel über das Feuer und stapelte Ziegelsteine auf den Rost daneben. Mit warmem Wasser und einem sauberen Tuch wusch sie ihm das Gesicht. Und hielt inne.
Unter den Spritzern aus Lehm und Blut kam das markant geschnittene Gesicht eines schönen Mannes zum Vorschein. Dunkle dichte Wimpern auf bleicher Haut. Ein schön geschwungener Mund, ausgeprägte unrasierte Kinnpartie.
Sie ermahnte sich, ihn nicht ungebührlich anzustarren, schließlich wusste sie ja, dass ein solches Verhalten sich nicht ziemte.
„Nun befreien wir Sie erst mal von Ihren durchnässten Kleidern.“
Sie streifte ihm die feinen Lederhandschuhe ab. Lange elegante Finger, saubere, gepflegte Nägel. Eindeutig die Hände eines Gentlemans, dachte sie mit einem trübsinnigen Blick auf ihre geröteten schwieligen Hände.
Sie schälte ihn aus Weste, Hemd und Unterhemd. Auf seinem Oberkörper waren frische Blutergüsse zu sehen, aber wohl nichts Ernsthaftes.
Ihr Mund wurde trocken, als sie ihn mit einem Tuch abrieb. Männliche Nacktheit war kein Geheimnis für sie seit Papas Unfall und mit zwei kleinen Buben, die sie badete und anzog. Aber dieser Körper war anders. Völlig anders.
Papa war alt gewesen, seine Haut faltig, sein Fleisch welk und die Buben fühlten sich an wie junge Hunde, die keine Sekunde stillhalten konnten.
Dies war ein Mann, jung und stark, in der Blüte seiner Jahre.
Papa hatte säuerlich nach altem Mann, Talkumpuder und der Salbe gerochen, mit der sie ihm Rücken und Beine gegen seine Schmerzen eingerieben hatte. Die Buben rochen nach … kleinen Jungen und Kernseife. Der Mann in ihrem Bett roch schwach nach Rasierseife, Kölnischwasser und Pferd und nasser Wolle und … noch etwas. Sie atmete seinen Geruch ein, ohne dieses Etwas definieren zu können – ein dunkler moschusähnlicher Geruch nach Mann. Ein Geruch, der sie abstoßen sollte. Stattdessen fand sie ihn … verlockend.
Sie rubbelte mit dem rauen Tuch über seinen breiten Brustkorb und seine muskulösen Arme, um seine Durchblutung zu fördern. Sein Geruch prägte sich ihr ein. Sie legte eine Decke über seine Nacktheit und steckte den weichen Stoff seitlich unter ihm fest.
Nun Stiefel und Reithosen.
Die Stiefel waren das größte Problem. Sollte sein Bein oder der Fuß gebrochen sein, würde sie die Verletzung verschlimmern, wenn sie ihm den Stiefel auszog.
Papas Stiefel waren mit dem Rasiermesser aufgeschnitten worden. Damals hatte sie sich keine Gedanken darüber gemacht. Heutzutage war sie sich über den Wert der Dinge weit mehr bewusst und diese Stiefel waren sehr edel und wertvoll.
„Aber es muss getan werden“, beschloss sie streng, während sie Papas Rasiermesser holte und froh war, es mitgenommen zu haben. Es war schärfer als ihre Küchenmesser.
Mit vor Anstrengung gerunzelter Stirn schnitt sie den Schaft auf und entledigte ihn vorsichtig seines Stiefels und Strumpfes. Der Knöchel war geschwollen und bereits verfärbt. Ob er gebrochen war, konnte sie nicht feststellen. Wegen der Kopfwunde musste sie ohnehin den Doktor kommen lassen. Hoffentlich hatte der Fremde Geld bei sich, um ihn zu bezahlen, denn sie besaß keinen Penny.
„Nun die Reithosen“, sagte sie. „Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht ausgerechnet in diesem Moment zu Bewusstsein kämen.“ Forschend blickte sie in sein regloses Gesicht. Nicht das geringste Zucken, oder?
Mit raschen Handgriffen öffnete sie die Knöpfe seiner Hose. Sie badete die Jungs jeden Samstag und ein erwachsener nackter Mann würde auch nicht wesentlich anders aussehen.
Im Übrigen, obwohl sie das niemals einer Menschenseele gestehen würde, war sie neugierig, wie ein junger Mann aussah.
Das war das französische Blut in ihr, wie sie vermutete. Diese Seite in ihr brachte sie seit jeher in Schwierigkeiten. Papa und seine Verwandtschaft waren wesentlich sittsamer und zurückhaltender als Mama und Grand mère. Beinahe puritanisch.
So krank und hilflos Papa auch gewesen war, er hatte darauf bestanden, dass sein Kammerdiener Bates diese intimen Verrichtungen übernahm. Bates hasste diese Aufgaben, aber Papa duldete keinen Widerspruch. So schwach sein Körper auch gewesen sein mochte, sein Wille war stark bis zum Ende geblieben.
Das durchnässte kalte Rehleder klebte an der Haut des Mannes und ließ sich mitsamt der Baumwollunterhose nur mühsam über seine Hüften nach unten ziehen. Als das endlich geglückt war, war es leichter, ihn auch noch aus dem Rest zu schälen. Sie warf die klatschnasse Hose zu Boden, griff nach dem Handtuch und… starrte ihn an.
Sie schluckte. Er war ein Fremder. Sie sollte den Blick abwenden, sollte die Intimsphäre des hilflosen Mannes respektieren, der ohne Bewusstsein vor ihr lag.
Es gelang ihr nicht. Ihr erster nackter Mann.
Was für ein komisches Ding, seine Männlichkeit in einem Nest dunkler krauser Wolle, dunkelrosa gefärbt und ziemlich weich und schlaff. Nicht annähernd zu vergleichen mit den Beschreibungen, die sie gehört hatte. Auch kleiner, als sie erwartet hätte. Männer übertrieben maßlos.
Sie hob den Blick in sein Gesicht und stellte entsetzt fest, dass seine Augen geöffnet waren und er sie ansah. Er beobachtete sie dabei, wie sie sein … betrachtete.
„Sie sind wach!“, rief sie und deckte hastig das Tuch über ihn. „Wie fühlen Sie sich?“ Ihre Wangen waren heiß, aber sie wollte sich nicht entschuldigen. Schließlich war sie gezwungen gewesen, ihm die nassen Sachen auszuziehen.
Er gab keine Antwort. Sein Blick blieb auf sie gerichtet. Seine Augen waren sehr blau. Sie hatte noch nie zuvor so blaue Augen gesehen.
„Sie sind vom Pferd gestürzt und haben sich den Kopf verletzt. Können Sie sprechen?“
Er versuchte, etwas zu sagen, versuchte sich aufzusetzen. Aber bevor sie bei ihm war, um ihm zu helfen, sank er stöhnend zurück und schloss die Augen wieder.
„Bleiben Sie wach. Wer sind Sie?“ Sie rüttelte ihn am Arm. Er reagierte nicht.
Wenigstens war er am Leben und konnte sich bewegen. Das war immerhin ein gutes Zeichen.
Eilig rieb sie seinen restlichen Körper trocken und versuchte, nicht daran zu denken, dass er sie dabei ertappt hatte, wie sie seine Geschlechtsteile begutachtet hatte. Das war zwar peinlich, aber nichts, wofür sie sich schämen musste, redete sie sich ein. Er war verletzt, es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn anzusehen.
Aha! Um sich zu vergewissern, dass sein Ding nicht gebrochen war, meldete sich eine dünne tadelnde Stimme in ihrem Kopf, die sie ignorierte.
Da sie ratlos war, wie sie den geschwollenen Knöchel versorgen sollte, verband sie ihn mit Streifen aus Leinen. Danach rollte sie den Mann auf die saubere Seite ihres Bettes und hüllte ihn in die Bettdecke.
Mit Ofenzangen holte sie die Ziegel aus dem Feuer, wickelte sie in Wolltücher und legte sie nah an seinen Körper. Es war wichtig, ihn warm zu halten, und außerdem würden die Ziegel verhindern, dass er aus dem Bett fiel.
Schließlich überprüfte sie den Verband um seinen Kopf, kein Anzeichen von frischem Blut.
Trotz der Wärme in der Stube fror sie erbärmlich. Bevor sie sich um seine Kopfwunde kümmerte, musste sie ihre nassen Kleider loswerden, sonst würde sie sich erkälten.
Sie warf ihrem bewusstlosen Gast einen Blick zu. Sie sollte sich oben umziehen. Aber in den ungeheizten Dachkammern war es eiskalt. Die Kinder kleideten sich in der Stube vor dem Herd an und aus und vor dem Schlafengehen wärmte sie ihre Betten mit heißen Ziegelsteinen.
Maddy zögerte. Der Fremde atmete regelmäßig, seine Augen blieben geschlossen. Sie ging das Risiko ein.
Von ihm abgewandt legte sie ihre nassen Kleider ab, rieb sich ihren klammen Körper trocken und schlüpfte schnell in frische Kleider.
Als sie sich umdrehte, schloss der Fremde die Augen. Eine reflexartige Bewegung oder hatte er sie beobachtet? Unmöglich zu sagen. Ihr Fehler. Sie hätte sich oben umziehen müssen.
Und außerdem hatte auch sie ihn heimlich beobachtet. Was dem einen Recht, ist dem anderen billig. Dennoch glühten ihre Wangen und sie hoffte inständig, sich geirrt zu haben.
Nun aber zu seiner Kopfwunde. „Das wird nicht leicht sein“, erklärte sie ihm. „Da komme ich nur schwer ran.“
Sie legte alle nötigen Utensilien auf dem Bett zurecht. Dann kletterte sie hinter ihn, zog ihn zum Sitzen hoch, stützte seinen Rücken mit den Knien ab und ließ ihn sanft seitlich nach hinten sinken, bis seine Wange an ihren Brüsten ruhte.
„Anstößig, ich weiß“, murmelte sie und griff nach dem Honigtopf. „Aber Sie wissen nichts davon und ich rede nicht darüber. Nur so kann ich diese böse Kopfwunde versorgen.“
Seine Haare waren mit Lehm und Blut verkrustet. Sie wusch den gröbsten Dreck ab, bevor sie die Haare um die Wunde abschnitt. Eine tiefe Platzwunde, aus der nun wieder Blut sickerte. Aber sie glaubte nicht, dass sie genäht werden musste. Gottlob! Der Anblick einer Nadel, die durch lebendiges Fleisch stach, war ihr unerträglich, ganz zu schweigen von dem Gedanken, so etwas selbst tun zu müssen.
Sie reinigte die Wunde gründlich mit warmem Salzwasser, um zu verhindern, dass sich Eiter bildete.
Der Doktor würde Basilikumpuder in die Wunde streuen, aber so etwas hatte sie nicht im Haus. Sie hatte gehört, Spinnweben seien geeignet, um Blutungen zu stillen. Aber ihr graute vor Spinnen, deshalb gab es auch keine Spinnweben im Cottage. Sie hatte nur Honig. Mit Honig heilten Verbrennungen und kleine Wunden schneller und davon hatte sie reichlich. Sanft begann sie, Honig auf die Wunde zu streichen.
Es fühlte sich weich an wie eine weibliche Brust.
Sein Körper war wie Eis. Und Feuer. Unerträglich pochende Schmerzen vom Kopf bis zu den Zehen. Er versuchte, sich zu bewegen.
„Halten Sie still!“ Leise Stimme. Weiblich.
Er versuchte, die Augen zu öffnen. Schmerz durchzuckte ihn. Übelkeit.
„Ganz ruhig.“ Kühle Finger pressten ihn gegen etwas Warmes und Weiches.
Eindeutig ein Busen. Wessen Busen?
Eine zarte Hand drückte seine Wange sanft gegen diesen Busen. „Ich muss Ihre Kopfwunde versorgen.“ Ihre Stimme war weich, wohltuend. Beruhigend.
Gute Eigenschaft einer Frau. Ein ironisches Lachen stieg in ihm auf. Er biss die Zähne aufeinander gegen den Schmerz. Narr. Er versuchte wieder, sich zu bewegen. Rasender Kopfschmerz.
Kopfwunde? Würde er sterben?
Wenn ja, so war dies eine gute Art zu gehen, das Gesicht vergraben in den duftenden Tiefen eines Busens, sanfte streichelnde Finger, eine weiche murmelnde Stimme.
Dieser Busen, diese Finger, diese Stimme.
Wem immer sie gehören mochten.
Er spürte, wie sie sich bewegte. Schmerz durchbohrte ihn, Übelkeit, dann … schwarzes Nichts…