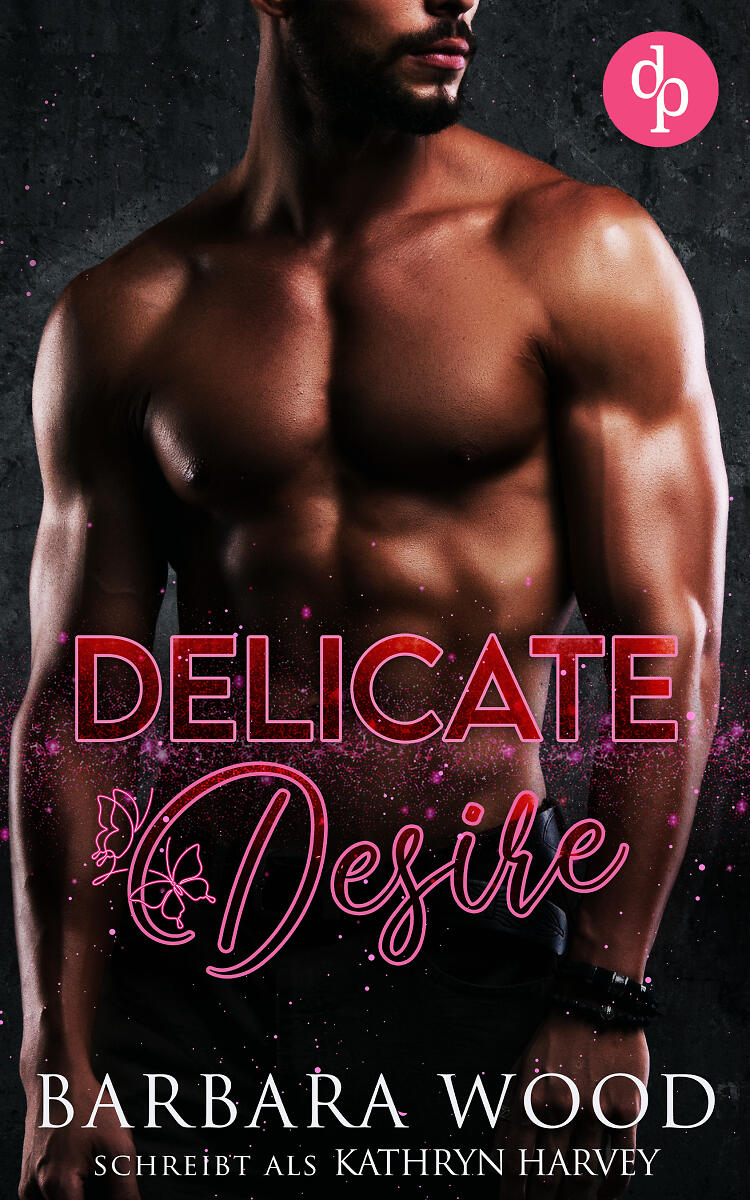1
Dr. Linda Markus saß am Frisiertisch und wollte sich gerade das Haar bürsten, als sie ein Geräusch hörte.
Ihre Hand erstarrte. Am Handgelenk trug sie eine Goldkette, an der ein Amulett hing, ein Schmetterling. Während sie regungslos dasaß und in die Nacht horchte, zitterte der Schmetterling an der zierlichen Kette und glitzerte im Lampenlicht.
Sie suchte den hinteren Teil des Schlafzimmers im Spiegel ab. Nichts schien außergewöhnlich. Da waren das überdimensionierte Bett auf dem Podest, die Satinvorhänge des Baldachins und der gekräuselte Matratzenüberwurf, alles in einem zarten, pfirsichfarbenen Ton gehalten. Auf dem Bett lagen ihr weißer Krankenhauskittel, die Bluse und der Rock sowie ihr Arztkoffer, den sie nach einem harten Tag im Operationssaal hingeworfen hatte. Auf dem Teppich lagen italienische Lederschuhe neben dem hellbraunen See ihrer Strumpfhose.
Sie horchte. Aber alles war still.
Sie fuhr fort, sich das Haar bürsten.
Es fiel ihr schwer, sich zu entspannen. Es gab so vieles, woran sie denken musste, so vieles, was ihre Aufmerksamkeit erforderte: der Patientin der Intensivstation; die Operationsbesprechung am Morgen; die Rede, die sie noch für das jährliche Bezirkstreffen der Ärztevereinigung schreiben musste.
Und dann diese verwirrenden Anrufe, die sie von dem Fernsehproduzenten Barry Greene erhalten hatte – dabei gehe es um kein medizinisches Problem, wie er auf dem Anrufbeantworter gesagt hatte. Bis jetzt hatte sie noch keine Zeit gefunden, ihn zurückzurufen.
Da war wieder das Geräusch! Ein heimliches, fast hinterlistiges Geräusch, als ob jemand draußen wäre, der hereinzukommen versuchte; als ob sich jemand bemühte, ungehört zu bleiben …
Während sie langsam die Haarbürste auf den Toilettentisch legte, atmete Dr. Markus tief ein, hielt den Atem an und drehte sich um.
Sie starrte auf die geschlossenen Vorhänge. War das Geräusch von der anderen Seite der Fenster gekommen?
Mein Gott! Waren die Fenster verschlossen?
Zitternd vor Angst starrte sie auf die schweren Samtvorhänge. Ihr Puls begann zu rasen.
Minuten schienen zu vergehen. Die Uhr aus der Zeit Ludwigs XV. über dem Marmorkamin tickte, tickte, tickte.
Die Vorhänge bewegten sich.
Das Fenster war offen!
Linda hielt den Atem an.
Eine kühle Brise schien durch den Raum zu wehen, als sich die Vorhänge allmählich teilten. Auf den champagnerfarbenen Teppich fiel ein Schatten.
Linda sprang auf und rannte, ohne nachzudenken, ins Ankleidezimmer. Als sie die Tür hinter sich zuzog, war sie von Dunkelheit umhüllt; sie tastete sich an der Wand entlang bis zu der geheimen Schublade.
In ihr sollte ein Revolver sein.
Als sie die Schublade entdeckte, zog Linda sie verzweifelt auf und griff hinein. Das kalte Metallstück fühlte sich obszön an; es war lang und hart und schwer. Ob der Revolver funktionieren würde? War er überhaupt geladen?
Als sie wieder an der Tür des Ankleidezimmers war, presste sie das Ohr dagegen und horchte. Leise Geräusche verrieten, dass jemand durch das geräumige Schlafzimmer schlich: das Knarren des Bleiglasfensters, das Rascheln der Vorhänge, das leise Huschen von gummibesohlten Schuhen auf dem Teppich.
Er war dort drinnen. Er war im Schlafzimmer.
Linda schluckte und verstärkte den Griff am Revolver. Um Himmels willen, was hatte sie damit vor? Ihn erschießen? Sie begann zu zittern, ihr Herz pochte.
Was, wenn er auch eine Waffe hatte?
Linda horchte. Sie konnte hören, wie er im Zimmer umherging.
Sie langte nach unten, umfasste den Türknopf und zog die Tür einen Spaltbreit auf.
Da war er – an der gegenüberliegenden Wand. Er schob gerade ein Gemälde beiseite und betrachtete das Kombinationsschloss eines kleinen Safes.
Linda musterte ihn. Ihre geübten Arztaugen entdeckten unter dem engsitzenden, schwarzen Rollkragenpullover und der Hose den Körper eines Mannes, der sich in Form hielt. Sein Alter konnte sie nicht schätzen – Gesicht und Haare waren von einer schwarzen, gestrickten Skimaske bedeckt – aber er war drahtig. Hübsch geformte Pobacken und Oberschenkel zuckten unter dem schwarzen Stoff.
Linda bewegte sich nicht und atmete nicht, während sie ihn dabei beobachtete, wie er gekonnt den Safe öffnete und hineingriff.
Dann drehte er sich plötzlich um, als ob er gespürt hätte, dass sie ihn beobachtete. Er starrte auf die Tür zum Ankleidezimmer; Linda sah, wie die beiden dunklen Augen argwöhnisch durch die Skimaske lugten; unter der schwarzen Wolle zeichneten sich ein grimmiger Mund und ein kantiger Unterkiefer ab.
Sie wich von der Tür zurück und hielt den Revolver zitternd in den vorgestreckten Händen. Der einzelne Lichtstrahl, der in das winzige Zimmer fiel, traf auf den glänzenden Platinschmetterling, der an ihrem Handgelenk hing, und warf einen silbrigen Glanz auf das Mieder und den Nylonslip an ihrem Körper.
Sie wich zurück, so weit sie konnte, blieb dann, den Finger am Abzug, stehen und hielt den Blick auf die Tür gerichtet.
Zunächst bewegte sich die Tür nur leicht, als ob er sie testen wollte. Dann schwang sie ganz auf, und seine dunkle Silhouette zeichnete sich gegen das schwach beleuchtete Schlafzimmer ab.
Er blickte zunächst auf den Revolver, dann in ihr Gesicht. Obwohl seine Gesichtszüge verborgen waren, bemerkte Linda eine Unsicherheit an ihm, glaubte, in seinen Augen Unentschlossenheit aufflackern zu sehen.
Er näherte sich ihr einen weiteren Schritt und betrat das Ankleidezimmer. Dann noch einen Schritt und noch einen.
»Keinen Schritt näher«, sagte Linda.
»Ich bin unbewaffnet.« Seine Stimme klang überraschend freundlich und kultiviert; die gepflegte Stimme eines Schauspielers. Er hatte nur drei Wörter gesprochen, und dennoch hatte sie in ihnen eine Spur von … Verletzlichkeit wahrgenommen.
»Raus hier«, sagte sie.
Er starrte sie weiterhin an. Zwischen ihnen lagen nur noch ein, zwei Meter; Linda konnte die Rundungen der Bizepse unter dem engen Pullover sehen, das ruhige An- und Abschwellen seines Brustkorbs.
»Ich meine es ernst«, sagte sie, den Revolver auf ihn gerichtet. »Ich werde schießen, wenn Sie nicht verschwinden.«
Schwarze Augen in einem verborgenen Gesicht musterten sie. Als er wieder sprach, schwang eine Spur von Ungläubigkeit in seiner Stimme mit, als ob er gerade etwas entdeckt hätte. »Sie sind schön«, sagte er.
»Bitte …«
Er trat noch einen Schritt näher. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich hatte keine Ahnung, dass ich in das Haus einer Lady eingedrungen bin.«
Ihre Stimme war nur ein Flüstern. »Stehenbleiben.«
Er schaute nach unten auf die Halskette in seiner Hand, den Gegenstand, den er gerade aus dem Wandsafe genommen hatte. Es handelte sich um einen langen Perlenstrang, der am Ende verknotet war.
»Ich habe nicht das Recht, das hier zu nehmen«, sagte der Eindringling und hielt die Kette hoch. »Sie gehört Ihnen. Sie gehört zu Ihnen.«
Unfähig, sich zu bewegen, starrte Dr. Markus in die dunklen Augen, während die mit schwarzen Handschuhen bedeckten Hände die Halskette über ihren Kopf hoben, sie über das Haar nach unten streiften, bis sie auf ihrem nackten Hals direkt über der Spitze des Mieders zum Liegen kam.
Die nächtliche Stille schien sich zu intensivieren, als sich der Dieb langsam die Handschuhe auszog, wobei sein Blick auf ihren Augen haften blieb. Dann nahm er den Perlenknoten in die Hand und richtete ihn so aus, dass er zwischen ihren Brüsten lag.
Bei seiner Berührung hielt Linda den Atem an.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken«, sagte er in einem ruhigen, intimen Ton. Sein maskiertes Gesicht war nur Zentimeter von ihrem entfernt. Die schwarzen Augen waren von schwarzen Wimpern und der schwarzen Wolle der Maske umrahmt. Sie konnte seinen Mund erkennen, die schmalen, festen Lippen und die weißen Zähne. Er senkte den Kopf und sagte noch leiser: »Ich hatte nicht das Recht, Sie zu erschrecken.«
»Bitte«, filterte sie. »Tun Sie das nicht …«
Er hob eine Hand und berührte ihre Schulter. Sie spürte, wie der Träger ihres Mieders langsam nach unten glitt. »Wenn Sie wirklich wollen, dass ich gehe«, sagte er, »dann gehe ich.«
Linda schaute zu ihm auf, und ihre Blicke trafen sich. Als die beiden Träger des Mieders von der Schulter fielen, senkten sich ihre Arme, und der Revolver fiel auf den dicken Teppich. Seine Hände bewegten sich so behutsam und erfahren wie beim Öffnen des Wandsafes, strichen über ihre fiebrige Haut und schienen die Art, wie sie zitterte, zu genießen. Als Spitze und Satin von ihren Brüsten glitt, schloss Linda die Augen.
»Eine so schöne Frau wie Sie habe ich noch nie gesehen«, sagte er. Seine Hände berührten sie sanft. Er wusste, wo er streicheln, wo er innehalten, wo er sie festhalten musste. »Sagen Sie mir, dass ich gehen soll«, sagte er erneut und neigte den Kopf, so dass sein Mund fast auf ihrem lag. »Sagen Sie’s mir.«
»Nein«, hauchte Linda. »Gehen Sie nicht …«
Als seine Lippen die ihren berührten, spürte Linda, wie ein Schock ihren Körper durchfuhr. Plötzlich wollte sie diesen Mann. Unbedingt. Hier und jetzt.
Er zog sie in seine Arme. Sie spürte die grobgestrickte Wolle seines Pullovers auf ihren nackten Brüsten. Seine Hände streichelten ihren Rücken, dann fuhren sie nach unten und glitten unter das Gummi ihres Slips. Linda konnte kaum atmen. Sie erstickte an seinen Küssen. Seine Zunge schob sich in ihren Mund. Ihre Oberschenkel pressten sich gegen ihn; sie spürte seine Erregung.
Ist es möglich? fragte sie sich zweifelnd. Ist es möglich, dass ich nach all den Jahren endlich mit diesem Fremden …
Und dann wurde die Stille von einem Geräusch unterbrochen. Es war ein aufdringliches, penetrantes Summen, das aus dem Schlafzimmer kam.
Er hob den Kopf. »Was ist das?«
»Mein Signalgeber. Verdammt!«
Linda drängte sich an ihm vorbei, lief zu ihrer Handtasche, griff nach dem kleinen Gerät und schaltete es aus. »Ich muss einen Anruf erledigen. Ist das ein echtes Telefon?« fragte sie und zeigte auf den im Boudoirstil gehaltenen Apparat auf dem Nachttisch. »Kann ich damit nach draußen telefonieren?«
Er blieb in der Tür zum Ankleidezimmer stehen, verschränkte die Arme und lehnte sich gegen den Türrahmen. »Heben Sie einfach ab. Das Mädchen wird Ihnen ein Amt geben.«
Während Linda die Nummer wählte, blickte sie auf den prächtigen Körper in Schwarz und spürte, wie ihre Verärgerung anwuchs. Sie hatte sich auf ein riskantes Spiel eingelassen; sie hatte keine andere Wahl gehabt. Es hatte die Chance bestanden, ein paar Stunden ungestört zu verbringen, bevor sie ins Krankenhaus zurückkehren musste, aber daraus wurde nichts. »Sein Blutdruck ist gefallen«, teilte ihr die Schwester von der Intensivstation mit. »Dr. Cane meint, er hat eine innere Blutung.«
»Okay. Bringen Sie ihn wieder in den OP. Sagen Sie Cane, er soll ihn wieder aufmachen. Ich bin in Beverly Hills. Ich werde etwa zwanzig Minuten brauchen.«
Sie hängte auf. Sie hatte den Anruf erledigt, ohne auch nur einmal ihren Namen zu erwähnen – die Schwestern auf der Intensivstation kannten Lindas Stimme –, und sie drehte sich wieder zu dem Fremden mit der Skimaske um. »Tut mir leid«, sagte sie, während sie in aller Eile die Perlenkette ablegte und nach ihren Kleidungsstücken griff. »Da kann man nichts machen.«
»Ist schon in Ordnung. Mir tut’s auch leid.«
Sie sah ihn an. Sein Gesicht konnte sie zwar nicht erkennen, aber seine Stimme klang aufrichtig bedauernd. Dennoch wusste sie, dass das Bedauern nicht echt war. Er wurde dafür bezahlt, sich ihr zu fügen.
Nachdem sie sich angezogen hatte, griff sie nach dem Krankenhauskittel und dem Arztkoffer und eilte zur Tür. Linda hielt inne und lächelte ihn ein wenig betrübt an, als sie daran dachte, was hätte sein können. Dann griff sie in die Handtasche, holte einen Hundertdollarschein hervor und legte ihn auf den Tisch neben der Tür. Normalerweise hätte er ihn erst danach erhalten. Es war nicht seine Schuld gewesen, dass sie unterbrochen wurden.
»Aber ich habe nichts getan«, sagte er leise.
»Nächstes Mal können Sie’s wieder gutmachen.«
Linda ging in einen Flur hinaus, der zu einem eleganten, angenehm diskreten Hotel hätte gehören können. Sie eilte an geschlossenen Türen vorbei und schaute auf die Uhr. Sie hätte es wirklich nicht riskieren sollen, heute Nachmittag ins Butterfly zu gehen, nicht, wo ein Patient auf der Intensivstation lag. Aber sie hatte sich seit Wochen auf diesen Besuch gefreut, hatte ihn bereits etliche Male wegen medizinischer Notfälle verschoben.
Als sie um die Ecke bog, traf Linda auf eine Hausangestellte, eine junge Frau mit einem schwarzen Rock und einer weißen Bluse mit einem Schmetterling, der mit goldenem Garn auf die Tasche gestickt war. »Ist alles in Ordnung, Madam?« fragte sie. Die Angestellte kannte Dr. Markus’ Namen nicht; alle Mitglieder des Butterfly waren anonym.
»Ich habe einen dringenden Anruf erhalten.«
»War der Gesellschafter zufriedenstellend?«
Sie erreichten den Fahrstuhl. »Er war tadellos. Ich würde gern einen neuen Termin abmachen. Am besten telefonisch.«
»Wie Sie wünschen, Madam. Auf Wiedersehen.«
Als sich die Türen flüsternd schlossen, nahm Linda schnell die schwarze Harlekinmaske vom Gesicht und verstaute sie in der Handtasche. Sie rieb sich die Wangen, falls die Maske Striemen hinterlassen haben sollte.
Der Fahrstuhl brachte Dr. Markus nach unten ins Erdgeschoß und führte in die Messing-und-Mahagoni-Eleganz von Fanelli’s hinein, einem der in Beverly Hills angesehensten Männerbekleidungsgeschäfte. Sie hastete durch die Glastüren, die auf den Rodeo Drive führten, und trat in das blendende Licht eines grellen Januarnachmittags hinaus. Linda setzte ihre übergroße Sonnenbrille auf und gab dem Parkplatzwächter ein Zeichen. Es war ein warmer, klarer südkalifornischer Tag. Linda fühlte sich an Zitrushaine erinnert, und sie wünschte sich, sie würde jemanden haben, mit dem sie diesen Tag gemeinsam verbringen könnte.
Aber es gab niemanden, und wahrscheinlich würde es niemals jemanden geben. Heute, im Alter von achtunddreißig Jahren und nach zwei gescheiterten Ehen und unzähligen erfolglosen Beziehungen, hatte sie sich damit abgefunden.
Obwohl, dachte sie, als sie die unscheinbare, schmucklose Fassade des Butterfly hinaufblickte, obwohl dort oben eigentlich jemand war, mit dem sie einen solch atemberaubenden Tag verbringen könnte … aber sie musste ins Krankenhaus, und er musste sich um andere Frauen kümmern.
Der Wächter holte den roten Ferrari, sie gab ihm ein großzügiges Trinkgeld und reihte sich in den fließenden Verkehr des Wilshire Boulevards ein. Als sie die Fenster öffnete und sich den Wind durch das blonde Haar wehen ließ, merkte Linda, dass sie erst lächeln, dann lachen musste. »Ich komme wieder!« rief sie laut in den gewaltigen Verkehr von Beverly Hills hinein. »Komme, was da wolle, Butterfly. Ich komme wieder!«
2
Als Jamie das erste Mal in Miss Highlands Swimmingpool geschwommen war, dachte er, sie sei nicht zu Hause. Er zog sich aus dem Wasser und schüttelte sich in der frischen Morgensonne. Dann blickte er nach oben und sah, dass sie an einem der Fenster im oberen Stockwerk stand und auf ihn herabschaute. Erst erschrak er darüber, dann bekam er Angst, denn die reiche Beverly Highland hätte dafür sorgen können, dass er weder in Südkalifornien noch sonst wo jemals wieder Arbeit finden würde.
Aber zu seiner Überraschung bewegte sie sich damals nicht vom Fenster fort, brüllte ihn nicht an und rief auch nicht nach den Sicherheitsleuten, die das weitläufige Anwesen in Beverly Hills bewachten. Die Hand am Vorhang ruhend, stand sie einfach nur da, wobei ihr Blick auf ihm haften blieb. Plötzlich bekam Jamie furchtbare Angst, dass jeden Moment Polizisten aus Beverly Hills kommen und ihn abführen würden. Er zog sich die Jeans an und machte sich wieder daran, das Wasser im Pool zu reinigen. Von Zeit zu Zeit schaute er hinauf, und jedes Mal sah er sie dort oben.
Er wurde in Rekordzeit fertig, fuhr mit dem Lieferwagen fort und litt die nächsten paar Tage Höllenqualen, zumal er erwartete, zusammengestaucht zu werden, weil er im Swimmingpool einer Kundin geschwommen war – obendrein mit nacktem Hintern! Aber merkwürdigerweise kam bis heute nie eine Beschwerde.
Beim zweiten Mal war er aus reinem Übermut im Pool geschwommen. Er nahm an, dass sie zu Hause war – der Rolls-Royce Silver Cloud, von dem jeder wusste, dass er ihr Lieblingswagen war, stand in der Garage. Zudem konnte er sehen, dass der Chauffeur am Excalibur arbeitete. Er fragte sich, ob sie erneut ans Fenster kommen würde, und sprang absichtlich mit einem lauten Platschen ins Wasser.
Als er wenige Minuten später nackt und tropfend aus dem Pool stieg, sah er, wie sie ihn wieder von dort oben beobachtete.
Und auch damals gab es merkwürdigerweise keine negative Reaktion.
An diesem Morgen war es das dritte Mal. Er drückte auf den Summer am schmiedeeisernen Tor und wies sich beim Wachmann aus. Dann fuhr er mit dem Pool-Wartungswagen die lange Zufahrt hinunter bis hinter das Haus, wo er den angenehmeren Teil des Morgens damit verbringen würde, Miss Highlands riesigen Swimmingpool zu reinigen. Er legte sich die Geräte und Chemikalien zurecht, hielt inne und schielte zum Haus hinauf. Sie stand bereits am Fenster.
Fast hätte er gewunken, ließ es aber. Stattdessen stemmte er die Hände in die Hüften und blickte über das blaugrün schimmernde Wasser, als träfe er eine Entscheidung. Er dachte: Sie will, dass ich es tu.
Obwohl sie eine Persönlichkeit war, die fortwährend im Rampenlicht stand und ein Liebling der Medien war, war von der zurückgezogen lebenden Miss Highland in der Öffentlichkeit tatsächlich nur sehr wenig bekannt. Sie lebte völlig allein in einem der größten Häuser von Beverly Hills, umgab sich mit einem Stab von Sekretärinnen, Beratern und Schmarotzern, jettete regelmäßig im Privatflugzeug von Küste zu Küste, zählte Politiker und Filmstars zu ihren Freunden, gab zu jeder der Jahreszeiten die Party und besaß den elegantesten Swimmingpool der Häuser, die auf Jamies Route lagen. Aber sie war so etwas wie ein Rätsel. Wenigstens war sie für alle anderen ein Rätsel, dachte Jamie, als er gerade begann, seine Jeans auszuziehen. Aber für ihn nicht: Er war zu dem Schluss gekommen, sie erkannt zu haben.
Beverly Highland war für ihre unerschütterliche Moral bekannt. Sie war eine der größten Unterstützerinnen des Gründers der Bewegung für moralischen Anstand«, des Fernsehpredigers Reverend … wie hieß er doch gleich? Alle hielten die keusche Miss Highland für eine wahrhaft sittsame Frau Saubermann, die alles, was Spaß machte, mit geschürzten Lippen missbilligte. Aber sie hatte ein kleines, schmutziges Geheimnis, entschied Jamie: Sie verspürte einen Heidenspaß beim Beobachten von jungen Männern, die nackt im Pool schwammen.
Also gut, was soll‘s? dachte er. Falls er sie genug erregen konnte, würde sie ihn vielleicht zu einem Techtelmechtel inmitten ihrer Dollarscheine einladen. Er kannte Botenjungen, die goldene Rolex-Uhren besaßen, nur weil sie alten Damen in Beverly Hills zur Hand gingen.
Er zog den Reißverschluss nach unten und streifte sehr langsam und aufreizend die Jeans herunter. Dann blieb er kurz am Beckenrand stehen, gab ihr Gelegenheit, einen ausführlichen Blick auf seinen Körper zu werfen – auf den er sehr stolz war und für den er sehr viel tat, um ihn in Form zu halten –, und sprang dann glatt und sauber wie ein heißes Messer, das durch warme Butter fährt, ins Wasser. Unter Wasser torpedierte er sich durch die gesamte Länge des Pools und kam am anderen Ende wieder an die Oberfläche, wo sein blonder Schopf im hellen Sonnenlicht auftauchte. Dann zog er seine Runden. Lässig und träge stieß er die Arme vor und schaufelte das Wasser mühelos hinter sich zurück, vor und zurück, vor und zurück, schließlich rollte er sich auf den Rücken, ließ das Wasser von sich herunterrinnen und brachte seine sonnengebräunte Haut zum Glänzen.
Als er sich, ohne außer Atem zu sein, aus dem Wasser zog, streckte er die Arme über den Kopf und schüttelte sich das Wasser ab. Zu wissen, dass sie ihn beobachtete, machte Jamie scharf. Er spürte, wie er allmählich steif wurde, und es gefiel ihm, weil sein Schwanz sich sehen lassen konnte. Dann zog er sich die Jeans an und machte sich wieder daran, den Pool zu reinigen. Nach einigen Minuten schaute er nach oben und sah, dass sie verschwunden war.
Beverly ließ den Vorhang los und wandte sich vom Fenster ab. Sie hatte seinen Namen herausbekommen. Jamie.
Dann verdrängte sie den Gedanken an ihn.
Ihr Büro war sehr sachlich eingerichtet. Ganz im Gegensatz zum Rest des Hauses, das übermäßig luxuriös und elegant ausgestattet war, war Beverly Highlands Arbeitsplatz praktisch und nüchtern gehalten. Es gab zwei große Schreibtische – ihren und den ihrer Privatsekretärin –, Aktenschränke aus Mahagoniholz, einen Computer und einen Kopierer. Maggie, ihre energiegeladene Sekretärin, hatte sich noch nicht zur Arbeit gemeldet. Es gab Briefe zu diktieren, Gästelisten mussten durchgegangen und Bitten um Spenden geprüft werden. Zudem mussten Einladungen besprochen werden, um zu sehen, welche Beverly annehmen und welche sie ablehnen sollte. Beverly Highland war Aufsichtsratsvorsitzende verschiedener großer Firmen, saß im Vorstand der Vereinigung Amerikanische Frauen für internationale Verständigung«, war die Vorsitzende vom –Komitee für Kulturförderung der Handelskammer Los Angeles« und gehörte dem »Präsidentenkomitee für Philosophie und Menschlichkeit« an. Zudem gab es einige persönliche Gelddinge, um die sich ihr Buchhalter zu kümmern hatte, und drei Pressemitteilungen zu erledigen, die ihr Pressesprecher durchsehen musste. Zu Beverlys Mitarbeiterstab gehörten außerdem zwei Privatsekretärinnen und ein PR-Mann.
Als sie ihren Platz am Schreibtisch wieder eingenommen hatte, schenkte sich Beverly aus der silbernen Kanne etwas Kräutertee in eine Tasse aus Sevresporzellan. Die morgendliche Luft wurde von seinem würzigen Aroma erfüllt. Beverly fügte keinen Zucker hinzu und knabberte nur an einem der köstlichen Zitronenplätzchen, die auf dem Teller lagen. Mit Einundfünfzig achtete Beverly Highland darauf, ihre Diät genau einzuhalten.
Sie schaute auf den Kalender auf ihrem Schreibtisch; er war in einen antiken Goldrahmen eingesetzt, ein Geschenk von einem Verleger, der unbedingt ihre Lebensgeschichte verlegen wollte.
Ein Datum darauf war rot eingekreist: 11. Juni.
Es war der Tag, für den Beverly Highland lebte. Der Tag, an dem der Parteitag der Republikaner in Los Angeles eröffnet werden sollte. Alles, was sie tat, jeder Schritt, den sie unternahm, galt ausschließlich diesem Tag.
Niemals zuvor, dessen war sie sicher, hatte ein Präsidentschaftskandidat mit so viel Optimismus auf eine so entschlossene Unterstützerin gebaut wie der Mann, der die »Kirche der frohen Botschaft«, das evangelische Millionen-Dollar-Fernsehimperium, gegründet hatte. Als er letztes Jahr verkündet hatte, er dächte darüber nach, sich für das höchste amerikanische Amt zu bewerben, geriet Beverly in Verzückung. Eine solche Entscheidung wäre für sie damals die Erfüllung eines Traums gewesen. Und jetzt, wo er sie getroffen hatte und man mit Volldampf auf die Vorwahlen im Juni zusteuerte, wuchs Beverlys Angst von Tag zu Tag an – er musste es schaffen.
Und mit ihren Verbindungen und Millionen wollte sie dafür sorgen, dass er es schaffen würde.
Sie nippte an dem mit Zimt gewürzten Tee und schaute auf sein Foto, das in einem Zinngussrahmen auf ihrem Schreibtisch stand. Er hatte es signiert und »Gelobt sei der Herr« dazugeschrieben. Sein charismatisches Lächeln strahlte ihr entgegen.
Der Reverend hatte Beverly Highland nur oberflächlich kennengelernt, bei Dinners für den Wahlfonds und auf verschiedenen politischen Veranstaltungen mit großer Breitenwirkung. Er wusste nur wenig von ihr, aber sie kannte ihn genau. Schon seit Jahren hatte sie jeden Tag seine »Stunde der frohen Botschaft« gesehen und sie nur einmal verpasst, als sie wegen einer Hysterektomie, bei der Komplikationen aufgetreten waren, im Krankenhaus gelegen hatte. Während des langwierigen Genesungsprozesses hatte sie sich in ihrem privaten Krankenzimmer einen Videorecorder aufstellen lassen. Auf diese Weise konnte sie sich die Bänder seiner Predigten ansehen. Und wie sie damals der Presse nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mitteilte, seien es diese »Stunden der frohen Botschaft« gewesen, die bei ihr den Heilungsprozess beschleunigt hätten. Ihn auf dem Bildschirm zu sehen und seiner dynamischen Stimme zuzuhören, erzählte sie den Reportern, habe ihre Seele mit Kraft und Stärke erfüllt.
Ungefähr dasselbe hatte sie ihm kurz danach schriftlich mitgeteilt und einen Scheck über eine Million Dollar beigefügt.
Sie blickte auf den Kalender, 11. Juni.
Die »Kirche der frohen Botschaft« war die größte »elektronische Kirche« der Vereinigten Staaten. Die Kirche strahlte ihre Sendung täglich über elfhundert Fernsehstationen aus, veröffentlichte wöchentlich die »Zeitschrift der göttlichen Macht«, besaß eine Schallplattenfirma, zwei Fluglinien, das meiste von Houston und nahm jeden Monat Millionen von Dollar ein. Es wurde geschätzt, dass sich fast neunzig Prozent der Bevölkerung des Südens die »Stunde der frohen Botschaft« wenigstens einmal die Woche ansahen oder anhörten; die tatsächliche Mitgliederzahl der Kirche für die gesamte Nation war unmöglich festzustellen.
Jedenfalls gab es keinen Zweifel, dass der Reverend ein äußerst einflussreicher Mann war.
Und er legte besonderen Wert auf moralischen Anstand.
Während Beverly die Tasse absetzte, stand sie vom Schreibtisch auf und ging wie automatisch wieder ans Fenster. Mit der Hand am Vorhang sah sie nach unten auf den prächtigen, terrassenförmig angelegten Garten, der sich von dem hochgelegenen Haus aus über den ganzen Hang erstreckte. Man hätte niemals vermutet, dass das landschaftlich sehr schön und kunstvoll gestaltete Anwesen nicht weit entfernt vom hektischen Geschäfts- und Einkaufsviertel von Beverly Hills lag.
Ihr Blick richtete sich nach unten auf den Pool.
Sein Name sei Jamie, hatte ihr ihre Sekretärin berichtet.
Beverly beobachtete ihn, wie er das Reinigungsnetz durch das limonengrüne Wasser des Pools führte. Sein langes, blondes Haar, das vom Schwimmen noch nicht ganz getrocknet war, fiel ihm wie bei einem Wikinger bis auf die Schultern. Und die Jeans war zu eng. Sie fragte sich, wie er sich darin überhaupt bewegen konnte. Er hatte so einen Po, auf den Mädchen heutzutage zu stehen schienenrund und knackig.
»Tut mir leid!« ertönte hinter ihr eine atemlose Stimme. »Ich bin auf dem San Diego Freeway steckengeblieben. Wieder mal!«
Beverly drehte sich um und sah, wie ihre Sekretärin Maggie hereinstürmte – die Handtasche über der Schulter, die Arme voller Papiere; in einer Hand hielt sie krampfhaft einen Diplomatenkoffer fest.
»Immer mit der Ruhe«, sagte Beverly lächelnd. »Wir haben noch ein paar Minuten Zeit.«
»Ich schwöre, es muss sich um eine Verschwörung handeln«, grummelte Maggie und griff nach dem Telefonhörer. Während sie die Nummer der Küche tippte, sagte sie: »Der Verkehr wird von Tag zu Tag schlimmer. Ich könnte schwören, ich sehe jeden Morgen dieselben abgewürgten Autos, die die Straßen blockieren … Hallo, Küche? Hier Maggie. Würden Sie uns bitte etwas Kaffee hochschicken? Und Schokoladenkuchen. Danke.« Maggie Kern, 46, war mollig und hatte auch vor, so zu bleiben.
Während sie die Papiere auf dem Schreibtisch hin und her schob und noch immer etwas von einer Verschwörung vor sich hinmurmelte, für die sie die Busgesellschaft verantwortlich machte, die auf diese Weise die Leute zum Busfahren zwingen wolle – »Ich schwöre, jeden Tag werden dieselben Autos abgewürgt, nur um die Schnellstraße zu verstopfen« –, schaute Beverly wieder nach unten auf den jungen, blonden Mann von der Pool-Wartungsfirma.
»Ah!« stieß Maggie erfreut aus, als Kaffee und Kuchen eintrafen, und stellte den Fernsehapparat an. Beverly wandte sich überstürzt vom Fenster ab und eilte zum Samtsofa. Die beiden Frauen setzten sich hin, zogen die Schuhe aus und stierten auf den Bildschirm.
Bevor sie morgens mit der Arbeit begannen, sahen sie sich jeden Tag erst die »Stunde der frohen Botschaft« an. Selbst wenn Beverly reisen musste und die beiden im Privatjet über das Land flogen oder wenn sie sich in einer anderen Stadt in einem Hotelzimmer aufhielten, verbrachten sie die erste Stunde des Tages damit, dem Reverend zuzusehen.
Prostitution und Pornographie waren die Themen, auf die er es am meisten abgesehen hatte, zudem hatte er einen schockierend anschaulichen Antiabtreibungsfilm produziert. Er organisierte Überfälle auf Pornokinos, schickte Bibeln und eifrige, junge Prediger in die Finsternis der 42. Straße und des Hollywood Boulevards und hatte, wie Beverly Highland auch, dazu beigetragen, dass das Playboy-Magazin aus den Regalen der Supermärkte verbannt worden war.
Sollte er zum Präsidenten gewählt werden, würde er ein sauberes Amerika erschaffen, so hatte er versprochen.
Die Gitarren und der Chor der frohen Botschaft stimmten ein flottes Kirchenlied an, und dann erschien er und brüllte sein Fernsehpublikum an: »Brüder und Schwestern, ich habe für euch eine frohe Botschaft!«
Es gab keinen Zweifel: dieser Mann war wirklich unwiderstehlich. Er sprühte Energie aus wie ein feuerspeiender Drache. Man spürte förmlich seine Hitze durch das Glas des Fernsehschirms strömen. Sein elektrisierender Geist schien aus seinem energiegeladenen Körper zu strömen. Es war kein Wunder, dass der Reverend so populär war, und das selbst bei Nichtgläubigen. Seine direkte und einfache Art verkaufte sich gut. Ein Journalist hatte einmal sarkastisch kommentiert, dass der begeisternde Gründer der Kirche der frohen Botschaft den Australiern Kängurus verkaufen könnte. Aber was der Reverend verkaufte, war Gott. Gott und Moral.
Und das Hauptangriffsziel seiner heutigen Predigt war eine Zeitschrift namens Beefcake-, angeblich ein Magazin für Frauen, das sich aber wegen seiner Fotografien von nackten Männern in verführerischen Posen großer Beliebtheit bei Homosexuellen erfreuen sollte. »Ich nehme heute meine frohe Botschaft aus Paulus‘ Brief an die Römer«, brüllte der Reverend über ganz Amerika hinweg. »Und Paulus sagte, dass, weil Menschen solche Narren sind, Gott sie darum auch dahingegeben hat in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinheit, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in schändliche Lüste; denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen.«
»Brüder und Schwestern!« polterte er, während er mit gewaltigen Schritten über die Studiobühne einherschritt. »Es tut mir in der Seele weh, so etwas zugeben zu müssen, aber in unserem wunderschönen Land gibt es heute Sünde und Korruption. Sündennester, in denen der Satan seine Lakaien ausbrütet. Wo Frauen ihre Körper verkaufen und Männer der Wollust und Sünde verfallen. Genau diese Orte sind es, die die Stärke unseres wundervollen Landes untergraben. Wie soll Amerika weiterhin die Nummer eins bleiben, die führende Nation, an die sich letztendlich alle Länder der Welt um Hilfe wenden, wenn wir solches Teufelswerk mitten unter uns tolerieren? Wenn Männer in Häuser der Prostitution gehen, was wird dann aus dem heiligen Stand der Ehe? Wenn Frauen ihre Körper verkaufen, wie sollen unsere Kinder dann rein aufwachsen und von Gottes Wort erfahren?«
Der Reverend zeigte drohend mit dem Finger gen Himmel und wischte sich schnell mit einem weißen Taschentuch über die schweißnassen Augenbrauen. »Ich sage, wir müssen diese Häuser der Sünde und Korruption einreißen! Wir müssen sie ausfindig machen, wo immer sie sind, und sie zum Einsturz bringen! Wir werden die Fackeln der Rechtschaffenheit tragen und sie gegen die korrupten Wände dieser Häuser schleudern und zusehen, wie sie brennen wie Satans eigenes Höllenfeuer!«
»Amen«, sagte Beverly Highland.
»Amen«, sagte Maggie.
Als die Sendung vorbei war, saßen die beiden eine ganze Weile schweigend da, dann seufzte Beverly und sagte: »Wir sollten uns lieber an die Arbeit machen. Es sind nur noch sechs Monate bis zur Vorwahl. Es gibt noch eine Menge zu tun.«
Während sich ihre Sekretärin an den Schreibtisch setzte, ging Beverly Highland wieder ans Fenster und schaute hinaus.
Sie war noch gerade rechtzeitig gekommen, um zu sehen, wie der Pool-Wartungswagen über die lange Zufahrt davonfuhr.
3
Für Trudie Stein war es nichts Neues, mit einem Fremden Sex zu haben. Gewöhnlicherweise verbrachte sie ihre Samstagabende immer so. Als sie zu dem Butterfly-Logo über der Tür hinaufsah, kam sie zu dem Schluss, dass es allerdings etwas völlig Neues war, unter solch spektakulären Umständen mit einem Fremden Sex zu haben.
Und es erregte sie unglaublich.
Als sie die Parkmarke von dem Parkwächter entgegennahm und hörte, wie er mit der stahlblauen Corvette von der Bordsteinkante losfuhr, verspürte Trudie plötzlich einen unerwarteten Angstschock.
Aber wovor sollte sie Angst haben? Schließlich kam ihre Cousine Alexis bereits seit Wochen hierher; Alexis, die Trudie immer wieder von den phantastischen Wundern dieses Hauses erzählt hatte. »Dort kannst du deine Phantasien voll ausleben«, hatte Alexis ihr gesagt. Und dann gab es noch Dr. Linda Markus, für deren Strandhaus Trudie eine Sonnenterrasse und einen Fitnessbereich entworfen hatte. Laut Alexis war Dr. Markus schon weit länger Mitglied des Butterfly gewesen. Es war sogar Linda Markus gewesen, die Trudies Cousine zur Mitgliedschaft geraten hatte. Die beiden waren seit ihrem Medizinstudium sehr enge Freundinnen. Und da war nun Trudie, dreißig Jahre alt, sie stand auf dem Bürgersteig des Rodeo Drive, kurz vor der Schwelle, hinter der sich ihre sehnsüchtigsten Phantasien erfüllen sollten. Ein aufrichtiges Dankeschön an Dr. Markus.
Alexis hatte ihr erklärt, wie das Butterfly funktionierte. Da es sich um einen kleinen ›Privatclub‹ handelte, durfte jedes Mitglied nur eine weitere Person vorschlagen. Dr. Markus hatte ihre beste Freundin Alexis gewählt, und Alexis hatte sich entschlossen, ihre Cousine Trudie zu empfehlen. Zur Orientierung war Trudie vor zwei Wochen, kurz nach Weihnachten, zu einem Gespräch mit der Geschäftsführerin hierhergekommen. Vor drei Tagen hatte sie ihr persönliches Armband erhalten und war jetzt wie die beiden anderen ein Vollmitglied mit allen Rechten und Vergünstigungen, die einem das Butterfly bot.
Trudie schlug den Mantelkragen hoch und blinzelte in der kalten Januarsonne zu dem Gebäude hinüber.
Was einem das Butterfly bot …
»Ich sag dir was, Trudie«, hatte ihr Alexis gesagt, »das Butterfly hat bei mir schon Wunder vollbracht. Es hat mir geholfen, mich selbst zu finden, mir über mich selbst klarzuwerden. Vielleicht bedeutet es für dich ja auch die Rettung.«
Die Rettung; diese erhoffte sich Trudie zweifellos. Der unwürdige Teufelskreis von Nächten mit Männern, die nie wieder anriefen oder sich im Licht der Morgendämmerung als Enttäuschungen erwiesen, hatte Trudie Stein auf einen verschlungenen Pfad geführt, der ins Nichts führte. Dabei wünschte sie sich verzweifelt, mit irgendjemandem irgendwohin zu gehen.
Nun, zunächst musste dieser erste Schritt gemacht werden. Also machte sie ihn, direkt durch die Glastür von Fanelli’s, dem vornehmen Männerbekleidungsgeschäft von Beverly Hills mit dem geheimnisvollen Schmetterling auf der schlichten Fassade. Trudie kannte das Geschäft. Vor Jahren war sie schon einmal hierhergekommen und hatte ihrem damaligen Freund ein teures Sporthemd gekauft, aber der hatte sich um die Achse gedreht und es seinem Freund geschenkt. Das Geschäft wirkte mit seinem Messing und Mahagoniholz elegant. Es wimmelte dort zurzeit von Kunden, die Weihnachtsgeschenke zurückbrachten oder umtauschten.
Trudie verharrte einen Moment, um ihren rasenden Puls zu beruhigen. Ein paar der Gesichter in der Menge erkannte sie: da war der Regisseur, dessen Swimmingpool sie entworfen hatte; da war das Rock-Idol Mickey Shannon, der versuchte, möglichst unauffällig zu wirken; und drüben bei den Toilettenartikeln erkannte Trudie Beverly Highland, die berühmte Dame der Gesellschaft.
Kurz fragte sich Trudie, ob auch sie ein Mitglied des geheimen Unternehmens ein Stockwerk höher war. Aber jeder wusste, was für eine ergebene Unterstützerin der ›Kirche der frohen Botschaft‹ Beverly Highland war und was für ein vorbildlich sittsames Leben sie führte. Außerdem konnte Trudie sehen, dass sie kein verräterisches Schmetterlingsarmband am Handgelenk trug.
Als sie sich ihren Weg durch die Menge bahnte, wusste Trudie, dass die meisten der Kunden in dem Geschäft nicht wussten, was sich oben abspielte. Das jedenfalls hatte ihr die Geschäftsführerin versichert. Diese Leute waren tatsächlich hier, um einzukaufen-nur wenige wie sie selbst steuerten auf den hinteren Teil des Geschäftes zu und vergewisserten sich, dass das Armband zu sehen war —das Armband, das aus feinen Goldgliedern bestand und an dem ein Amulett in der Form eines Schmetterlings hing.
Schließlich erreichte sie den Showraum, wo rührige Dressmen der auf Stühlen sitzenden Kundschaft die neuesten Modelle vorführten. Dieser Teil des Geschäfts wurde von einem speziellen Mitarbeiterstab beaufsichtigt, Frauen mit schwarzen Röcken und weißen Blusen, auf deren Taschen Schmetterlinge gestickt waren.
Trudie wusste, dass sich diese Frauen von den anderen Angestellten, die im vorderen Teil des Ladens arbeiteten, unterschieden. Nur diese Frauen wussten, wohin der Privataufzug führte.
Trudie hatte schon zuvor männliche Models gesehen. Selbst einige der Männer, an die sie Arbeiten vergab, jobbten nebenbei als Model. Diese Männer, die fortwährend der Sonne ausgesetzt und von der harten Arbeit gestählt waren und gewöhnlich blondgelocktes Haar hatten, schienen in Seidenblazern und grauen Flanellhosen genauso gut auszusehen wie in staubigen Jeans und T-Shirts. Aber nach Trudies Ansicht hätten die Models von Butterfly ihre Prachtkerle nur beschämen können. Und jetzt wusste sie auch, warum, jetzt kannte sie den wahren Grund, weshalb sie so gut aussahen; mit der modischen Kleidung hatte es jedenfalls nichts zu tun.
Trudie setzte sich hin, lehnte das Angebot, Tee oder eine Flasche Perrier zu trinken, ab und sah der Modenschau zu, die ein täglicher Programmpunkt von Fanelli’s war.
Gebannt hielt sie ihren Blick auf den Eingang zum Umkleideraum der Models gerichtet. Die Männer kamen einer nach dem anderen heraus und schritten langsam zwischen den sitzenden Gästen umher, von denen die meisten Frauen waren. Die Models trugen verschiedene Modelle, vom Lederblouson bis hin zum Pyjama von Savile Row, und die Männer selbst deckten, was Alter, Körperbau und äußeres Verhalten anging, eine ganze Bandbreite von Typen ab. Für jede etwas, dachte Trudie, während ihre Erregung wuchs.
Die Messinguhr an der Wand tickte. Die Männer kamen einer nach dem anderen aus dem verborgenen Umkleideraum, schlenderten umher, lächelten, setzten sich in Positur und verschwanden wieder. Einige Kundinnen standen auf und gingen, andere kamen herein und setzten sich hin. Die meisten verließen mit Paketen unterm Arm den Raum (aber wie Trudie sehen konnte, betrat keine den speziellen Aufzug im hinteren Teil des Ladens).
Während sie sich die Männer genau ansah – besonders den einen mit dem Seemannspullover und der Figur von Arnold Schwarzenegger und den kleinen, drahtigen Asiaten im Kung-Fu-Freizeitlook –, fielen Trudie zwei andere Frauen auf, die dort schon genauso lange gesessen hatten wie sie. Trudies Blick richtete sich auf ihre Handgelenke. Die beiden Frauen trugen das Armband mit dem Schmetterling.
Und dann sah sie ihn.
Er hatte graumeliertes Haar und ein vornehmes Aussehen, war vielleicht um die Sechzig und führte einen exquisiten, schwarzen Kaschmirmantel vor. Trudie war plötzlich außer Atem. Er war phantastisch.
Ihn. Ihn wollte sie sich auswählen.
Aber jetzt, da der eigentliche Augenblick gekommen war, an dem sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen konnte, fühlte sich Trudie plötzlich schüchtern und unerklärlich widerwillig. Ich hab mir schon so häufig die Finger verbrannt …
Wenn man sie sah, konnte man annehmen, dass Trudie Stein mit ihren Männerbekanntschaften durchschlagenden Erfolg haben musste: sie war eine große, gutaussehende Blondine, die modische Kleidung trug, ihre Haare zu einer struppigen, flotten Frisur aufbauschte und einen dreißigtausend Dollar teuren Wagen fuhr. Wenn sie sich auf einer Baustelle aufhielt, trug sie Shorts und einen Pullunder ohne BH, die ihren gebräunten, athletischen Körper hervorhoben, und sie kommandierte mehr als zwanzig Männer auf einmal herum. Das Problem war, dass zu viele von ihnen in ihr nur eine x-beliebige aufgeplusterte Blondine sahen, ein reiches, hirnloses und leichtes Opfer, das in dem harten Baugeschäft anscheinend allein nicht klarkam und deshalb »einen Mann um sich brauchte«.
Während sie den Mann mit den silbergrauen Haaren in den Umkleideraum verschwinden sah, ließ Trudie es zu, sich eine schmerzliche Erinnerung ins Gedächtnis zurückzurufen, die sie normalerweise in die entferntesten Winkel ihres Gehirns verdrängte.
Es war die Erinnerung an eine Nacht, die bereits mehr als ein Jahr zurücklag. Die Pool-Saison begann abzuflauen – Trudies Firma hatte am meisten zwischen Frühjahr und Sommer zu tun. Als man sich jenen November um die letzten Details kümmerte – künstliche Wasserfälle mussten funktionieren, Springbrunnen wurden in Gang gesetzt und Inspektionen mussten erledigt werden –, war der große Auftritt von Greg Olson gekommen, ihrem Subunternehmer für Maurerarbeiten. Ein Mann, mit dem sie monatelang harmlose Flirts gehabt hatte. »Wir werden bald nicht mehr viel zu tun haben, Trudie«, sagte er ihr damals mit seiner gedehnten Stimme, an der sie immer mehr Gefallen fand. »Die Geschäfte werden uns nicht mehr im Weg stehen. Was hältst du davon, wenn wir zusammen etwas trinken gehen?«
Nun, Greg Olson besaß eigenes Geld, fuhr einen Allante, konnte jede Frau haben, die er wollte, und schien nicht unter dem Druck zu stehen, permanent seinen Machismo unter Beweis stellen zu müssen wie die meisten der anderen Burschen. Folglich kam Trudie zu dem Schluss, dass er ungefährlich war, und lockerte ihre anfängliche Abwehrhaltung. Und es ging auch alles gut – wenigstens zunächst. Sie aßen zu Abend und tanzten in einem Restaurant am San Vicente, im Westen von Los Angeles. Danach eine anregende Fahrt über den Pacific Coast Highway. Und dann – fuhren sie auf einen Parkplatz! Wie ein Teenagerpärchen.
Trudie gefiel es. Die ganze Szene war so köstlich kindisch, dass ihr etwas liebenswert Unschuldiges anhaftete. Die Konsequenz daraus war, dass Trudie früher nachgab, als sie es zuvor geplant hatte. Später, als sie sich den Sand von der Kleidung klopften, während sie das Steilufer hinaufkletterten, um zum Auto zurückzugelangen, sagte Greg: »Mann o Mann, du warst gut da unten. Du hast uns ganz schön zum Narren gehalten.«
»Wie meinst du das?« fragte Trudie, nachdem sie in den Wagen gestiegen war. Doch sie kannte bereits die Antwort und fürchtete sich vor ihr, wollte sie nicht hören und wünschte sich plötzlich, sie wäre heute Abend mit Greg Olson nicht ausgegangen und hätte auf ihre verdammte Vorahnung gehört, als diese ihr gesagt hatte: Sei auf der Hut! Er hat etwas mit dir vor.
»Wir haben dich alle für lesbisch gehalten. Einige der Jungs haben sogar eine Wette darauf abgeschlossen.«
Später, als die Pool-Saison wieder begann, suchte sich Trudie einen neuen Subunternehmer für Maurerarbeiten. Zudem führte sie für sich selbst eine neue eiserne Regel ein: nie mehr mit einem Geschäftspartner ausgehen.
Folglich blieben nur die samstagabendlichen Bekanntschaften; Fremde in Singles-Kneipen, die sich als heftige Liebhaber, egoistische Liebhaber, fragwürdige Liebhaber herausstellten, und Typen, die danach nichts anderes zu sagen hatten als: »War’s gut für dich?«
Er kam wieder zum Vorschein, der Mann mit den graumelierten Haaren, und das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Dieses Mal trug er einen Trenchcoat aus Leder und um den Hals einen weißen Seidenschal. Als er an ihr vorbeiging, glaubte Trudie, dass er ihr ein Extralächeln zuwarf. Sie blickte zu den beiden anderen Frauen hinüber: eine war bereits verschwunden; die andere schrieb etwas auf einen Zettel und gab ihn einer Angestellten.
Trudie öffnete hastig ihre Handtasche und holte einen kleinen Notizblock hervor. Sie war plötzlich beunruhigt und hatte Angst, dass er bereits vergeben war. Warum hatte sie hier so lange herumgesessen?
Ihre Hand zitterte beim Schreiben. Das hier war unglaublich! Es war phantastisch!
»Was machst du im Butterfly?« hatte sie ihre Cousine gefragt.
»Alles, was du dir nur vorstellen kannst, Trudie. Man ist dort sehr entgegenkommend.«
»Und was ist mit Linda Markus? Was macht sie, wenn sie dort hingeht?« Und Alexis hatte gesagt: »Linda mag Verkleidungen. Außerdem gefällt es ihr, wenn sowohl sie als auch der Mann Masken tragen.«
Masken! dachte Trudie, als sie der Angestellten nervös den Zettel übergab. Und wie würde es mit ihrem Liebhaber mit den graumelierten Haaren sein? Würde er es wirklich schaffen, ihre sehnsuchtsvollen Phantasien zu erfüllen? Würde sie, wenn sie nach oben ginge, dort wirklich all das vorfinden, was sie gerade auf den Zettel geschrieben hatte?
Trudie musste nicht lange warten. Sie saß mit verschlungenen Händen da, während Minuten zu verrinnen schienen – Trudie Stein, die normalerweise so abgeklärt und ruhig war, wenn es um Sex ging. Und sie betete, dass ihr die andere Frau nicht mit dem graumelierten Model zuvorgekommen war. Dann kam die Angestellte zurück, murmelte: »Hier entlang, bitte«, und Trudie folgte der Frau in den Privataufzug.
Zuvor hatte sie sich stundenlang den Kopf über ihr Auftreten für diesen ›Spezialtermin‹ am heutigen Abend zerbrochen. Während des Aufbaus ihrer Pool-Firma und des damit verbundenen Kampfes, die Firma in dieser von Männern beherrschten Domäne zu etablieren, hatte Trudie lernen müssen, ihre natürliche Weiblichkeit zu unterdrücken und eine bärbeißige, aggressive Art anzunehmen. Hätte sie das nicht getan, hätte sie keiner der Kerle, die für sie arbeiteten, ernst genommen, und keiner der Aufträge wäre erledigt worden. Die Konsequenz daraus war, dass man sie für ein penetrantes Weib hielt, das den Komplex hatte, beweisen zu müssen, wenigstens genauso gut wie ein Mann zu sein, und das wusste sie.
Während der Arbeit versuchte sie immer mit Shorts und Pullunder als »geschlechtsloses« Wesen aufzutreten (für den Busen konnte sie nichts), aber sobald sie Schreibbrett und Bauzeichnungen wegräumte und für einen Abend in der Stadt bereit war, brachen Trudies urweibliche Instinkte wieder durch. Für ihren ersten Abend im Butterfly hatte sie sich besondere Kleidung angeschafft: einen Wollrock, der bis zu den Knöcheln reichte, eine Bluse aus hellblauer Seide und eine Halskette und Ohrringe aus Silber. Trudie wusste, dass sie jetzt sehr feminin wirkte, zumal sämtliche Nachwirkungen der Bauarbeiten geschwunden waren.
Die Angestellte führte Trudie durch einen leisen Flur, an geschlossenen Türen vorbei, bis hin zum letzten Raum, wo sie mit ihrer sanften Stimme sagte: »Wenn Sie hier bitte hineingehen würden.«
Trudie ging hinein.
Und die Tür wurde hinter ihr geschlossen. Jetzt stand sie allein in einem kleinen, intimen Esszimmer, das mit Sofa und Stühlen im französischen Barockstil, mit vollen Bücherregalen und einem dicken Teppich geschmackvoll eingerichtet war. Der Tisch war bereits mit einer weißen Leinendecke, Porzellangeschirr, Kristallgläsern und Kerzenleuchtern gedeckt. In einem silbernen Sektkübel stand eine eisgekühlte Champagnerflasche; das gedämpfte Licht beleuchtete festlich einen Kristallaschenbecher und eine Rose in einer schmalen Vase. Aus unsichtbaren Lautsprechern kam leise Musik.
Trudie konnte kaum glauben, wie aufgeregt sie war. Trudie Stein, die von ihrem Vater gelernt hatte, in keiner Situation die Kontrolle zu verlieren und immer diejenige zu sein, die das Kommando führte. Selbst auf ihren samstagabendlichen Streifzügen, wenn sie fremde Männer kennenlernte und mit ihnen nach Hause fuhr, war sie immer diejenige, die das Sagen hatte, und das ohne eine Spur von Angst oder Selbstzweifeln.
Jetzt ertappte sie sich dabei, wie sie sich in Kurzform fragte: Was mache ich hier eigentlich, um Himmels willen?
Aber hatte ihr Vater ihr nicht beigebracht, immer nach den Ster
nen zu greifen, sich die Träume ihrer Herzenswünsche auszumalen? Hatte er ihr nicht alles vom Baugeschäft beigebracht, sie mit auf Bausteilen genommen, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, und hatte er seinem einzigen Kind nicht ein Selbstwertgefühl, einen Sinn für Individualität und Unabhängigkeit eingeimpft? Hatten sich ihre Eltern nicht um diesen Punkt gestritten? Die Mutter wollte, dass ihre Tochter den traditionellen Weg einschlug, einen Mann fand und eine gute Ehefrau und Mutter wurde. Für den Vater stand fest, dass sich die Welt, dass sich die Zeiten änderten und dass seine Tochter ihr Leben selbst in die Hand nehmen würde. Sam Stein hatte ihr bis zum Tage seines tragischen und viel zu frühen Todes beigebracht, zu träumen und diese Träume wahr zu machen.
Nun, war es nicht das, was sie hier gerade im Butterfly vorhatte? Oder, wie es ihre Cousine ausgedrückt hatte, nach einer ›Rettung‹ zu suchen? Als Trudie jetzt Schritte auf dem Flur hörte, hoffte sie, vielleicht in diesen vier Wänden Antworten zu finden. Vielleicht würde sie entdecken, wonach sie eigentlich suchte, herausfinden, was es war, das sie an Samstagabenden aus ihrer Wohnung trieb und das sie zu zwingen schien, diese fraglos unbefriedigenden und manchmal verheerenden zufälligen Bekanntschaften mit Fremden einzugehen. Trudie war hier nicht nur wegen des Sex – den konnte sie überall haben. Sie war hier in der Hoffnung, Lösungen zu finden.
Auf der anderen Seite des Zimmers war eine zweite Tür. Sie öffnete sich jetzt, und er kam herein. Trudie konnte es kaum glauben – in dieser intimen Atmosphäre mit dem gedämpften Licht sah er noch besser aus. Er war tadellos angezogen. Trudie erkannte, dass das schwarze Wolljackett von Pierre Cardin stammte und passend zur Hose von T. Gray, zum blass grauen Seidenhemd und der burgunderfarbenen Krawatte war. Und der Mann selbst: groß und schlank, mit einer überzeugenden Schulterpartie. Trudie fand, er hätte auch der Direktor einer großen Firma oder der Präsident einer wichtigen Universität sein können.
Er kam zu ihr herüber und sagte mit leiser, gepflegter Stimme: »Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend kommen konnten. Mit dem Essen wird es noch etwas dauern. Möchten Sie sich nicht setzen?«
Er berührte ihren Ellbogen und führte sie zu dem blauen, S‑förmigen Samtsofa. »Möchten Sie etwas trinken?« fragte er, während er zu der kleinen Bar hinüberging.
»Weißwein, bitte«, sagte sie und war selbst erstaunt, wie schüchtern ihre Stimme klang.
Er kam mit einem langstieligen Glas für Trudie und einem Becherglas mit einer braunen Flüssigkeit für sich selbst zurück. Dann setzte er sich in einen Ohrensessel. Dabei machte er es sich mit einer solchen Leichtigkeit und Gewohnheit bequem, als sei er in seinem eigenen Haus. Schließlich setzte er den Drink ab, ohne davon getrunken zu haben.
Trudie schaute auf ihr Weinglas. Sie fühlte sich plötzlich unter seinem grauäugigen Blick gehemmt. Sie war überrascht, feststellen zu müssen, dass sie keinen Schimmer davon hatte, was sie sagen, was sie als nächstes tun sollte; schließlich war das hier etwas anderes als ihre Wochenendbekanntschaften. Hierfür bezahlte sie!
»Ich lese zurzeit ein höchst interessantes Buch«, sagte er und griff nach dem Buch, das auf dem kleinen Beistelltisch neben dem Ohrensessel lag. Er hielt es ihr entgegen, damit sie es sehen konnte. »Haben Sie es zufällig gelesen?« Trudie sah auf den Titel. Ja, sie hatte das Buch gelesen.
»Und wie hat es Ihnen gefallen?« fragte er.
»Es war gut. Allerdings nicht so gut wie seine früheren Werke.«
»Wie meinen Sie das?«
»Hm, nun …« Trudie nippte an ihrem Wein, um Zeit zu schinden, um sich zu sammeln.
Was war los mit ihr? Hitzige Debatten über Bücher und weltanschauliche Theorien hatten in all den Jahren mit ihrem Vater einen wichtigen Platz eingenommen. Er hatte ihr die Kunst und die Kniffe des Diskutierens beigebracht, und sie war so gut darin geworden, dass sie in dem Jahr vor seinem Tod gewöhnlich die Oberhand behalten hatte.
Plötzlich wurde Trudie klar, was mit ihr los war: sie war aus der Übung. Acht Jahre Pool-Fachsimpeleien und das Wie-ist-Ihr-Sternzeichen-Gerede in Aufreißerkneipen hatten ihre Fähigkeiten einrosten lassen, und jetzt forderte sie ihr Gesellschafter dazu auf, diese zu testen. Es war genau das, worum sie gebeten und was sie unten auf den Zettel geschrieben hatte.
»Ich denke, er ist dieses Mal zu weit gegangen«, sagte sie in Bezug auf den Autor. »Seine früheren Werke basierten auf konkreten Theorien und sorgsamen Recherchen. Aber diese Story scheint konstruiert. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sein letztes Buch vor zehn Jahren erschienen ist. Als ich das hier gelesen habe, wurde ich das Gefühl nicht los, dass der Autor eines Morgens aufwachte und ihm klar wurde, dass er allmählich in Vergessenheit geraten war. Es ist so, als ob er all seine Freunde um sich versammelte und sagte: ›He! Ich brauche dringend eine neue Idee für einen populären Roman. Hat jemand irgendwelche Vorschläge zu machen?‹«
Er lachte zurückhaltend. »Sie könnten recht haben, obwohl ich das Buch noch nicht zu Ende gelesen habe. Ich werde mich mit meinem Urteil zurückhalten, bis die Geschworenen zusammentreten.«
»Wie heißen Sie?« fragte Trudie plötzlich. »Wie soll ich Sie nennen?«
»Wie würden Sie mich gerne nennen?«
»Thomas«, sagte sie. »Sie sehen wie ein Thomas aus.«
Er nippte an seinem Drink und sagte: »Wissen Sie, auch wenn ich das Buch noch nicht beendet habe, möchte ich trotzdem in Frage stellen, was Sie eben über die Arbeit des Autors gesagt haben. Sie behaupten, dass seine früheren Werke auf soliden Theorien basieren. Und was ist mit seinem ersten Roman? Eine frei erfundene Geschichte.«
Trudie zog die Augenbrauen hoch. »Aber das war sein erstes Buch! Und er hat es in den sechziger Jahren geschrieben. Er war jung und naiv, wurde sozusagen erst flügge. In diesem Fall sollten Sie wenigstens im Zweifel für den Angeklagten entscheiden.«
»Mir scheint, dass Sie im Falle dieses Buches nicht dieselben Zweifel für den Angeklagten sprechen lassen.«
»Sie haben es noch nicht ganz durchgelesen. Warten Sie, bis Sie beim zehnten Kapitel angelangt sind. Seine Geschichte wird dort sehr unglaubwürdig.«
»Ich hab Kapitel zehn bereits gelesen und muss Ihnen widersprechen …«
Die Diskussion kam voll in Gang. Durch das gewachsene Zutrauen zog sich Trudie jetzt die Schuhe aus und winkelte die Beine an. Thomas schenkte ihr Wein nach und zweifelte weiterhin ihre Meinung an. Irgendwann klopfte es diskret an der Tür, und ein Kellner kam mit einem Handwagen herein. Trudie fühlte sich nicht danach, etwas zu essen. Sie war zu überdreht, zu sehr in die Diskussion vertieft. Die beiden führten ihr Streitgespräch fort, während der Kellner den frischen Spinat und den Champignonsalat präsentierte und dann anrichtete. Trudie griff Thomas’ Schlussfolgerungen an, während saure Sahne und Kaviar auf gelierte Consommés gelöffelt wurde; er zwang sie in die Defensive zurück, während das Basilikum-Huhn und kleine, rote Rosmarinkartoffeln serviert wurden. Die Eierkrem-Nachspeise ignorierten sie völlig; den Kaffee ließen sie kalt werden. Trudies swimmingpoolgrüne Augen blitzten auf, sobald sie einen Treffer erzielte; ihre Stimme wurde lauter, wenn ein Punkt an ihn ging. Sie sprach schnell, unterbrach ihn häufig. Sie stützte sich auf ihren verschränkten Armen auf, spielte aufgeregt an den hin- und her schlenkernden Ohrringen herum, wurde mit jedem Widerstand, den er ihr entgegensetzte, zusehends lebendiger.
Sie wurde sich seiner brennend bewusst. Der schwache Geruch des English Leather, das Schimmern seiner goldenen Rolex, seine schön manikürten Fingernägel. Jeder Zentimeter an ihm bewies Klasse. Etwas ganz anderes als Schutzhelme und sexistische Anspielungen. Thomas hörte zu, wenn sie etwas sagte, und schenkte ihr Glauben, wo es angemessen war. Er hatte sein Jackett abgelegt und die Krawatte gelockert. Er beugte sich über den Tisch zu ihr herüber und beteiligte sich genauso engagiert an der Diskussion wie sie. Trudie spürte, wie ihr Herz schneller schlug; sie war wie rasend. Plötzlich war sie in Hochstimmung und völlig aufgedreht.
»Sie gehen von einem falschen Sachverhalt aus«, sagte er.
»Das tu ich nicht! Wenn es ein Thema gibt, von dem ich mehr verstehe als jeder andere Mensch, dann ist es das. Zum besseren Verständnis müssen Sie dazu Whittington lesen …«
»Whittington ist ein drittklassiger Außenseiter.«
Trudie sprang von ihrem Stuhl auf. »Thomas! Das ist doch wohl eher eine Ansichts- als eine Tatsache.«
Sie entfernte sich von ihm, warf sich herum und kam mit großen Schritten zurück. Sie konnte sich kurz im Spiegel sehen: ihre Wangen waren rot angelaufen, ihre Augen glänzten fiebrig. Ihr wurde plötzlich klar, dass sie diesen Mann mehr begehrte, als sie jemals zu
vor einen Mann begehrt hatte, und sie war davon überzeugt, sofort Feuer zu fangen, sobald er sie nur berühren würde.
Und dann stand Thomas auf und griff nach ihr. Mit einem heftigen Kuss schnitt er ihr das Wort ab. Die Debatte war endgültig beendet, und Trudie flüsterte: »O mein Gott, schnell, schnell!«
Sie liebten sich auf dem schweren Teppich. Als Trudie im Orgasmus laut schrie, glaubte sie, sie würde sterben – nie zuvor hatte sie einen Höhepunkt so intensiv, so gänzlich umwerfend erlebt. Und als es vorbei war und sie eine Weile in seinen Armen lag, wunderte sie sich über den soeben verbrachten Abend. Ihr war bewusst, dass das der beste Sex gewesen war, den sie seit langem erlebt hatte, vielleicht in ihrem ganzen Leben. Während Thomas sie in den Armen hielt und streichelte und küsste, konnte Trudie kaum glauben, dass es wirklich passiert war.
Und dann fiel ihr eine Frage ein. Sie wollte Thomas fragen, wollte aber den Zauberbann nicht brechen. Also fragte sie sich nur selbst, und sie fand keine Antwort.
Wer steckte hinter diesem magischen Betrieb in den Räumen über Fanellis Männerbekleidungsgeschäft? Wer dachte sich das alles aus? Wer hatte den Club eröffnet? Wer leitete ihn? Wer stand hinter dem Butterfly?
4
New Mexico, 1952
Rachels früheste Kindheitserinnerung war, mitten in der Nacht aufzuwachen und ihre Mutter weinen zu hören. Sie erinnerte sich, wie sie aus dem Kinderbett krabbelte und durch den Flur zu einem anderen Zimmer wackelte. Die Tür stand offen. Sie wusste, dass Mummy und Daddy drinnen waren. Sie konnte sich daran erinnern, wie sie hineinging und ihre nackte Mutter sah, auf Händen und Knien, und es sah so aus, als ob Daddy sie von hinten mit dem Bauch stieß, während Rachels Mutter weinte und ihn anflehte aufzuhören.
Erst als Rachel vierzehn Jahre alt war, hatte sie erfahren, was die beiden getan hatten.
Zwei Geheimnisse umgaben Rachel Dwyers Geburt. Von beiden hatte sie bis zu einem glühend heißen Tag nichts gewusst. Sie war zehn Jahre alt und allein im Wohnwagen zurückgelassen worden, während ihre Eltern zu einer nahe gelegenen Kneipe an der Landstraße gegangen waren, und sie langweilte sich.
Langweile führt zu Unruhe, und Unruhe kann Neugierde hervorrufen, die wiederum zu Entdeckungen führen kann. Manchmal zu ungewollten Entdeckungen. In diesem Fall war es die schäbige, alte Zigarrenkiste, die Rachel unter der Küchenspüle hinter Reinigungsmitteln und Putzlappen eingeklemmt entdeckte.
Rachel war mit zehn ein frühreifes Kind – nicht gut erzogen (ihr arbeitsloser, umherziehender Vater sorgte dafür), aber gescheit. Sie konnte besser als andere Kinder in ihrem Alter lesen – eine Fähigkeit, geboren aus der Einsamkeit und der Verzweiflung, sich aus einem erbärmlichen Leben in die Phantasiewelt von Büchern flüchten zu müssen –, und sie hatte ein scharfes Auge. Auf den ersten Blick erkannte sie, dass die Zigarrenkiste nicht ziellos in die modrige Vertiefung gestopft, sondern dort bewusst versteckt worden war.
Sie öffnete die Kiste.
Zwischen der unergründlichen Ansammlung von Gummibändern, vergilbten Geburtstagskarten, einem Ring und abgerissenen Kinokarten waren zwei Dinge, die die Zehnjährige verblüfften. Das eine war ein Foto; das andere ein Dokument.
Da sie so gut lesen konnte, erkannte sie sofort, dass es sich um eine Heiratsurkunde handelte, auf der die Namen ihrer Eltern aufgedruckt waren. Zudem war der Name einer Stadt angeführt, von der Rachel noch nie zuvor etwas gehört hatte – Bakersfield, Kalifornien. Aber das Datum bereitete ihr Kopfzerbrechen.
Die Urkunde sagte aus, dass ihre Eltern am 14. Juli 1940 geheiratet hatten.
Doch wusste Rachel, dass sie 1938 geboren worden war.
Sie war zwei Jahre alt gewesen, als die beiden geheiratet hatten. Also konnte das nur eins bedeuten: dass er nicht ihr wirklicher Daddy war!
Das freute sie so sehr, dass sie dem Foto nicht die nötige Aufmerksamkeit widmete, die es verdient hatte. Denn wenn sie es getan hätte, hätte sie mit ihrer jugendlichen Weisheit an der müde aussehenden Frau in dem Krankenhausbett, die in jedem Arm ein neugeborenes Kind in den Schlaf wiegte, etwas beunruhigend Vertrautes entdecken können.
Erst später in der Nacht begann sie wieder, an das Foto zu denken – Rachel lag völlig regungslos unter den Decken auf dem Sofa, wo sie im Wohnwagen zu schlafen pflegte, und wartete darauf, dass sich ihr Vater in den Schlaf schnarchte (sie versuchte immer, so unsichtbar wie möglich zu sein, wenn er in der Gegend war, besonders wenn er betrunken war).
Und dann traf es sie wie ein Schlag.
Obwohl die Frau auf dem Foto weit jünger aussah, war sie Rachels Mutter.
Aber wer waren diese beiden Kinder?
Weit nach Mitternacht, als es in dem dünnverschalten Wohnwagen kalt wurde und sich die Stille der Wüste ausgebreitet hatte, kroch Rachel aus dem Bett, suchte die Taschenlampe, die sie immer dann benutzten, wenn das elektrische Licht abgestellt wurde – was häufig vorkam –, und holte wieder die Zigarrenkiste hervor, die sie tags zuvor vorsichtig zurückgestellt hatte. Sie sah sich die Kinder auf dem Bild genau an. Es gab keinen Zweifel. Eins von ihnen sah fast genauso aus wie auf dem Foto von Rachel selbst, das ihre Mutter in der Brieftasche aufbewahrte.
Rachel runzelte die Stirn. Wenn das ein Foto von ihr war, als sie geboren wurde, wer war dann das andere Kind?
Sie wartete den richtigen Augenblick ab. Rachels Mutter war keine zugängliche Frau, an die man sich zu jeder Zeit hätte wenden können. Wenn sie nicht betrunken war oder nicht einen ihrer unpässlichen Morgen hatte, hielt sie sich drüben im Büro der Wohnwagenkolonie auf und hörte Arthur Godfrey im Radio zu. Aber es gab Augenblicke, da war Mrs Dwyer zugänglich, gewöhnlich dann, wenn Rachels Vater wieder einmal für längere Zeit unerwartet abwesend war. Während dieser Zeit schien Rachels Mutter keinen Bourbon in den Kaffee schütten zu müssen; sie pflegte sich zu waschen und die Haare aufzudrehen, den Wohnwagen aufzuräumen und darüber zu reden, draußen in den Staub Geranien pflanzen zu wollen. An solchen Tagen hörte Rachel ihre Mutter tatsächlich vor sich hin summen, sah, wie die Falten aus ihrem Gesicht verschwanden, beobachtete, wie sie in einem gebügelten Kleid umherspazierte, und hörte sie mit den Nachbarn lachen. An so einem Tag ging Rachel zu ihrer Mutter, die gerade Wäsche auf die Leine hängte und mit hölzernen Wäscheklammern im Mund ›Prisoner of Love‹ sang. Rachel stellte ihr erschreckende Fragen.
Das Kind schadet sich mit seiner Ehrlichkeit nur selbst, dachte Mrs Dwyer oft. Von wem hatte Rachel nur diese Veranlagung, die Wahrheit zu sagen? So, wie sie jetzt zum Beispiel einfach drauflos plauderte, dass sie die versteckte Zigarrenkiste gefunden und den Inhalt durchgewühlt habe. Wirklich, für solche Ehrlichkeit konnte man einem Kind nicht einfach den Hintern versohlen, selbst wenn es herumgeschnüffelt hatte.
»Bin ich ein uneheliches Kind, Mummy?« fragte Rachel und wies auf die Diskrepanz zwischen ihrem Geburtsdatum und dem Heiratsdatum ihrer Eltern hin.
»Wo hast du solche Wörter nur gelernt, Schatz?« fragte Mrs Dwyer, während sie dem Kind mit der Hand durch das braune Haar fuhr. »Das hast du aus all den Büchern, die du liest. Ich kenne kein Kind, das so viel liest wie du.« Dann kniete sie sich in den Staub und nahm ihre Tochter sanft bei den Schultern. »Nein, Schatz. Du bist nicht unehelich. Es ist egal, wann dein Vater und ich geheiratet haben. Alles, was zählt, ist, dass wir es getan haben. Du bist Rachel Dwyer. Deinen Nachnamen hast du von deinem Vater.«
»Aber …« Rachels Unterlippe zitterte. Sie hatte so sehr gehofft, von ihrer Mutter etwas anderes zu hören. »Du meinst, er ist mein echter Daddy?«
»Natürlich ist er das, Schatz.«
»Weißt du, ich hab mir nur gedacht, dass ich, weil du später geheiratet hast, einen anderen Daddy gehabt haben muss.«
»Ich weiß, Schatz«, sagte die Mutter sanft. Sie spürte den Schmerz des Kindes, teilte ihn sogar mit ihr. »Aber er ist dein Daddy. Wir hatten dich schon, bevor wir ans Heiraten dachten. Weißt du, er ist kein häuslicher Typ. Er möchte frei sein. Aber ich hab ihm gesagt, dass er mir und seinem Kind gegenüber eine Verantwortung hat. Zu der Zeit war Krieg, und wir haben gedacht, er würde eingezogen werden. Deshalb hat er mich geheiratet.«
»Ist Daddy im Krieg gewesen, Mummy?« Rachel wusste nicht genau, was ›Krieg‹ war, aber sie hatte aus den Gesprächen von anderen Leuten genug erfahren, um zu wissen, dass es so etwas wie eine Ehre bedeutet hatte, am Krieg teilgenommen zu haben. Vielleicht gab es ja doch noch etwas, das ihr an ihrem Vater gefallen konnte.
Aber Rachels Mutter sagte mit einem Seufzen: »Nein, Liebling. Dein Daddy fiel durch die medizinische Untersuchung. Er hätte etwas an den Lungen, hieß es. Weißt du, deshalb ist er manchmal so wütend. Denn alle anderen Männer zogen damals in den Krieg, nur er nicht.«
Dann fragte Rachel nach dem anderen Kind, und über das Gesicht ihrer Mutter fiel ein Schatten, obwohl am Himmel weit und breit keine Wolke zu sehen war. »Das andere Kind ist gestorben, Schatz«, sagte sie so leise, dass sie über den trockenen Wüstenwind kaum zu hören war. »Sie war deine Zwillingsschwester. Aber sie starb ein paar Tage nach deiner Geburt. Sie hatte ein krankes Herz.«
Danach nahmen ihr Bücher den Schmerz und die Enttäuschung; so, wie sie es immer taten. Rachel konnte sich nicht erinnern, wann sie das erste Buch gelesen hatte; sie konnte sich an gar keine Zeit erinnern, in der sie nicht gelesen hatte. Es war ihre Mutter gewesen, die eines Tages mit ein paar ausgeliehenen ›Dick and Jane‹-Büchern nach Hause gekommen war und ihrer Tochter das Lesen beigebracht hatte; aus der Schule wusste Rachel fast nichts. Es gab eine kurze Zeit in Lancaster, Kalifornien – auch eine unfruchtbare Wüstengegend –, wo sie in die erste oder zweite Klasse gegangen war. Wenigstens war sie dort nicht immer Zielscheibe des Spotts gewesen, wie sie es auf einigen anderen Schulen gewesen war, denn in der Mohavewüste waren die meisten anderen Kinder wie sie. Aber da hatte es die schreckliche Zeit gegeben, in der es ihrem Vater gelungen war, eine Arbeit in einer Tankstelle zu finden. Sie wohnten damals einige Zeit in einem Mietshaus, und Rachel ging in eine richtige Schule. Die Kinder dort machten sich über ihre nackten Füße und zu kurzen Kleider lustig. Ein Lehrer, der mit dem Kind Mitleid hatte, weil es nie ein Schulbrot mitbrachte und nie Geld für die Schul-Cafeteria zu haben schien, teilte eines Tages sein Essen mit ihr. Aber allein diese Demütigung brachte sie dazu, sich zu übergeben. Der Lehrer wurde wütend, als hätte sie es absichtlich getan, und teilte danach nie wieder etwas mit ihr.
Aber Rachel blieb nicht lange auf dieser Schule. Ihr Dad verlor wie gewöhnlich seinen Job und lebte das nächste Jahr von der Wohlfahrt und fluchte über die Regierung. In Bars zettelte er mit jedem Burschen, der eine Uniform trug, eine Schlägerei an.
Das Lesen – es war Rachels größte Fähigkeit und Gabe. Sie konnte nie verstehen, warum die Leute so viel Aufhebens darum machten. Schließlich ist es doch so: wenn einem etwas Freude bereitet, bleibt man dabei und wird natürlich gut darin. Und Bücher spendeten ihr Freude, so ziemlich die einzige Freude, die sie in ihrer Kindheit kennengelernt hatte. Mit jeder Stadt, in die sie zogen, mit jeder neuen Nachbarschaft und all den neuen Gesichtern, mit Angst vor dem neuen Ort, mit jedem Gebet, dass Daddy die neue Arbeit behalten würde und dass sie dort lange genug wohnen bleiben würden, damit sie dort Freundinnen kennenlernen könnte, mit jedem betrunkenen Nachhausekommen und dem Toben von Daddy über die Arschlöcher, die ihn gefeuert hatten, und dem unvermeidlichen Missbrauch ihrer Mutter – die Schreie und das Flehen aus dem Schlafzimmer –, mit jeder neuen Verzweiflung und Enttäuschung flüchtete sich Rachel in ein Buch.
Manchmal lasen sie und ihre Mutter gemeinsam. Sie saßen dann in dem kleinen Wohnwagen und lasen sich die Seiten abwechselnd vor. »Bildung ist Gold wert«, sagte ihre Mutter immer. »Ich will, dass du eine bessere erhältst, als ich sie jemals gehabt habe, Rachel. Ich will, dass du etwas aus dir machst und glücklich wirst.« Aber Mutter und Tochter lasen nicht nur wegen der Bildung, sondern auch, um sich abzulenken; sie halfen sich gegenseitig auf den Weg in die Phantasie, damit beide eine Weile vergessen konnten.
Aber es gab noch einen anderen Grund, weshalb Rachel vor der Realität floh. An dem Tag, an dem sie elf wurde, entdeckte sie den Grund dafür fast durch Zufall.
In einer Stadt, in der sie nur zufällig haltgemacht hatten, kämmte sie sich gerade in dem schmuddeligen Zimmer eines Motels, in dem sie kurzfristig wohnten, die Haare vor dem Spiegel. Ihre Mutter hatte in diesem Motel einen Job als Zimmermädchen bekommen, und während sich ihr Vater in der tristen Kleinstadt, die irgendwo zwischen Phoenix und Albuquerque lag, auf Jobsuche begab, war Rachel wieder einmal allein gelassen. Mit Hilfe einer Filmzeitschrift probierte sie gerade verschiedene Frisuren aus, als es sie plötzlich wie ein Schlag traf: sie war nicht hübsch. Mit Entsetzen stellte sie fest, dass sie völlig reizlos aussah.
Die Starfotos des Tages waren von Betty Grable und Veronica Lake. Rachel hielt deren Fotos neben ihr Gesicht und versuchte herauszufinden, was bei ihr verkehrt war. Die Liste, so erschien es ihr, war endlos: dicke Augenbrauen, platt anliegendes, glattes Haar, leicht fliehendes Kinn und – am schlimmsten von allem – eine unmögliche Nase.
Und als ob diese Entdeckung nicht schmerzlich genug gewesen wäre, als ob sie es bereits nicht selbst gewusst hätte, bemerkte ihr Vater eines Abends, nachdem er einen nervenaufreibenden Tag vergeblicher Jobsuche hinter sich hatte, im betrunkenen Zustand: »Mein Gott, das Kind wird immer hässlicher.«
Während der gesamten Kindheit verändert sich der Knochenbau bei Kindern und täuscht entsprechend; erst im vorpubertären Stadium entwickeln sich die Gesichtszüge mit einer gewissen Endgültigkeit. Vom sechsten Lebensjahr an war Rachels Gesicht genauso unentwickelt wie bei anderen Kindern auch – sie sah wie all die anderen Spielplatzbesucher aus. Aber mit elf Jahren erreichte sie das entscheidende Stadium, und ihr Gesicht nahm seine endgültige Form an.
Sie hatte eine merkwürdige Habichtsnase; wobei eine solche Nase bei einem Jungen durchaus gut ausgesehen hätte. Einem Mann hätte sie sogar zu einer draufgängerischen Erscheinung verholfen. Unglücklicherweise wirkte sie bei einer Frau, umso mehr bei einem Mädchen, schrecklich fehl am Platz. Und Rachel wusste das.
Die nächsten Monate beobachtete sie sich, hoffte und betete, dass es sich nur um eine Übergangsphase handeln und die Natur ihren eigenen Fehler korrigieren würde. Aber je mehr sie sich beobachtete, desto mehr wurde ihr klar, dass sie sich von nun an damit abzufinden hatte. Deshalb vermied sie es von nun an, in den Spiegel zu sehen. Als sie später den Winter in Gallup, New Mexico, verbrachten und eine freundliche Nachbarin mit Mrs Dwyer und deren unscheinbarer Tochter Mitleid empfand und anbot, den beiden eine Dauerwelle zu verpassen, protestierte Rachel so lautstark, dass die Dame beleidigt war und von da an die Dwyers mied. Aber Rachels Mutter zeigte Verständnis, und von dem Zeitpunkt an versuchte sie mit ihrer unbeholfenen, ungeübten Art, das Mädchen zu beruhigen und ihm die Liebe zu geben, nach der es sich so offensichtlich und verzweifelt sehnte.
Traurige Tatsache war, dass Mrs Dwyer in einer Zwickmühle aus Alkohol und Misshandlung gefangen war. Um ihren unmöglich zufriedenzustellenden Mann zufriedenzustellen, ging sie mit ihm in Kneipen, trank mit ihm gemeinsam zu Hause billigen Fusel und ließ sich von ihm unterdrücken. Mrs Dwyers Anwandlungen, ihre Tochter zu lieben, waren nur sporadisch, unvorhersehbar und häufig misslungen.
Aber es gab Menschen, die wussten, wie man Liebe zeigt, und die Rachel mit ihrer wahrhaften Liebe überschütten konnte – Menschen, die in Büchern lebten.
Sie pflegte alles zu lesen, was sie in die Hände bekam. Manchmal handelte es sich dabei um alte Filmzeitschriften oder eine weggeworfene Life oder Post, seltener um Jugendbücher. Aber Rachel las Nancy Drew, von der sie sämtliche Detektivgeschichten verschlang. Die örtliche Bücherei war der Zugang zu ihrer Phantasiewelt, und fast jeder Ort, egal, wie klein und schäbig er war, hatte eine Bücherei. Selbst die Wohnwagenkolonie, in der sie wohnten, als sie zehn war. Die Kolonie war von der nächsten wirklichen Stadt meilenweit entfernt und war lediglich eine Art Ansammlung von einer Tankstelle, einem Gemischtwarenladen und einer Kneipe. Aber in dem Büro der Wohnwagenkolonie stand ein Bücherregal. Wenn Leute fortzogen, ließen sie ihre stark abgegriffenen Bücher zurück, so dass die Leute, die neu hinzuzogen, ihre alten gegen ›neue‹ Bücher tauschen konnten. Es war eine Erfindung von Mrs Simmons, der alten Dame, die die Kolonie leitete, und Rachel hatte das Regal bald leergelesen.
Einsam und verunsichert, unscheinbar und hungernd nach Zuneigung, flüchtete sich Rachel in eine aufregende Scheinwelt. Sie nahm an den Abenteuern von Frank Slaughter und Frank Yerby teil; mit Mika Waltari und Lew Wallace zog sie über altertümliche Landstraßen; Vergewaltigung und unschuldige Liebe erlebte sie mit Pearl Buck; mit Asimov und Heinlein erforschte sie die Sterne. Es gab nichts, was Rachel nicht las; jedes Buch war auf seine Art lesenswert, bot seine ihm eigenen Fluchtwege, hatte seine Annehmlichkeiten und Freuden. Alle zusammen schufen sie die Phantasiewelt, die sie durchhalten ließ und ihr eine reine und vertrauensvolle Seele erhielt. Arthur Clarkes Weltraumbewohner waren gut und beherzt und heldenhaft; für Rachel Dwyer waren die, die nicht aus Fleisch und Blut waren, die einzigen, die sie immer lieben würde.
Obwohl sie gezwungenermaßen fast nur Bücher für Erwachsene las, blieb Rachel jedoch seltsamerweise merkwürdig naiv und weltfremd. In späteren Jahren kam sie zu dem Schluss, dass es so war, als habe ihr Verstand automatisch etwas herausgestrichen, sobald er mit irgendetwas konfrontiert wurde, das nach Realität roch oder zu sehr ins Schwarze traf. Rachel war neun, als sie Forever Amber las, aber als man ihr später dazu Fragen stellte, war sie nicht in der Lage, den genauen Grund von Ambers Untergang zu erklären. Rachel reichte es, dass Amber in einem romantischen Zeitalter lebte, altertümliche Gewänder trug und von schneidigen Männern umworben wurde. Die anderen Elemente – die uneheliche Schwangerschaft, die Schande und das Preisgegebensein – waren von Rachel völlig übersehen worden.
Wie sie später mutmaßte, war sie deshalb noch mit vierzehn sehr unschuldig und nicht vorbereitet auf das gewesen, was das Leben für sie bereithielt.
Es regnete. Eins von den Wüstenunwettern, die genauso plötzlich kamen, wie sie gingen. Im Innenraum des Wohnwagens lärmte es schrecklich.
Dieser Wohnwagen unterschied sich von dem, den die Dwyers gemietet hatten, als Rachel zehn gewesen war; seit damals hatten sie in fünf anderen gewohnt. Aber er unterschied sich nur unwesentlich und war ansonsten wie all die anderen: beengt, schmutzig, leicht nach einer Seite geneigt, heimgesucht von den Gerüchen und Enttäuschungen früherer Bewohner.
Ihr Dad war bereits den ganzen Tag unterwegs und betrank sich. Rachel betete, dass ihn der Regenguss den ganzen Abend von zu Hause fernhalten würde. Im Dämmerlicht einer flackernden, schwachen Glühbirne war sie gerade in Die Mars-Chroniken vertieft. Sie war hoffnungslos in Kapitän Wilder verliebt und wünschte sich, über den Himmel zu einem der Abhänge der altehrwürdigen Marskanäle zu fliegen. Ihre Mutter war zum Motel an der Landstraße gefahren, in dessen Büro ein neuer Fernsehapparat stand. Für die weit verstreut lebende Bevölkerung des südwestlichen Wüstenabschnitts sollte heute das Texaco Star Theater ausgestrahlt werden.
Nach drei Stunden der Lektüre war Rachel gezwungen, das Buch beiseite zu legen. Sie hatte Krämpfe, und ihr Bauch tat weh. »Es ist das, was wir Frauen ertragen müssen, Schatz«, hatte ihre Mutter ihr so behutsam wie möglich das Jahr zuvor, als Rachels Periode begonnen hatte, erklärt. Da sie die sechste und siebte Klasse versäumt hatte, war Rachel nicht in den Genuss von dem, was man Hygieneerziehung nannte, gekommen. Die Blutung hatte sie verängstigt; Mrs Dwyer hatte ihre Tochter eines Tages weinend angetroffen, und Rachel erklärte ihr, sie müsse sterben. Aber dann holte Mrs Dwyer ihre Packung mit Binden hervor und zeigte Rachel, wie man sie benutzte. Danach versuchte sie auf ihre unbeholfene Art, ihrer Tochter zu erklären, wozu das alles gut sei. »Schmerz scheint unser Los zu sein, Schatz. Frauen sind an Schmerzen gewöhnt. Wir haben sie unser ganzes Leben lang. Die schlimmsten Schmerzen sind das Kinderkriegen. Deshalb habe ich nach dir nie wieder eins bekommen.«
»Und warum?« hatte Rachel voller Unwissenheit gefragt. »Warum müssen wir Schmerzen ertragen?«
»Ich weiß es nicht. Soweit ich mich erinnern kann, steht dazu etwas in der Bibel drin. Ich glaube, es ist die Bestrafung für das, was Eva getan hat.«
»Was hat Eva getan?«
»Nun, sie verführte Adam zur Sünde, Schatz. Er war unbefleckt, und sie befleckte ihn. Seither müssen wir Frauen dafür bezahlen.«
Danach fuhr Mrs Dwyer nur zögernd fort, die Verbindung zwischen der Menstruation und dem Machen von Kindern zu ziehen, leistete aber keine gute Arbeit, da sie sich selbst nicht sonderlich um den weiblichen Körper und dessen Funktionen gekümmert hatte. Folglich hatte Rachel bei diesem vertraulichen Gespräch nur wenig dazugelernt.
An diesem stürmischen Abend jedenfalls, als sie ihr Buch beiseitelegte, um sich zwei Aspirin zu holen, hoffte sie insgeheim und schuldbewusst, dass ihre Mutter wegen des Sturms im Motel festgehalten wurde. Auf diese Weise konnte sie die ganze Nacht lesen und kostbaren Strom, den sich die Dwyers kaum leisten konnten, verbrauchen.
Als sie in die kleine, enge Kochnische ging, merkte sie, dass sie hungrig war. Die Schränke waren wie gewöhnlich fast leer, aber im Eisschrank lagen noch ein paar Reste. Auch wenn Mrs Dwyer eine unscheinbare, völlig ausgelaugte Frau war, die sich in ihrem Äußeren von keiner der anderen verzweifelten Frauen, die in der Wüste umherzogen, unterschied, so besaß sie doch eine Gabe, durch die sie sich von den anderen abhob: sie machte phantastische Hamburger. Das Rezept stammte von einer alten Frau, für die sie im Teenageralter das Haus geputzt hatte. »Das Geheimnis, Gerichte schmackhaft zu machen«, hatte die alte Dame gesagt, »liegt in den Gewürzen.« Mrs Dwyer hatte so gelernt, mit Estragon und Thymian, einer Prise Rosmarin und einem Hauch Paprika Hamburger zu einer Delikatesse zu machen. Über all die Jahre perfektionierte sie die Gewürzmischung sogar noch. Und wo immer die Dwyers umherstreiften, schwärmten die Leute von Mrs Dwyers Hamburgern.
Diese Fähigkeit hatte sich auf ihre Tochter übertragen. Und Rachel lief bei dem Gedanken, mit den Zähnen in einen saftigen, würzigen Hamburger mit Ketchup und einer Menge Senf zu beißen, das Wasser im Munde zusammen.
Während das Fleisch in der Pfanne brutzelte, las sie unter dem schwachen Herdlicht weiter in der Mars-Erzählung. Ein paar Minuten später, als der Mondschein Kapitän Wilder und seine Männer in einer toten Marsstadt ›umfing und gefangen hielt‹, hörte Rachel das Geräusch eines Autos, das sich dem Wohnwagen näherte.
Da sie glaubte, es sei ihre Mutter, dachte sie, Ma wird bestimmt frieren und durchnässt sein. Ich werde Wasser aufsetzen, und wir trinken zusammen Tee. Aber dann, bei dem Gedanken, dass es ihr Vater sein könnte, der von irgendeinem Saufkumpan nach Hause gefahren wurde, überkam Rachel schreckliche Angst.
Er hasste ihre Bücher. Ärgerte sich sogar über sie. Und Rachel wusste nicht, warum. »Es liegt an seinem Bildungsdefizit«, hatte ihre Mutter eines Abends erklärt, als er einen ganzen Schwung ausgeliehener Bücher aus dem Fenster geworfen hatte. »Er kam nie über die fünfte Klasse hinaus. Das ist ihm peinlich. Er sagt, dass er sich deshalb in keinem Job lange halten kann. Wenn er sieht, mit welcher Leichtigkeit du liest, dann …«
Rachel hatte die Feindseligkeit ihres Vaters ihr gegenüber nie verstanden. Ab und an sah sie während der Hausarbeiten – Abwaschen, Stopfen, Essenkochen – zu ihm auf und erkannte, dass er sie immer mit einem finsteren, schwer zu deutenden Ausdruck musterte. Meistens hatte er eine Dose Bier in der Hand oder, wenn der staatliche Unterstützungsscheck gekommen war, eine Flasche Whisky. Sie konnte sehen, wie er sie mit seinen wässrigen Augen beobachtete, und sie spürte dann, wie sie von einem unerklärlichen Schauder ergriffen wurde.
Er war ihr Vater, und trotzdem war er für sie merkwürdigerweise wie ein Fremder.
Sie hatten vierzehn Jahre zusammengelebt, aber sie kannte ihn nicht. Sie hatte ihm Essen gekocht, seine Kleidung gewaschen, ihn im Badezimmer urinieren gehört, und er war für sie so unbekannt geblieben wie irgendeiner der anderen Fremden an der Landstraße. Nach den Romanen zu urteilen, die sie gelesen hatte, hätte sie sein »kleines Mädchen« sein müssen, aber er schien von ihr keine Notiz zu nehmen. Er kam und ging wie ein geheimnisvoller Pensionsgast, wachte stöhnend und fluchend auf und begab sich wer weiß wohin, während ihre Mutter den Tag damit verbrachte, ängstlich auf die Uhr zu schauen und durch die Vorhänge zu spähen.
Tatsächlich war es erst zwei Jahre her, als Rachel, sie war gerade zwölf Jahre alt, klar wurde, dass ihre Mutter Angst vor ihm hatte; obwohl sie diese Tatsache schon damals nicht sonderlich überrascht hatte. Woran sich Rachel erinnerte, bereits als kleines Ding mit Windeln Zeugin gewesen zu sein, setzte sich mit erschütternder Regelmäßigkeit fort. Das Geräusch seiner Schuhe auf dem billigen Fußboden, das Schlagen der Schlafzimmertür, durch das der ganze Wohnwagen erschüttert wurde, und dann ihre Mutter, die ihn leise anflehte, allerdings ohne Wirkung, denn danach kamen immer die Schläge und schließlich das Schluchzen. Am nächsten Morgen hatte Mrs Dwyer dann blaue Flecken im Gesicht. Mr. Dwyer stampfte hinaus und kam möglicherweise drei, vier Tage nicht nach Hause. Und Rachel sah sich immer alles mit weit aufgerissenen, verständnislosen Augen an. Sie kam nie auf den Gedanken, dass sich die Situation ändern könnte, weil auch ihre Mutter einen solchen Gedanken nicht in Erwägung zu ziehen schien. Wenn sich ihre Mutter nicht gegen ihn wehrte, wollte es Rachel auch nicht tun.
Auf der anderen Seite hatte er sich nie an Rachel vergriffen.
Jetzt stand sie starr neben dem Herd und hörte, wie der Automotor mit dem peitschenden Regen harmonierte. Eine Tür wurde zugeschlagen. Jemand rief gute Nacht. Reifen rutschten im Matsch, und das stotternde Motorengeräusch entfernte sich. Fußschritte auf den Holzstufen. Schließlich wackelte der Türknopf.
Rachel hatte plötzlich Angst. War es wegen des Sturms? Oder war es, weil sie die Krämpfe hatte, weil sie zurzeit so weiblich und deshalb wehrlos war? Sie drängte sich mit dem Rücken gegen die kleine Küchenanrichte und beobachtete mit klopfendem Herzen die Tür. Sie wusste bereits, dass es nicht ihre Mutter war, die vom Motel nach Hause kam.
Die Tür sprang auf, und Rachel hielt den Atem an. Dave Dwyer schwankte einen Moment an der Türschwelle, dann fiel er mehr oder weniger hinein und schlug dabei hinter sich die Tür zu. Er schaute nicht zu Rachel hinüber, schien überhaupt nicht zu bemerken, dass sie da war. Durchnässt ging er zu einem Schrank, holte eine Flasche heraus und zog sich auf das verschlissene Sofa zurück.
Als er eins von Rachels Büchern wegstieß, sagte sie: »Fass das nicht an!« und bedauerte es im selben Augenblick.
Seine roten Augen richteten sich schließlich auf sie. »Was ist das?«
»Das … das ist ein Buch aus der Leihbücherei. Wenn ich es … beschädigt zurückbringe, muss ich es bezahlen.«
»Bezahlen! Was weißt du schon von Geld?« polterte er los. »Du bist nichts als ein Scheißparasit! Wenn du mich nich hättest, würdest du verhungern. Warum gehst du nich los und besorgst dir nen Job? Schließlich biste ein erwachsenes Mädchen!«
Rachel war sprachlos vor Entsetzen.
Er kniff die Augen zusammen, als sähe er sie zum ersten Mal. »Wie alt biste überhaupt?«
»Das solltest du wissen, Daddy.«
»Das solltest du wissen, Daddy«, äffte er sie nach. »Wie alt bist du?«
»V-vierzehn.«
Seine Augenbrauen schnellten hoch. »Is das wahr?« Er musterte sie von oben nach unten. Rachel war sich ihrer Shorts, der nackten Beine und der Bluse mit Bubikragen, an der ein Knopf fehlte, peinlich bewusst.
»Hast du einen Freund, Rachel?« fragte er sie völlig überraschend.
Einen Freund! Wie sollte sie Jungen kennenlernen, solange sie in diesem Wohnwagen den ganzen Tag eingesperrt war? Außerdem konnten Jungen mitsamt ihren Pickeln dem Vergleich mit Straßenräubern und römischen Zenturionen in keiner Weise standhalten.
Aus irgendeinem Grund machte ihn ihr Schweigen zornig. Oder war es vielleicht ihre Angst? Denn die Art, wie man seine Angst zeigt, kann Hunde reizen.
Er stand auf. Rachel drückte sich an der Anrichte entlang.
»Verdammte Scheiße«, knurrte er. »Ein Mädchen, das Angst vor seinem Vater hat.«
Sie versuchte, Mut vorzutäuschen, um Eindruck zu machen. »D-du kannst mich nicht einschüchtern.«
»Einschüchtern!« sagte er mit einem Lachen. »Mann! Hör dir das an. Sie benutzt nur große Worte! Du magst große Worte, stimmt’s, Kleine?«
Sie wich weiter zurück.
Er ging weiter auf sie zu.
»Mein Gott, bist du hässlich. Schau dich doch an!«
»Bitte, Daddy. Lasse das …«
»Nenn mich nich Daddy! Wie ich eine solch hässliche Hure wie dich in die Welt gesetzt haben soll, is mir bis heute ein Rätsel!«
Er stand jetzt dicht neben ihr, baute sich vor ihr auf, roch nach Alkohol und schwankte auf den Beinen. »Was für eine verwöhnte Hure du bist. Genau wie deine Mutter. Sie is ein solcher Fußabtreter, dass ich kotzen könnte! Und wo is meine liebevolle Frau heute Abend, he? Warum is sie nich hier, um auf mich zu warten und mich mit dem Nötigsten zu versorgen? Gott, ihr Frauen macht mich alle krank!«
Er griff nach Rachel. Das erste Mal verfehlte er sie. Sie sprang zurück; seine Finger streiften an ihrem Arm entlang. Aber er war standfester, als sie dachte. Als er das zweite Mal auf sie losging, ahnte er ihre Bewegung und packte sie schmerzvoll beim Handgelenk. »Warum sagste nich noch mehr große Worte, he? Es macht mich scharf, wenn du sie benutzt. Das macht mich schärfer als schmutzige Wörter.«
»Daddy!« Sie versuchte, sich loszureißen. Er packte sie beim anderen Handgelenk und schleuderte sie herum.
Der Regen prasselte auf das Blechdach des Wohnwagens. Es klang wie Maschinengewehrfeuer oder tausend Hagelschauer. Dann krachte ein Donner, und der Wohnwagen wackelte. Er wackelte auch, als Dwyer seine Tochter herumschleuderte und ihr mit einer Hand beide Handgelenke auf dem Rücken festhielt, während er mit der anderen an ihren Shorts zog.
»Du magst doch große Worte, nich? Du hast sie schon gern benutzt, bevor wir verheiratet waren. Erinnerst du dich daran, du Hure? Erinnerst du dich, wie du versucht hast, mich vor unseren Freunden zu beleidigen? Du mit deiner Collegebildung!«
»Nein, Daddy!« schrie Rachel. Sie wehrte sich, aber er hielt sie fest. Sie spürte, wie sich ihre Shorts über seiner kräftigen Faust spannten und wie er ihr die Hose über die Oberschenkel zerrte.
»Erinnerst du dich, wie ich das hier zum ersten Mal getan hab, he?« brüllte er. »Der Abend, als du mir gesagt hast, wir können keine Kinder mehr haben. Als du mich beschuldigt hast, weil wir das andere Kind losgeworden sind. Du verdammte Hure, wir haben das falsche behalten! Rachel is hässlich. Wir sind das falsche losgeworden! Gut, wenn du keine Kinder mehr haben willst, kann ich mich darum kümmern. Und hier is ein neues Wort, das du deiner beeindruckenden Wortsammlung hinzufügen kannst. Sodomie! Wie gefällt dir das, he?«
Schmerz.
Rachel schrie.
Die Tür sprang auf, und Regen peitschte herein. Der Donner krachte genau in dem Moment, als ein zweites Geräusch die Nacht erfüllte – ein Geräusch, als ob etwas leise zersprang, wie eine Wassermelone, die auf Pflasterstein aufschlug. Und dann ließ ihr Vater Rachels Handgelenke los; er sackte hinter ihr zusammen, und der Schmerz glitt aus ihrem Körper.
Instinktiv stürzte Rachel nach vorn und griff nach ihren Shorts. Schluchzend taumelte sie blindlings auf die schmale Schlafzimmertür zu; ohne zu denken, sich nur des Schmerzes bewusst, den er ihr zugefügt hatte. Ein Schmerz, der schlimmer war als Bauchkrämpfe oder Kinderkriegen und auch, das wusste sie, als Sterben.
Er hatte ihr das angetan. Er hatte ihr das angetan.
Als erneut Hände nach ihr griffen, wehrte sich Rachel wie eine verrückte Katze. Aber als sie die Stimme ihrer Mutter vernahm, die sagte: »Nein, Schatz! Ich bin’s!«, entspannte sie sich.
Für Rachel schien es einen Moment beruhigender Dunkelheit gegeben zu haben, dann öffnete sie die Augen und fand sich auf dem Sofa wieder. Ihre Mutter wusch sie sanft. Auf dem Küchenfußboden lag, ausgestreckt vor den unteren Schränken, ihr Vater.
»Ist er tot?« fragte Rachel.
»Nein, Schatz. Er ist nicht tot. Ich habe ihm eins mit der Bratpfanne übergezogen. Er lebt noch.«
Rachel begann zu weinen, leise und verbittert, das Gesicht in den Armen verborgen. »Warum hat er das getan, Ma? Warum hat er mir das angetan?«
Mrs Dwyer brachte zunächst kein Wort heraus. Sie sammelte die Handtücher und die Wasserschale ein und sagte: »Das wird wieder heilen. Nach ein paar Tagen wirst du nichts mehr davon spüren.«
Rachel schaute mit tränenverschmiertem Gesicht auf. »Und du lässt dir das gefallen! Die ganze Zeit schon!«
»Ich habe keine andere Wahl, Schatz. Ich muss mir das gefallen lassen.«
»Und ist es bei dir wieder geheilt?«
Mrs Dwyer drehte sich vor der Küchenspüle um und sah ihre Tochter an. Plötzlich hatte die verträumte Vierzehnjährige die Augen einer Erwachsenen. »Du verstehst mich nicht, Schatz. Zwischen einem Mann und seiner Frau gibt es Dinge, die …«
»Wenn er mein Mann wäre«, schluchzte Rachel, »würde ich ihn umbringen.«
»Sag so etwas nicht, Schatz. Du weißt einfach zu wenig davon.«
Rachel versuchte sich aufzusetzen, empfand es aber als zu schmerzhaft. »Warum bleibst du bei ihm? Er ist ein Scheusal.«
»Nein, das ist er nicht. Auf seine Art liebt er mich. Es gab Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, lange bevor du geboren wurdest …«
»Er hat gesagt, du hast das andere Kind weggegeben. Was hat er damit gemeint?«
Mrs Dwyer wurde blass. »Du meine Güte«, flüsterte sie. »Hat er dir wirklich davon erzählt?«
»Ma, ich habe das Recht, davon zu erfahren.«
Mrs Dwyer starrte ihre Tochter an und hörte, wie draußen der Regen nachließ, während der Sturm weiterzog. Dann setzte sie sich zu Rachel aufs Sofa.
»Schatz«, sagte sie sanft und legte die Hand ihrer Tochter in ihre. »Als ich dich im Krankenhaus bekam, waren wir am Ende. Wir hatten keinen Cent. Zu der Zeit gab es eine Wirtschaftskrise, und dein Dad … nun, du musst bedenken, dass er ein guter Mann war … früher einmal. Jedenfalls hatten wir unsere Zwillingskinder und kein Geld, um die Krankenhausrechnung bezahlen zu können. Eines Tages kam ein Mann ins Krankenhaus. Er sagte, er sei Anwalt, und er sagte auch, er kenne ein nettes Ehepaar, das sich nichts mehr wünschte, als ein kleines Mädchen zu adoptieren. Das Paar würde dafür tausend Dollar bezahlen, sagte er.«
Rachel starrte ihre Mutter fassungslos an.
Mrs Dwyer warf einen nervösen Blick auf ihren bewusstlosen Mann auf dem Küchenfußboden, dann fuhr sie leise fort: »Ich war dagegen. Aber dein Dad hat mich dazu überredet und gesagt, wir würden das Geld brauchen und dass das Kind in ein gutes Haus kommen würde. Wenn wir den Anwalt abweisen würden, so sagte er, hätten wir zwei Kinder und kein Geld, und er fragte mich, was für ein Zuhause wir ihnen bieten könnten. Er ließ mir keine Ruhe, Schatz, bis ich mich darauf einließ. Seit damals habe ich jeden Tag zu Gott gebetet, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe. Rachel, am liebsten stelle ich mir vor, dass deine Schwester in einem schönen, großen Haus wohnt und auf Partys geht …«
»Du … du hast meine Schwester verkauft?«
»So darfst du das nicht sagen, Rachel. Wahrscheinlich kannst du das nicht verstehen. Und außerdem …« – sie schaute wieder zu ihrem bewusstlosen Mann hinüber – »… musst du von hier sofort verschwinden. Du kannst hier nicht länger bleiben.«
Rachel wollte protestieren, wusste aber, dass ihre Mutter recht hatte. Als der Schock allmählich nachließ, begann Rachel zu weinen.
Mrs Dwyer umarmte ihre Tochter unbeholfen. »Hör mal zu, Schatz. Du musst jetzt stark und mutig sein. Du musst von hier fortgehen. Noch heute Nacht. Und versuch, so weit von hier fortzukommen, wie du kannst. Ich hab ein paar Dollar beiseiteschaffen können, von denen dein Vater nichts weiß. Genug für dich, um eine Weile davon leben zu können, wenn du sparsam bist. Fahr nach Kalifornien. Fahr nach Bakersfield. Dort kannst du im Christlichen Verein junger Frauen unterkommen. Es kostet nicht viel, und man wird sich dort um dich kümmern. Aber sag niemandem, dass du erst vierzehn bist, weil man dann die Polizei verständigen würde. Hier, das ist die Adresse einer Frau, die ich früher kannte. Sie besitzt einen Schönheitssalon. Du musst ihr sagen, dass du die Tochter von Naomi Burgess bist …« – sie faltete einen Zettel zusammen und steckte ihn in Rachels Geldbörse – »… dann wird sie dir eine Arbeit geben. Du wirst schon klarkommen. Du bist ein kluges Mädchen. Hör zu, gegen Mitternacht kommt ein Bus durch die Stadt, du kannst ihn noch erwischen.«
»Aber du kommst mit mir!«
»Nein, das kann ich nicht. Ich muss bei ihm bleiben.«
»Und dich mit seiner Brutalität abfinden?«
»Rachel, ich liebe ihn«, sagte sie leise.
»Wie kannst du das?«
»Du bist noch zu jung, um das jetzt zu verstehen, Schatz. Aber eines Tages wirst du dich verlieben, und dann wirst du verstehen, warum das alles so ist.«
Rachel saß eine ganze Weile schweigend da, fühlte die Demütigung und starrte auf den Mann, der ihr das angetan hatte.
»Du musst jetzt gehen«, sagte ihre Mutter mit neuem Nachdruck. »Er wird bald zu sich kommen.«
Rachel betrachtete sie mit ernstem Blick. »Was wird er dir antun, Ma?«
»Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme mit ihm klar.«
Rachel dachte wieder eine Weile nach, dann sagte sie: »Glaubst du, dass sie wie ich aussieht? Meine Schwester?«
Mrs Dwyer sah ihre Tochter verdutzt an. »Das weiß ich nicht, Schatz.«
»Wir sind Zwillinge.«
»Nun, es gibt zwei Arten von Zwillingen. Einmal gibt es die zweieiigen und dann die, die man eineiige Zwillinge nennt. Ich weiß nicht, warum, aber in einem der beiden Fälle sehen sich Zwillinge nicht unbedingt ähnlich. Ich weiß nicht, zu welcher Sorte ihr gehört.«
»Ich hoffe, sie ist hübsch«, sagte Rachel leise, »und nicht so hässlich wie ich. Und weißt du noch was, Ma? Ich werde nach ihr suchen.«
»O nein …« Mrs Dwyer wurde plötzlich von Panik ergriffen. »Warum willst du das tun?«
»Weil sie meine Schwester ist. Und wenn sie weiß, dass sie verkauft worden ist, dann könnte es sie vielleicht beruhigen, wenn sie erfährt, warum.«
Als sie die Sehnsucht und Einsamkeit in den Augen ihrer Tochter sah, wurde Mrs
Dwyer weich. Sie wusste von Rachels verzweifeltem Verlangen, jemanden zu lieben, zu jemandem zu gehören. Dieses Verlangen hatte sie selbst ihr ganzes Leben lang verspürt.
»Du bist in Kalifornien, in Hollywood, geboren worden, Rachel. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist sie noch dort. Ich werde dir alles erzählen, was ich von der Adoption weiß, allerdings ist das nicht viel. Los – du musst jetzt fort von hier.«
Fünfzehn Minuten später, ihr Vater lag noch immer auf dem Boden, stand Rachel mit einem ramponierten Koffer in der Hand vor der Tür. Auf ihm war ein P & O Sticker, aber das war ein Andenken von jemand anderem. Alles, was Rachel mitnahm, war das Foto von ihrer Mutter mit den beiden Kindern, ein paar Erinnerungsstücke, die sie in ihrer Kindheit gesammelt hatte, und das Buch Die MarsChroniken, gestohlen aus einer Leihbücherei.
In den Augen der beiden stand Schmerz; es war, als ob Rachel und ihre Mutter in denselben Spiegel schauten. Der Sturm war vorüber, die Nacht war ruhig. Die vierzehnjährige Rachel hatte keine Vorstellung, wohin sie gehen würde, aber sie sagte jetzt: »Ich werde zurückkommen, Ma. Ich werde meine Schwester finden, und wir werden zu dir zurückkommen. Wir werden Dad verlassen, und wir drei werden eine Familie sein. Ich werde für dich sorgen, Ma. Du wirst dich nie wieder …« – sie sah auf den leblosen Körper des Mannes, der ihr nie etwas bedeutet hatte, herab – »…damit abfinden müssen.«
Mrs Dwyer drückte ihre Tochter an sich und sah ihr mit tränennassen Augen hinterher, als Rachel ganz allein durch den Matsch auf die entfernte Landstraße zu stapfte.
5
Das Kleid war zwar hübsch, aber unbequem. Es drückte ihre Brüste nach oben und zwängte ihre Taille so fest ein, dass sie kaum atmen konnte. Nichtsdestotrotz gefiel Dr. Linda Markus ihr Aussehen in dem lebensgroßen Spiegel. Eine »Schönheit« aus der Vergangenheit: zerbrechlich, zierlich, ein anbetungswürdiges Objekt.
Mein Gott, dachte sie, Frauen haben sich früher einmal wirklich so gefühlt.
Sie entfernte sich vom Spiegel und sah sich im Zimmer um. Es hatte etwas von einem Traum. Die Satinvorhänge, das prachtvolle Bett, bedeckt mit einer dicken Steppdecke, passend zu den Satinvorhängen des Baldachins – alles in einem pfirsichfarbenen Ton gehalten. Der Plüschteppich, die fein vergoldeten Möbel, die Gemälde an der Wand und die Vasen mit frischen Blumen. Alles sehr feminin, alles sehr romantisch.
Tatsächlich war es dasselbe Zimmer, in dem sie erst eine Woche zuvor gewesen war, als ihr »Rendezvous« mit dem Fassadenkletterer durch einen Anruf aus dem Krankenhaus unterbrochen wurde. Seitdem hatte sie des Öfteren versucht, einen neuen Termin hier im Butterfly zu bekommen. Aber immer wieder waren Komplikationen aufgetreten. Erst war sie nicht erreichbar gewesen, und dann war ›er‹ nicht erreichbar gewesen.
Es war merkwürdig. Linda war sogar vorübergehend von Eifersucht geplagt worden, als sie erfahren musste, dass sie mit ihm nicht an jedem x-beliebigen Abend Zusammensein konnte. Zum ersten Mal in den Monaten, in denen sie das Butterfly aufsuchte, hatte sie sich über die Tatsache Gedanken gemacht, dass ihr Gesellschafter auch anderen Damen zu Diensten stand. Und zum ersten Mal hatte sie das Gefühl gehabt, ihn für sich ganz allein haben zu wollen. Rational sagte sie sich: Er ist ein bezahlter Liebhaber. Er kümmert sich auch um andere. Aber emotional ertappte sich Linda bei dem für sie selbst überraschenden Gedanken: Er ist mein. Er gehört mir.
Sie war mit diesem Gesellschafter bislang erst dreimal zusammen gewesen. Vor ihm hatte sie verschiedene andere gehabt – aber keiner von ihnen war zufriedenstellend gewesen, keiner von ihnen hatte ihr helfen können. Und dann hatte sie ›ihn‹ kennengelernt. Das war an dem Abend ihrer »venezianischen Phantasie« gewesen. Die früheren Einwohner von Venedig pflegten Masken zu tragen, wenn sie über den Markusplatz promenierten. Sie war auf diese Idee gekommen, nachdem sie den Film Amadeus gesehen hatte. Ein Mann, ganz in Schwarz – mit einem schwarzen Umhang und einer schwarzen Maske –, schlich sich in ihr Zimmer ein und war im Bett ganz hervorragend.
Nie zuvor war Linda so nahe an einen Orgasmus herangekommen.
Also hatte sie ihn sich nochmals gewünscht.
Beim zweiten Mal trat er als Straßenräuber auf. Verwegen und ungestüm, aber auch zärtlich. Er hatte sich ins Zimmer geschlichen, sie bei ihrer Handarbeit überrascht und geliebt. Auch diesmal war sie sehr nahe bis an den sexuellen Punkt gekommen, den sie noch nie in ihrem Leben erfahren hatte. Also hatte sie sich beim dritten Mal, als sie das Butterfly anrief und die Einzelheiten besprach, denselben Gesellschafter ausgesucht und ihn sich diesmal als Einbrecher gewünscht.
Aber diese Sitzung war von ihrem Signalgeber unterbrochen worden. Heute Abend sollte er in Form eines Offiziers der Konföderierten aus dem Bürgerkrieg erscheinen – zumindest in einer Konföderiertenuniform und maskiert, als wäre er auf einem Kostümball.
Unter allen Umständen bestand Linda darauf, dass ihre Männer maskiert waren. Sie wollte das Gesicht ihres Liebhabers nicht sehen. Genauso wenig konnte dieser ihr Gesicht sehen; die Maske saß jetzt richtig und schützte ihre Identität.
Sie schaute auf ihr Handgelenk, dann erinnerte sie sich, dass sie die Uhr abgelegt hatte. Denn für den heutigen Abend hatte sie beschlossen, ihrer Phantasie gänzlich freien Lauf zu lassen. Nachdem sie ihre Kleidung komplett abgelegt und das für sie bereitgelegte Kostüm angezogen hatte, hatte Linda ihre eigenen Sachen in das Ankleidezimmer gelegt und die Tür geschlossen. Das Schließen der Tür symbolisierte das Aussperren des modernen Zeitalters. Indem sie sämtliche Accessoires des Heute verleugnete – Handtasche, Uhr, Miederhöschen –, konnte sie sich leichter in das Gestern versetzen.
Das war notwendig, damit das Experiment funktionierte.
Aus Erfahrung wusste Linda, dass der Gesellschafter zu einem x-beliebigen Augenblick erscheinen konnte. Besonders bei diesen historischen Szenarien. Sie wusste, dass sich einige Clubmitglieder nicht mit Requisiten und Kostümen abgeben wollten. Sie fragten einfach nach einem bestimmten Model, nahmen sich ein Zimmer und kamen ohne theatralisches Drumherum sofort zum Sex. Andere, sie selbst eingeschlossen, genossen und brauchten dieses Schauspiel und dieses So-tun-als-ob.
Sie brauchte es, um von ihrem Problem befreit zu werden.
Deshalb war Linda auch hier im Butterfly, anstatt im Krankenhaus medizinische Fachzeitschriften zu lesen oder an ihrer Rede für das Bezirkstreffen der Ärztevereinigung zu schreiben. Normalerweise drehte sich Lindas Leben um ihre Arbeit; für gesellschaftliche Kontakte oder Freizeitaktivitäten ließ sie sich nur sehr wenig Zeit. Sie kam nicht aus purem Vergnügen ins Butterfly; sie war hier, um Hilfe für ihr Problem zu finden. Aber als eine sich selbst behandelnde Ärztin fiel es ihr schwer, sich von beruflicher Neugierde freizumachen, was nötig war, damit die Therapie anschlagen und ihr Problem kuriert werden konnte.
Sie schritt über den Plüschteppich, der Reifrock raschelte, und das flackernde Kerzenlicht warf auf die Gegenstände im Zimmer einen matten Glanz. Linda versuchte sich in die Rolle hineinzusteigern. Aber es gelang ihr nicht.
Wie viele Mitglieder trifft er am Tag? fragte sie sich. (»Wir sind hier alle Mitglieder«, hatte die Geschäftsführerin Linda während des Rundgangs erzählt. »Keine Besucherinnen oder Kundinnen, sondern Mitglieder. Und unsere Männer sind Gesellschafter.«) Wie oft kann ein Mann überhaupt an einem Tag aktiv sein? Egal, wie alt oder potent er ist? Wie oft kann er eine Frau befriedigen? Er muss ja nicht jedes Mal ejakulieren, sagte sie sich.
Sie versuchte, solche Gedanken zu verdrängen, zumal sie für ihr Vorhaben nicht sonderlich dienlich waren. Sie war hier, um geliebt zu werden und nicht, um die physiologische Logistik von Männern zu analysieren. Linda musste sich andauernd selbst ermahnen, ihre ärztliche Neugierde und ihr medizinisches Denken außen vor zu lassen, denn anders würde das Experiment niemals funktionieren.
Schritte im Flur!
Sie drehte sich um und starrte auf die Tür. Der Türknopf begann sich zu drehen.
Und plötzlich stockte Dr. Linda Markus der Atem. Sie vergaß alles. Sämtliche Gedanken verflüchtigten sich aus ihrem Gehirn, als sie sah, wie sich der goldene Türknopf drehte, als sie sich die Hand vorstellte, die ihn drehen konnte, den Mann, zu dem die Hand gehörte, diese straffen Muskeln, diesen kantigen Unterkiefer und diese tiefe, kultivierte Stimme.
Damals, beim allerersten Mal mit ihm – wer immer er war –, hatte sie fast, fast …
Die Tür schwang langsam auf. Sie zog den Atem ein.
Als erstes sah sie die blankpolierten Schuhe, dann einen langen Arm in einem grauen Ärmel mit gelben Stickereien. Schließlich unter einem Generalshut der Konföderierten ein maskiertes Gesicht, und eine sanfte, elegante Stimme sagte: »Wie geht’s, Ma’am?«
Durch all die Jahre der medizinischen Ausbildung hatte sie sich eine analytische Denkweise angewöhnt. Phantasieren fiel ihr schwer. Sie konnte sich nie von ihrem scharf sezierenden Verstand befreien, der ihr durch die medizinische Ausbildung mitgegeben worden war.
Mein Gott, ist er schön!
»Ich hoffe, ich störe Sie nicht, Ma’am«, drang seine Stimme sanft zu ihr herüber, als er die Krempe seines grauen Huts berührte. Und dann, gerade als sie erwartete, dass er zu ihr kommen und ihre Hand küssen oder irgendetwas Einstudiertes in dieser Art machen würde, überraschte er sie. »Finden Sie, dass sich ein Gentleman an der Bar selbst bedienen sollte?« fragte er.
Linda sah sich verdutzt um. Durfte er so etwas sagen? »Dort drüben ist ein Getränkewagen, ich denke …«
Er ging zu dem Wagen hinüber und nahm eine Karaffe heraus, die mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt war. Nachdem er etwas davon aus einem Kristallglas getrunken hatte, drehte er sich um und betrachtete Linda durch die Augenlöcher seiner Maske.
Schwarze Augen, umgeben von schwarzen Wimpern in einer schwarzen Maske.
Sie spürte, wie ihr Puls raste.
»Haben wir uns schon einmal früher gesehen, Ma’am?«
»Ich …« Es hatte ihr tatsächlich die Sprache verschlagen!
»Ich suche nach einer Freundin von mir. Ihr Name ist Charlotte. Kennen Sie sie zufällig?«
Linda war völlig perplex.
Berauschendes Rosenparfüm hing in der Luft. Das Licht der Kerzenleuchter schien sich zu bewegen, schien auf und ab und hin und her zu wogen. Linda merkte, wie sie von der romantischen Atmosphäre verschlungen wurde.
Aber alles ist nur gestellt!
Nichtsdestotrotz spürte sie, wie sie allmählich weich wurde. Und sie war froh. Sie wollte, dass der Zauber funktionierte …
Diese strahlenden, schwarzen Augen suchten nach keiner Frau namens Charlotte. Sie waren wegen ihr hier, wegen Linda Markus, die sich diesen Mann gewünscht hatte und die bereits begann, Besitzansprüche an ihn zu stellen.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine … wer ist Charlotte?«
Durch sein Lächeln wurde seine Maske leicht angehoben.
Im Gegensatz zu damals, als er die Skimaske getragen hatte, konnte sie diesmal die untere Hälfte seines Gesichts sehen. Und … er sah wirklich gut aus.
»Dann muss ich mich ins falsche Haus verirrt haben.«
Linda war verwirrt. Hatte man sie ins falsche Zimmer geschickt? Aber nein … das war eindeutig der Gesellschafter, den sie sich gewünscht hatte. Was dann …?
Mit dem Kristallglas in der Hand kam er auf sie zu. »Aber vielleicht macht es mir gar nichts aus, wenn ich Charlotte nicht finde«, sagte er leise.
Er kam näher und blieb direkt vor ihr stehen. Linda sah zu ihm auf. Wie konnte sie vergessen haben, wie groß er war? Und dann schlug ihr ein vertrauter Duft entgegen; ein schwacher Geruch – ein Hauch von einem Männerparfüm. Er hatte es die vorhergehenden Male benutzt. Wie hieß es doch gleich? Sie schien es zu kennen …
Eine Hand legte sich auf ihre Wange. Die langen Finger tasteten die Konturen ihres Gesichts ab, berührten ihre Lippen, streichelten ihre Augenlider. Nichts an ihm verriet Eile; sein Verhalten schien fast träge, als hätten sie die ganze Nacht füreinander Zeit.
»Lady, gestatten Sie mir, dass ich mich Ihnen als Gentleman vorstelle?« fragte er leise. »Mein Name ist Beau.«
Er neigte den Kopf und streifte mit den Lippen sehr sanft über ihren Mund.
Linda seufzte. Es war so perfekt. Keine Namen, keine Gesichter, sich nicht fragen, was er später davon halten würde, nichts von ihrem Problem erklären müssen, durch das schon zwei Ehen zerstört worden waren und jede neue Beziehung sofort abgebrochen wurde. Es war ihm nicht gestattet, sich zu wundern oder zu fragen. Er hatte nur das zu tun, wofür er bezahlt wurde, und sie geheilt nach Hause zu schicken.
Sie erwiderte seine Küsse.
›Beau‹ nahm sich Zeit. Langsam legte er den grauen Uniformrock ab und dann das graue Leinenhemd. Obwohl sie seinen athletischen Oberkörper schon zweimal zuvor gesehen hatte, verfehlte der erneute Anblick nicht seine Wirkung und verschlug Linda den Atem. Nicht zu muskulös, gerade genug, um Stärke zu verraten. Nicht zu stark gebräunt. Nichts an diesem schönen Mann war übertrieben. Selbst seine Küsse nicht, seine tastenden Berührungen, als ob sie zum ersten Mal zusammen wären. Wie oft hatte Linda beim ersten oder zweiten Treffen mit Männern, die täuschend rücksichtsvoll gewirkt hatten, die aufdringlichen, gierigen Küsse ertragen müssen, die Eile, mit der sie ihr den Slip herunterzogen, und die voreilige Gier bei einer Erektion, wenn sie noch nicht bereit war?
Sie bemerkte Beaus Erektion. Sie bemerkte sie durch Spitze und Satin und durch die Wolle der Hose seiner Konföderiertenuniform. Wieviel aufregender es war, das Geheimnis hinauszuzögern, sich eine Vorahnung aufzubauen, sie nicht zur Eile zu treiben! Von diesem Auftritt konnten andere Männer eine Menge lernen.
Aber dann wurde er plötzlich leidenschaftlich. Der Zeitpunkt war perfekt; es war genau der Moment, zu dem sie wollte, dass er sich beeilte, jetzt, da ihre eigene Erregung stieg. Sie atmete kaum; hielt sich an ihm mit Armen und Mund fest. Sie spürte auf dem Rücken, wie sich seine Finger an den Knöpfen des Kleides zu schaffen machten. Das Satinoberteil rutschte herunter, aber noch immer verbarg sich ihr Körper unter Spitze und Seide, Bändern und Korsett. Beau wusste auch, wie er diese Kleidungsstücke zu öffnen hatte, schnell und fachmännisch, während er sie dabei die ganze Zeit küsste, an sich herandrückte und sich in sie hineindrängte.
Und dann trug sie nur noch den Petticoat. Plötzlich hob er Linda hoch, trug sie zum Bett und legte sie behutsam hin, küsste fortwährend ihr Gesicht, ihren Hals und ihre Brüste. Sobald sie stöhnte, verweilte er dort, an ihren Brustwarzen, brachte sie dazu, sich mit ihrem Körper zu winden, bis sie schließlich hervorstieß: »Jetzt …«
Er zog sich Stiefel und Hose aus. Aber als er nach der Kordel ihres Petticoats griff, hielt sie ihn zurück.
Also lag er auf ihr, küsste und streichelte sie, steigerte ihre Erregung. Als seine Hand zwischen ihre Beine glitt, führte Linda sie wieder wortlos nach oben. Als er in sie eindrang, zurückhaltend, ohne sie zu berühren, gerade ausreichend, um hineinzugleiten, vergrub er sein Gesicht nicht in ihrem Hals, sondern blieb auf die Ellbogen gestützt, so dass er sie durch seine schwarze Maske hindurch ansehen konnte. Linda war von diesen schwarzen, durchdringenden Augen wie gefangen. Als sie, mit den Körpern verbunden, zusammen auf und ab schaukelten, ließ sie dieser Blick nicht mehr los.
»Komm«, hauchte sie. »Beau, bitte komm.«
Aber er bewegte sich nur langsam – in einem traumhaften, überwältigenden Rhythmus. Linda verschränkte ihre Arme um seinen Hals; sie schlang die Beine um seine Oberschenkel. »Komm!« flüsterte sie. »Bitte. Beeil dich.«
Sie glaubte eine Spur von Verwirrung in den maskierten Augen zu erkennen. Dann verwandelte sich sein Körper. Er bewegte sich jetzt schnell, ungestüm. Er schloss die Augen. Er konzentrierte sich.
»Ja!« hauchte sie heiser. »Ja!«
Schließlich zitterte er und stöhnte und zog sie so stark an sich heran, dass Linda einen Augenblick lang nicht mehr atmen konnte.
»Hatten Sie einen Orgasmus?« fragte die Psychoanalytikerin, während Linda auf und ab lief.
»Nein, und das wissen Sie auch. Verdammt.« Linda blieb stehen und blickte auf Dr. Virginia Raymond, die in einem Korbsessel saß und deren Silhouette sich gegen den atemberaubenden Hintergrund von Los Angeles abhob. »Es ist jedes Mal dasselbe«, fuhr Linda fort. »Das Vorspiel ist phantastisch. Aber ich halte mich zurück. Ich kann nichts dagegen tun. Egal, was er macht, egal, wie erregend es für mich ist, ich reagiere nicht von innen heraus. Ich mache alles völlig mechanisch. Ich rede, ich bewege mich, ich sag ihm, was ich will. Und dann … nichts. Und sobald es vorbei ist, spüre ich wieder diesen Unmut in mir aufkommen.«
»Unmut gegen wen oder was?« fragte Dr. Raymond.
Linda lächelte die Psychiaterin an. »Ich weiß nicht recht. Vielleicht gegen die Ärzte, die an mir so viele Operationen vorgenommen haben, als ich noch klein war. Möglicherweise hat auch der Topf mit dem kochenden Wasser das Trauma verursacht. Vielleicht sogar meine Mutter. Oder all die Männer, die nicht lange genug mit mir zusammenbleiben wollten, um mich von meiner Frigidität zu heilen. Die ganze Welt, fürchte ich.« Sie blieb an dem Panoramafenster stehen und blickte hinaus. Es war ein wunderschöner Januartag in Südkalifornien. Der Ozean, perlmuttfarben und blau, breitete sich im Hintergrund aus, wobei hellgrüne Palmen und schaumige Wolken das makellose Bild vervollständigten. Unten auf der Straße war eine riesige Reklamefläche angebracht, auf der das bekannte Gesicht des Mannes abgebildet war, der die »Bewegung für moralischen Anstand« gegründet hatte. Linda hatte ein paarmal seine Stunde der frohen Botschaft gesehen. Zweifellos war der Reverend ein charismatischer Redner. Sie hätte nie erwartet, dass ein fundamentalistischer Christ eine solch breite Gefolgschaft für sich gewinnen konnte. Die Meinungsumfragen hatten ergeben, dass der Reverend gute Chancen besaß, im Juni die Vorwahl zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu gewinnen.
Sie ging zu einem Korbsofa und machte es sich dort zwischen den rotorangefarbenen Kissen gemütlich. Dr. Raymonds Büro wirkte friedlich, eine gartenähnliche Zuflucht inmitten der hektischen Großstadt. Linda kam seit fast zehn Jahren hierher.
»Ich möchte nichts lieber als mit jemandem mein Leben teilen«, sagte Linda gefasst. »Ich lebe nicht gern allein. Ich würde gern einen Mann und Kinder haben. Wissen Sie, ich habe damals alles versucht, damit diese beiden Ehen funktionierten. Wirklich alles.«
Dr. Raymond nickte. Dr. Linda Markus war zum ersten Mal zu ihr gekommen, als ihre erste Ehe im Scheitern begriffen war. Lindas Mann hatte behauptet, nicht mehr in der Lage zu sein, ihre Spätschichten im Krankenhaus oder ihre Abberufungen bei Notfällen zu tolerieren. »Er sagt, dass er wenigstens ein einziges Mal einen Film mit mir ganz bis zu Ende sehen möchte«, hatte Linda damals gesagt. Aber sowohl Linda als auch Dr. Raymond kannten den wahren Grund für seinen Scheidungswunsch, und der hatte nichts mit ihrer Arbeitszeit zu tun. Der Grund war Lindas Frigidität.
Und vier Jahre später hatte dann ihr zweiter Ehemann dieselben Worte benutzt und erklärt, er habe es satt, dass sich Lindas Signalgeber andauernd in ihr Privat- und manchmal auch Liebesleben einmischte. Und wieder kannten Linda und ihre Psychiaterin den wahren Grund für seinen Wunsch, sich von ihr zu trennen.
Diese zweite Ehe hatte bloß elf Monate überdauert. Von da an hörte Dr. Raymond von Linda nur noch von kurzen Bekanntschaften, die allesamt im Sande verliefen, bis es Linda schließlich ganz aufgab.
Linda schaute auf die Uhr. Als sie zuvor den Fernsehproduzenten zurückgerufen und erfahren hatte, dass Barry Greenes Büro im selben Gebäude wie das ihrer Psychiaterin war, hatte Linda mit ihm einen Termin abgemacht, der ihrer wöchentlichen Sitzung bei Dr. Raymond vorangegangen war.
»Er hat gesagt, er habe einen Job für mich«, hatte Linda am Anfang der Sitzung gesagt. »Einen Job! Als ob ich nicht schon genug am Hals hätte!«
»Aber Sie werden ihn trotzdem annehmen?« fragte Virginia Raymond.
»Ich war geschmeichelt, dass er mich wollte. Und es ist natürlich eine aufregende Vorstellung, in einem Studio zu arbeiten und Fernsehstars zu sagen, wie man einen Arzt spielt. Ich hab ihm ganz ehrlich gesagt, dass ich seine Fernsehserie nie gesehen hab. Aber Freunde haben mir erzählt, dass Five North einer der größten Fern
seherfolge ist. Er will mich als technische Beraterin. Ich halte das für eine ziemliche Herausforderung.«
»Und das, obwohl Sie bereits nichts mehr in Ihrem Terminkalender unterbringen können.«
Dann hatten sie Lindas Problem in Angriff genommen. »Sie wissen, warum ich mein Leben so vollstopfe, Virginia«, sagte Linda leise. »Es hält mich davon ab, in dieses einsame Haus zurückkehren zu müssen, in dem ich andauernd daran erinnert werde, dass ich achtunddreißig Jahre alt bin und mir mehr als alles andere eine Familie wünsche. Aber um eine Familie zu bekommen, brauche ich einen Mann, und um einen Mann zu bekommen, muss ich an meinem verdammten Schlafzimmerproblem arbeiten. Hören Sie …« Linda rutschte an die Sofakante und sah die Psychiaterin ernst an. »Ich möchte mich so gern von diesem Problem befreien und normal sein, dass man glauben sollte, die Heilung sei ganz leicht.« Linda stand auf und lief wieder auf und ab. »Ich kann so nicht weiterleben, Virginia. Das Krankenhaus darf nicht mein ganzes Leben bestimmen, nur damit ich die Tatsache meines Alleinseins ignorieren kann. Deshalb habe ich mich damals entschieden, etwas dagegen zu unternehmen, mich meinem Problem zu stellen und zu versuchen, es zu überwinden. Und als mir meine Freundin Georgia von diesem Club namens Butterfly erzählt hat und wie dieser auch ihr geholfen hatte, beschloss ich, es auf einen Versuch ankommen zu lassen.«
»Und hat es irgendetwas genützt?«
»Ich bin mir nicht sicher. Ich scheine nicht völlig in der Phantasie aufgehen zu können. Ich denke, wenn ich das schaffen könnte – wenn ich nur wenigstens für kurze Zeit jemand anders sein könnte –, dann könnte ich mich vielleicht ein für alle Mal dieses Stigmas entledigen.«
»Und Sie meinen, die Phantasie wird Ihnen dabei helfen?«
»Ich habe mir gedacht, wenn ich jemand anders sein könnte, könnte ich meine sexuelle Blockade überwinden. Als Marie Antoinette könnte es bei mir im Bett vielleicht funktionieren! Ich weiß es nicht. Aber das Problem ist, dass ich es derart gewohnt bin, jede Situation zu bestimmen und unter Kontrolle zu haben, dass ich mich anscheinend nicht gehen und meiner Phantasie keinen freien Lauf lassen kann.«
Linda wandte sich vom Fenster ab und sah ihre Psychiaterin aufmerksam an. Virginia Raymond versuchte seit Jahren, Linda bei ihrem Problem zu helfen – ein Problem, das durch einen Unfall in Lindas Kindheit hervorgerufen worden war und deshalb nicht rein psychologisch zu begründen war –, und sie hatte Linda in ihrer Entscheidung, dem Butterfly beizutreten, bekräftigt.
»Es könnte gefährlich sein«, gab sie damals zu bedenken, »denn möglicherweise werden Sie dort nicht das finden, wonach Sie suchen.«
Aber Linda hatte geantwortet: »Das Risiko will ich auf mich nehmen. Herausforderungen machen mir keine Angst.«
»Was halten Sie von den Masken?« fragte Linda jetzt. »Werden sie hilfreich sein?«
»Wie ich Ihnen schon zuvor gesagt habe, Linda: Wenn Sie sich nicht entspannen können, werden Sie nie Spaß am Sex haben. Das Tragen einer Maske liefert Ihnen diese notwendige Entspannung. Es gestattet Ihnen, sich an jedem Psychodrama zu amüsieren, das Sie sich vorstellen, sei es mit einem Einbrecher oder einem Konföderierten-Offizier. Die Maske unterdrückt Ihr eigenes Ich als Dr. Linda Markus, und ein anderes Ich gewinnt die Oberhand. Sie haben Angst vor dem Sex, Linda, oder vielmehr haben Sie Angst, während des Sex wegen Ihrer Narben abgewiesen zu werden. Die Überwindung der Angst ist einer der entscheidendsten Schritte, um Sex genießen zu können.«
»Aber wird es funktionieren?«
»Sie müssen sich gedulden. Und Sie müssen lernen, sich zu entspannen.«
Linda verstummte. Sie war bereits dabei, sich geistig das nächste Szenarium vorzustellen – mit ihrem maskierten Liebhaber.