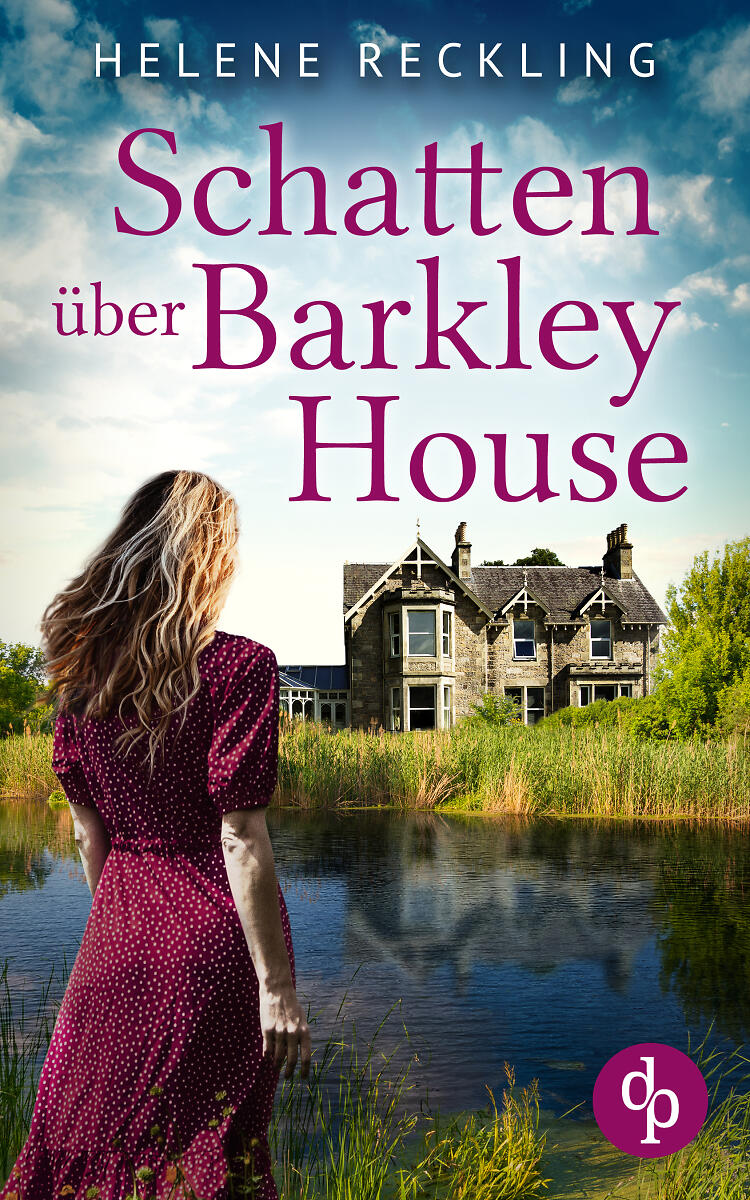Prolog
Adamsville, Juli 1910
Ein angenehm milder Abend folgte auf einen drückend heißen Sommertag. Der Wind trug die Klänge des Festes, zarte Melodien, dargeboten von einem Streichquartett, fröhliche Stimmen und heiteres Lachen zu dem geöffneten Fenster im ersten Stock hinauf.
Dort oben, verborgen hinter den Gardinen, stand eine junge Frau und beobachtete das muntere Treiben.
Die Nachbarn feierten mit beinahe einhundert geladenen Gästen die Verlobung ihres Sohnes Bernard Jacob Barkley mit Miss Dorothea Ann Parker. Deren sanftes, mildtätiges Wesen, ihre Lieblichkeit und Schönheit sowie sein geschäftlicher Erfolg, seine Großherzigkeit und attraktives Äußeres machten sie für viele in der Gegend zum unumwundenen Traumpaar. Sie trugen ihre Liebe offen zur Schau, was diesen Eindruck nur noch verstärkte. Doch sie machte diese unentwegte Turtelei nur krank!
Schon als die kunstvoll gestaltete Einladung auf feinstem Papier mit goldenen Verzierungen vor einigen Wochen eintraf, stand für sie fest, dass sie um nichts in der Welt daran teilnehmen würde.
Eine Magenverstimmung vortäuschend hatte sie sich entschuldigt. Den Blicken nach zu urteilen, die ihre Eltern am Nachmittag bei dieser Ankündigung tauschten, wussten sie genau, dass es nur eine Ausrede war. Trotzdem wünschten sie ihr gute Besserung und versprachen, am nächsten Tag genauestens zu berichten.
Sie fauchte wie ein erbostes Kätzchen. Darauf konnte sie verzichten.
Bernard würde mit diesem Mädchen niemals glücklich werden. Sollte es sich als erforderlich erweisen, würde sie höchstpersönlich dafür sorgen. Als sie das so verliebt wirkende junge Fräulein im Garten erblickte, krampfte sich ihre Hand um das vierblättrige Kleeblatt, das sie aus dem Tischgesteck gezupft hatte und zerquetschte es. Sie öffnete die Hand und betrachtete es. „So wird es dir auch ergehen, Dory!“
Damit ließ sie es achtlos zu Boden fallen und wandte sich angewidert vom Fenster ab.
Rätselhafte Träume
Worlington, März 2014
Das blasse, abgespannte Gesicht mit den müden, traurig blickenden blauen Augen, das Diane Danson aus dem Spiegel ihrer Frisierkommode entgegensah, hätte auch einer Fremden gehören können. Die ständige unerklärliche innere Unruhe sowie die unbestimmte Vorahnung drohenden Unglücks, die sie seit einiger Zeit quälten, forderten unübersehbar ihren Tribut.
Ihr sanftes Lächeln und das Strahlen ihrer Augen zeigten sich immer seltener. Stattdessen schien sie zumeist besorgt und in sich zurückgezogen, als fürchte sie sich vor etwas. Doch wie konnte man sich vor etwas fürchten, dem man keinen Namen geben konnte?
Diane schob eine ihrer langen, dunkelblonden Strähnen hinter das Ohr und betrachtete dieses erbärmliche Wesen im Spiegel forschend. So sehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr nicht zu sagen, was es war, das sie so mitnahm.
Nun ja, sie arbeitete viel, doch nicht mehr als gewöhnlich. Ihre Ausflüge ins Nachtleben waren nicht erwähnenswert. Gelegentlich ging sie mit Freunden ins Kino oder essen, doch das hatte Seltenheitswert. Gerade in letzter Zeit.
Und gewiss zählte sie nicht zu den Frauen, die sich auf ein schnelles Abenteuer einließen. Also verbrachte sie ihre Nächte auch nicht mit zügelloser Leidenschaft. So bedauerlich das auch sein mochte. Was genau raubte ihr dann die Seelenruhe?
Mit gleichmäßigen Zügen bürstete sie ihr Haar und dachte darüber nach, kam jedoch auch jetzt zu keiner Erkenntnis.
Nachdem ihr Haar ordentlich geflochten und ihr Gesicht eingecremt war, erhob sie sich und ging zu ihrem Bett hinüber.
Wie an jedem Abend schlug Diane die Decken zurück, schüttelte die Kissen auf und setzte sich auf die Bettkante, um einen Augenblick das Gemälde über ihrem Bett zu bewundern. Es zeigte einen See an einem schönen Herbsttag. Die Bäume, die das andere Ufer säumten, zeigten sich so farbenprächtig, wie man es von einer Landschaft in Neuengland um diese Jahreszeit erwartete. Sie schimmerten in reichen Gelb-, Orange-, Braun- und Rottönen. Der See lag vollkommen ruhig da. Ein kleiner, von Schilf umgebener Steg ragte ein Stück in das Gewässer hinein. Über der Szenerie hing ein Himmel von sanftem Blau mit einigen kleinen weißen Wolken.
Von dieser Idylle ging eine beruhigende Wirkung aus, der sich Diane von jeher nicht hatte entziehen können. Die Erinnerung an den Tag, an dem sie es auf Tante Adeles Dachboden entdeckt hatte, zauberte ein Lächeln auf ihre Lippen. Sie waren dort hinaufgestiegen, um zu sehen, ob sich nicht etwas finden ließe, das man der Wohlfahrt spenden konnte. Stattdessen hatte die kleine Diane das Gemälde völlig verstaubt und mit ramponiertem Rahmen in einer Ecke entdeckt. Tante Adele schien seinem Zauber gegenüber nicht minder erlegen zu sein, denn zunächst betrachtete sie es sehr lange, bevor sie ihrer Großnichte versprach, es aufarbeiten zu lassen. Tatsächlich überreichte die alte Dame dem Mädchen das Bild in einem restaurierten Rahmen zum nächsten Geburtstag.
Damals wie heute erschien es Diane als das höchste Glück, nur ein einziges Mal am Ufer dieses malerischen Sees spazieren zu gehen. Die Erfüllung dieses Wunsches lag außerhalb Tante Adeles Möglichkeiten, doch in Dianes Träumen sei alles möglich, lautete der weise Rat der alten Dame.
Nach einem letzten sehnsüchtigen Blick kroch Diane unter die Decken und schaltete das Licht aus.
Es war Mitte März und noch recht kühl. Immer wieder tobten Frühlingsstürme. So konnte sie auch jetzt den Wind heulen hören. Schaudernd zog sie die Decken bis unter das Kinn. Zwar zeigte der Radiowecker auf dem Nachttisch erst kurz nach zweiundzwanzig Uhr an, doch konnte sie ihre Augen nicht länger offenhalten. So ging das nun schon seit Wochen. Wie auch schon seit Wochen, dauerte es nicht lange, bis sie träumte.
Die junge Frau stand in einem gepflegten, weitläufigen Garten. Es war früher Abend, der große Sonnenball sank langsam dem Horizont zu. Er war bereits zur Hälfte hinter den Wipfeln der alten Eichen verschwunden. Damit erzeugte er eine Farbenpracht und ein Lichterspiel, die sie immer wieder aufs Neue faszinierten.
Hoch über ihr in den Bäumen zwitscherten die Vögel noch immer munter ihr Lied. Der sanfte Abendwind umspielte die Frau. Diese legte ihre Hände sacht über ihren runden Bauch und schritt langsam weiter den breiten Gartenweg entlang. Ihr langer, brauner Rock raschelte bei jeder Bewegung. Ihr kastanienbraunes Haar trug sie ordentlich aufgesteckt und nur wenige Löckchen umrahmten ihr schmales, blasses Gesicht. Verträumt summte sie vor sich hin. Tief in Gedanken versunken bemerkte sie nicht, dass sich ihr ein junger Mann von etwa dreißig Jahren näherte. Er trat auf sie zu und berührte vorsichtig ihren Arm. Erschrocken zuckte sie bei seiner Berührung zusammen. „Entschuldige, Liebes. Ich wollte dich nicht erschrecken.“ Er nahm ihre Rechte und hauchte einen Kuss darauf. Anschließend richtete er sich wieder auf und legte sie lächelnd in seine Armbeuge.
„Es ist schon gut, mein Lieber. Ich war so in meinen Gedanken gefangen, dass ich alles um mich herum vergessen habe.“ Ein liebevolles Lächeln begleitete ihre Worte.
Er überragte sie um gut einen Kopf und war breit und kräftig gebaut. Ein Mann, der trotz seines Standes mit harter Arbeit sehr vertraut war. Er trug eine hellgraue Hose, ein weißes Hemd mit aufgeschlagenen Ärmeln und eine ebenfalls hellgraue Weste.
„Weißt du, Liebes, ich habe mich in dich verliebt, weil du deinen Kopf nicht nur zum Frisieren benutzt, doch es gefällt mir nicht, wenn du so viel grübelst. Genieße dein Leben! Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Nie wieder. Du bist jetzt die Frau eines angesehenen Geschäftsmannes und führst ein privilegiertes Leben.“ Die Schwangere nickte, wirkte jedoch nicht überzeugt. „Was ist es denn, das dich so beschäftigt?“ Er löste ihre Finger von seinem Arm, legte ihr einen Arm um die Taille und zog sie eng an sich.
„Ich weiß es nicht genau. Es ist mehr so ein Gefühl. Als würde uns etwas Furchtbares bevorstehen. Ich kann es dir nicht anders beschreiben, lieber Bernard. Ich weiß es einfach nicht!“ Ihr Blick wanderte unruhig umher und sie machte eine vage Handbewegung.
„Es ist schon gut, Dorothea. Was sollte uns schon geschehen? Wir leben in einem wunderbaren Haus, weit ab vom Trubel der Großstadt, wir besitzen mehr Geld, als wir jemals ausgeben könnten und am wichtigsten ist: Wir haben einander! Und um das alles noch zu übertreffen, bald hoffentlich auch einen gesunden Stammhalter.“ Bernard küsste seine Frau auf den Scheitel, strich über die Wölbung ihres Bauches und lächelte sie aufmunternd an.
„Du hast ja recht! Ich weiß auch nicht, was mit mir ist.“ Sie seufzte und ließ ihren Kopf schwer gegen seine Brust sinken.
Bernard blieb stehen und drehte sie zu sich, sodass sie ihn ansehen musste. Seine Hände ruhten auf ihren Schultern und er betrachtete sie aufmerksam. Sie war blass und wirkte so zerbrechlich und hilflos. Ihr fest in die Augen blickend sagte er: „Dorothea, glaube mir, ich würde niemals zulassen, dass dir oder unserem Kleinen etwas zustößt! Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um jeden Schaden von euch fernzuhalten! Und wenn ich mein Leben dafür hergeben muss! Ich liebe dich, Misses Barkley!“ Damit zog er sie an sich und küsste sie.
Für einen Augenblick gelang es Dorothea, ihre düsteren Gedanken zu vergessen. Sie lehnte sich an ihren Mann, legte ihre Arme um seine Taille und ergab sich seinem Kuss. Nach einem atemberaubenden Moment beendete sie diesen und sagte mit leiser Stimme: „Lass uns zum Abendessen hineingehen. Sonst wird uns unsere liebe Elsie schrecklich zürnen.“
Bernard riss in gespieltem Schrecken die Augen auf und sagte, die Rechte aufs Herz gepresst: „Oh nein! Da sei Gott vor!“
Die Eheleute lachten, wandten sich um und gingen Arm in Arm auf ihr wunderschönes, zweistöckiges Landhaus zu. Unter den Fenstern im Erdgeschoss blühten Rosensträucher, die ihren lieblichen Duft verströmten.
Das Paar schritt einige Stufen empor und betrat die große, geflieste Terrasse, wo es bereits von einem gedeckten Tisch erwartet wurde.
Die junge Dorothea schloss kurz die Augen und atmete den süßen Duft der Rosen und das kräftige, würzige Aroma der Speisen vor ihr tief ein. Als sie die Augen wieder öffnete und den Blick ihres Mannes sah, den er ihr über sein Weinglas hinweg schenkte, errötete sie. Sie senkte den Blick und widmete sich mit Hingabe dem Abendessen.
Als Diane erwachte, glaubte sie immer noch den Duft der Rosen wahrzunehmen. Er schien ihr gesamtes Schlafzimmer zu erfüllen. Sie spürte ein Kribbeln im Bauch, als hätte sie Bernards Zärtlichkeiten selbst erfahren und nicht nur davon geträumt. Ihr Herz pochte heftig und sie fühlte sich schwindelig. Verwirrt schüttelte sie den Kopf und blickte zu ihrem Wecker hinüber. Es war gerade einmal halb eins. Sie konnte doch noch so lange schlafen. Es war Wochenende und sie musste morgen früh nicht ins Büro. Also ließ sie sich in die Kissen zurücksinken und versuchte wieder einzuschlafen. Als es ihr endlich gelang, wurde ihr Schlaf erneut von wirren Träumen von Dorothea und ihrem Mann Bernard heimgesucht. Was hatte das zu bedeuten?
Am Morgen wurde Diane gegen acht Uhr von einem frenetischen Klingeln an der Haustür geweckt. So sehr sie sich auch bemühte es zu ignorieren, gelang es ihr nicht. Genervt warf sie die Bettdecke von sich, erhob sich und stapfte zur Tür. „Nicht mal am Wochenende hat man seine Ruhe!“, grummelte sie dabei vor sich hin.
Vor der Tür stand aufgeregt auf und ab hüpfend ihre drei Jahre jüngere Schwester Millie. Ihr hübsches, rundes Gesicht glühte förmlich und sie fiel ihrer Schwester laut jubelnd um den Hals.
„Millie! Was machst du denn hier? Ich dachte, du wolltest das Wochenende mit deinem Liebsten verbringen.“ Diane befreite sich aus der Umarmung und trat einen Schritt zurück.
„Jeff hat mich gebeten, seine Frau zu werden und ich habe Ja gesagt! Ich werde heiraten, Di!“ Millie hielt Diane ihre Linke mit dem recht protzigen Verlobungsring hin.
„Das freut mich für dich, Kleines! Jeff ist wirklich ein netter Typ und ich weiß, dass er dich gut behandeln wird.“ Diane drückte ihre kleine Schwester, die sie um einen halben Kopf überragte, fest an sich. Sie hoffte inständig, dass Millie mehr Glück in der Ehe haben würde als es ihr vergönnt gewesen war.
Millie schwenkte einen kleinen Karton vor Dianes Nase und erklärte: „Ich habe Frühstück mitgebracht.“
Diane trat beiseite, um Millie einzulassen.
Die Schwestern gingen in die Küche. Millie stellte den Karton auf dem Tisch ab und ließ sich auf einen der Stühle plumpsen, während Diane nach der Kanne der Kaffeemaschine griff und sich zur Spüle wandte, um sie mit Wasser zu füllen. Als die Kaffeemaschine zu blubbern begann, setzte sie sich ebenfalls an den Tisch und sagte milde lächelnd: „Na, dann erzähl mal!“
Das ließ sich Millie nicht zweimal sagen.
„Also, wir waren bei Mirellis. Du weißt schon, das kleine italienische Restaurant in Weston Park. Na ja, jedenfalls haben wir da gegessen und danach, ob du's mir glaubst oder nicht, als wir aus dem Restaurant kamen, stand eine weiße Kutsche mit diesem total süßen weißen Pferd vor dem Laden.“
„Schimmel“, warf Diane ein.
„Iih!“ Millie sah ihre Schwester verwirrt und angewidert an.
„Weiße Pferde nennt man Schimmel“, erklärte diese geduldig, stand auf, holte Teller, Tassen, Löffel und Zucker herbei.
Millie winkte ungeduldig ab. „Wie auch immer. Wir stiegen in die Kutsche und machten eine kleine Rundfahrt durch die Stadt. Oder zumindest dachte ich, dass wir nur eine Stadtrundfahrt machen würden.“
Millie plapperte ununterbrochen, während Diane immer wieder an die merkwürdigen Träume der letzten Nacht denken musste.
Das Landhaus war ihr seltsam vertraut, jedoch konnte sie sich nicht daran erinnern, woher sie es kannte. Sie warf ihrer Schwester einen schuldbewussten Blick zu, doch Millie fiel nicht auf, dass sie ihr nur oberflächlich zuhörte, also grübelte sie weiter.
Vielleicht war sie ja mit ihren Eltern als Kind einmal dort gewesen. Sie waren viel herumgereist und hatten so einiges gesehen. Kurz überlegte sie, ob sie Millie fragen sollte, entschied sich aber dagegen. Ihre kleine Schwester würde zu viele Fragen stellen, die sie ihr nicht beantworten konnte. Also ging sie auf Millies Erzählungen ein, stellte Fragen, machte Vorschläge und amüsierte sich über die zum Teil noch kindlichen Vorstellungen der Jüngeren.
Ihre eigene Ehe war im vergangenen Jahr nach gerade einmal drei Jahren wegen mehrfacher Untreue ihres Mannes geschieden worden.
Diane überlegte immer genau, bevor sie handelte, wog das Für und Wider ab und ließ sich nicht zu Entscheidungen drängen. Diesen Mann zu heiraten, war das einzig Spontane, das sie je getan hatte – und es war schiefgegangen. Sie waren damals durchgebrannt und hatten ihre Familien erst nach einigen Tagen über die Veränderung in Kenntnis gesetzt.
Über Millies Geplapper, ihre Erinnerungen und das Frühstück gelang es Diane tatsächlich, die rätselhaften Träume kurzzeitig zu vergessen.
Mehrere Wochen vergingen, in denen Diane beinahe jede Nacht von Dorothea und Bernard träumte. Die beiden waren ein glückliches Paar, sie liebten einander von ganzem Herzen, doch auch jetzt noch fürchtete Dorothea, dass ihnen etwas Furchtbares geschehen könne.
Es beunruhigte Diane, dass sie so oft von den beiden träumte und es beunruhigte sie noch um einiges mehr, dass sich dieses ungute Gefühl zunehmend auf sie zu übertragen schien. Zu ihrem größten Bedauern konnte sie jedoch mit niemandem darüber sprechen. Millie und Mrs. Danson, ihre Mutter, kannten kein anderes Thema mehr als die Hochzeit und Tante Adele befand sich auf Reisen. Wer blieb ihr da noch?
Ein nächtlicher Besucher
Adamsville, April 2014
„Amy!“ Die leise Stimme drang in ihren Schlaf, durchbrach die Finsternis und rief sie zu sich. „Amy! Komm zu mir, Liebes!“ Es war die leise, freundliche und doch eindringliche Stimme einer Frau.
Dr. Amy Barkley lag schlafend in ihrem Bett. Durch die geschlossenen Vorhänge vor den großen Fenstern drang kein Mondlicht herein. Amy brummte ungnädig, drehte sich stöhnend auf den Rücken und blinzelte leicht desorientiert.
„Ich komme ja schon! Bin schon auf dem Weg.“ Die junge Frau schlug die Bettdecke zurück, schwang die langen, schlanken Beine über die Bettkante und erhob sich wackelig. Sie machte sich nicht die Mühe, ihren Morgenmantel überzuwerfen. Sie war allein zu Hause und für die Person, die sie erwartete, brauchte sie sich nicht zu bemühen. Konnte man sie eigentlich überhaupt als Person bezeichnen? Egal.
Amy Barkley tapste mit halb geschlossenen Augen durch ihr Zimmer, gähnte herzhaft und fuhr sich mit einer Hand durch das kurze kastanienbraune Haar, öffnete die Zimmertür und trat hinaus auf den Flur. Hier fiel das Licht des Mondes ungehindert durch das runde Fenster am Ende des Flurs. Geblendet kniff Amy die Augen zusammen. Mit einem weiteren ungnädigen Brummen wandte sie sich vom Fenster ab und ging in die entgegengesetzte Richtung.
Am anderen Ende des Flurs stand eine Tür offen, als würde sie jemand erwarten. Sie blieb im Türrahmen stehen, lehnte sich dagegen und blinzelte in die dämmerige Dunkelheit.
„Bin da. Was gibt's?“ Ihre leise, tiefe Stimme hatte einen rauen, schläfrigen Klang.
„Nun, zuerst einmal würde ich es begrüßen, wenn du einen anderen Ton anschlagen würdest. Dann können wir uns unterhalten.“ Die kultivierte Stimme kam aus der Richtung des Schaukelstuhls vor dem Fenster, der langsam vor- und zurückwippte. Amy konnte das Profil der Frau, die in dem Schaukelstuhl saß, ausmachen.
„Sorry. Es ist mitten in der Nacht, ich habe geschlafen. Da habe ich wohl meine Manieren im Nachtschrank vergessen. Also? Was gibt es?“
Die Dame seufzte auf eine Art, die deutlich machte, was sie von diesem Benehmen hielt.
„Die letzte Zeit war sehr anstrengend, ich bin müde und würde gerne wieder in mein Bett gehen“, versuchte Amy zu erklären und rieb sich demonstrativ die Augen.
„Nun meine liebe Amy, ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen! Sehr bald werden große Veränderungen in deinem Leben geschehen. Nicht nur in deinem, sondern auch in dem deines Bruders.“
„Na, ist das nicht schön?“ Wieder ein Gähnen. Zerknirscht fügte Amy hinzu: „Versteh mich nicht falsch. Für gewöhnlich finde ich deine kleinen Rätsel und Denkaufgaben ja sehr amüsant, aber ich kann mir nicht vorstellen, was sich in unserem Leben ändern sollte. Wir stecken bis zum Arsch in Schulden und mein Arbeitgeber überlegt, das Museum zu schließen. Ansonsten läuft es auch nicht unbedingt optimal und ein Ende der Talfahrt ist nicht abzusehen.“
Das Deckenlicht im Zimmer ging an. Amy zuckte kurz, aber heftig zusammen und atmete schwer aus. „Warum erschrecke ich eigentlich immer noch? Ich sollte mich langsam daran gewöhnt haben“, murmelte sie leise vor sich hin.
Die Frau im Schaukelstuhl wandte ihr nun das Gesicht zu. Sie war um einige Jahre jünger als Amy. Ihre Haut schimmerte beinahe durchsichtig, ihre haselnussbraunen Augen, die denen der jungen Frau im Türrahmen auf so erstaunliche Weise ähnelten, blickten sanft und doch intensiv. Ihr langes, kastanienbraunes Haar fiel ihr in üppigen Wellen über die schmalen Schultern bis auf die Taille. „Habe ich dich bisher jemals belogen, Kleines?“ In ihrer Stimme klang so etwas wie Enttäuschung mit.
„Nein, hast du nicht, aber …“ Amy zuckte mit den Schultern.
Es fiel ihr schwer, daran zu glauben, dass sich etwas ändern würde. Passiert war so einiges, jedoch seit langem nichts Gutes mehr.
„Amy, hörst du mir zu? Etwas Großes wird geschehen! Etwas, das alles für immer verändern wird! Höre auf mich!“ Die Frau im Schaukelstuhl sprach eindringlich, sodass Amy gar nicht anders konnte, als ihr zuzuhören.
„Okay, sorry! Etwas Großes wird geschehen. Geht es vielleicht auch etwas genauer? Irgendwelche Zusatzinformationen vielleicht?“
„Eine Frau wird in euer Leben treten. Eine junge Frau …“
„Na, da wird sich Jim aber freuen!“, bemerkte Amy sarkastisch.
„Nicht nur Jim. Sie wird eine gute Freundin. Schenke ihr dein Vertrauen und alles wird sich zum Guten wenden.“
Amy versuchte eisern, ruhig zu bleiben. „Und weiter? Gibt's noch mehr?“ Sie musste erneut gähnen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und ließ den Kopf gegen den Türrahmen sinken.
„Sie wird dir helfen, so wie du ihr helfen wirst.“
„Aha. Noch etwas?“
„Durch ihre Güte und Liebe und vor allem ihre Opferbereitschaft wird sie vergangenes Unrecht wieder gutmachen.“
„Äh … gut.“ Amy verdrehte die Augen. „Ich werde dann mal Ausschau halten nach einer gütigen, liebevollen, opferbereiten, potenziellen Retterin. Sollte sie sich als normaler Mensch herausstellen, jage ich sie halt wieder davon und suche eine andere.“ Amy wusste, wie beißend ihre Worte klangen, aber sie waren gesprochen, bevor sie etwas dagegen tun konnte. Sie atmete schwer aus. „Sorry! Das war unangebracht.“
Die Erscheinung im Schaukelstuhl lachte leise. „Ist schon gut. Die Zeiten haben sich geändert. Heute sind die Menschen viel härter zueinander. Das ist selbst mir aufgefallen. Die Gedanken werden frei ausgesprochen. Früher wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, um ja keine verfänglichen Situationen herbeizuführen.“ Sie legte den Kopf schräg und sah gedankenverloren vor sich hin.
Einen Moment schwiegen beide. Dann sagte Amy. „Wie gesagt, sorry.“
„Schon verziehen. Aber Liebes, tue mir bitte einen Gefallen. Sie ist ein sehr scheuer Mensch und ich fürchte, dass deine, nun ja, direkte Art sie verschrecken könnte. Sei nett zu ihr.“
Auch das noch!
„Na gut. Ich halte mich zurück. Kann ich dann jetzt bitte ins Bett? Ich bin müde.“ Ihre Stimme klang quengelig und es war ihr egal.
„Selbstverständlich.“ Die Erscheinung wedelte gebieterisch mit einer ihrer schlanken, schneeweißen Hände. Nach einem kurzen Schweigen fuhr sie fort: „Ach, Liebes? Bevor du gehst …“
„Hm?“, brummte die junge Frau an der Tür und hielt noch einen Moment inne.
„Unternimm endlich etwas mit deinen Haaren! Es gehört sich nicht für eine Frau, mit solch kurzem, verstrubbeltem Haar herumzulaufen! Und deine Garderobe lässt ebenfalls zu wünschen übrig! Du hast zweifelsohne makellose Beine, aber musst du sie so schamlos zur Schau stellen? Das geziemt sich nicht für eine junge Dame! Selbst wenn du allein im Haus bist, solltest du nicht ohne Morgenmantel dein Zimmer verlassen. Du besitzt doch einen Morgenmantel, nicht wahr?“
Noch etwas, das Amy ganz und gar nicht mochte. Verbesserungsvorschläge zu ihrer Person. Sie trug ein altes, verwaschenes Holzfällerhemd ihres Bruders. Es war ihr ehrlich gesagt egal, ob es ungebührlich war, es war bequem. „Ja. Schon klar. Noch etwas?“
„Pass gut auf dich auf, meine kleine Amy! Und denke daran, was ich gesagt habe! Bis bald!“
Damit war Amy Barkley wieder allein. Sie schloss kurz die Augen und atmete geräuschvoll aus.
„Gute Nacht, Dory!“, sagte sie halblaut, bevor sie sich zum Gehen wandte. In der Luft lag der unverwechselbare Duft von Rosen. Sie knipste das Licht aus, zog die Tür hinter sich zu und ging in ihr Zimmer zurück.
Als sie wieder in ihrem Bett lag, dachte sie nach.
Großartig! Weil es ja noch nicht ausreichte, dass alle Welt sie für verrückt hielt, begann sie langsam selbst an ihrem Geisteszustand zu zweifeln. Sie zog die Bettdecke ein Stück höher und schloss die Augen, doch die Gedanken ließen sich damit nicht abwehren.
Eine junge Frau würde in ihr Leben treten und alles würde sich zum Guten wenden. Was sollte eine einzelne Person schon groß vollbringen? In letzter Zeit war einfach alles schiefgegangen. Ihr älterer Bruder Jim und sie hatten Geldsorgen, das Museum, in dem sie arbeitete, sollte geschlossen werden, wieder einmal hatte sie eine Beziehung erfolgreich in den Sand gesetzt. Wie sollte ein kleiner Mensch das wieder hinbiegen? So grübelte sie und noch bevor sie es merkte, war sie eingeschlafen.
Nachdem Amy am nächsten Morgen gefrühstückt und Jim ihr am Telefon erklärt hatte, er würde am nächsten Tag nach Hause zurückkehren, saß sie in der großen Küche und überlegte, was sie mit sich anfangen sollte.
Es war Samstag, was die Freizeitmöglichkeiten erheblich begrenzte. So beschloss sie, zum Friedhof zu gehen, um ihre Eltern und ihre kleine Schwester zu besuchen. Sie ging nach oben, duschte und zog sich an. Danach sprang sie die Treppen hinunter und verließ das Haus.
Adamsville war eine Kleinstadt. Hier lebten und arbeiteten aufrichtige, ehrenwerte Bürger, die ihre Steuern brav bezahlten, regelmäßig in die Kirche gingen und an alten Moralvorstellungen und Idealen festhielten. Ein Paradiesvogel wie Amy Barkley wurde bestenfalls geduldet. Sie passte nicht zu ihnen und die meisten ließen sie das auch in aller Deutlichkeit spüren. Doch diese offenkundige Abneigung war ihr tausend Mal lieber als das Mitleid, das ihr die etwas weicheren Seelen zuteilwerden ließen.
Auf dem Weg zum Friedhof begegneten ihr einige Einwohner der Stadt, die Rasen mähten, Zäune strichen oder sich an selbigen mit ihren Nachbarn unterhielten.
Die meisten blickten sie abschätzig bis bedauernd an, doch sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, ihre Blicke zu ignorieren. Ihr Gesichtsausdruck war und blieb unbeweglich, als sie die Hauptstraße hinunterging. Ihre Augen wurden von den dunklen Gläsern ihrer Sonnenbrille verborgen.
Niemand sprach sie an oder lächelte ihr zu, aber wen störte es? Wenn sie sich selbst auf der Straße begegnen würde, in den schwarzen Kleidern, den schweren Motorradstiefeln, den kurzen Haaren und dem düsteren Gesichtsausdruck, würde sie genauso reagieren. Zumindest ließ man sie in Ruhe. Mehr erwartete sie nicht.